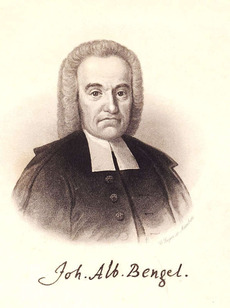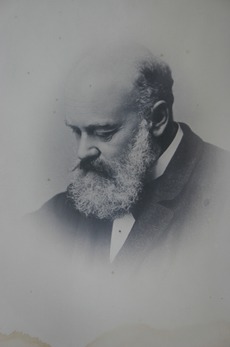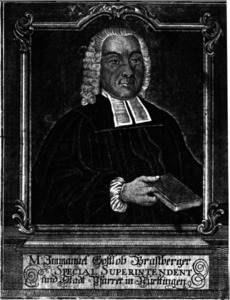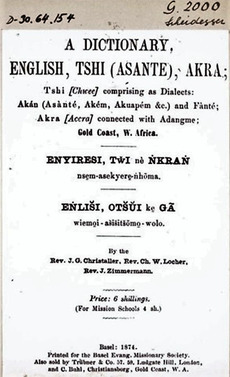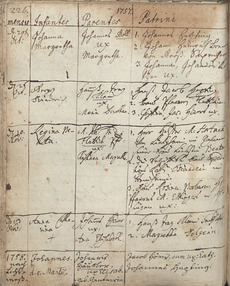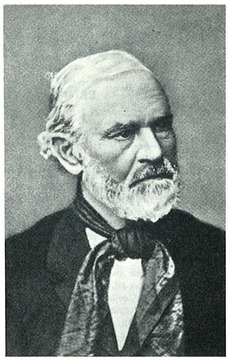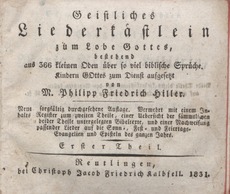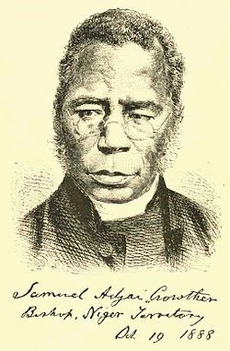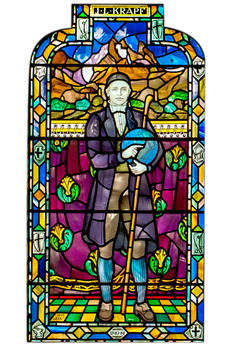Arnold, Walter
-
Von: Quack, Jürgen
Walter Arnold (1929-1994)
-
Walter Arnold. LKAS, Bilderrsammlung, Nr. 7441. Fotograf H. Kirschner
Oberkirchenrat, Leiter des Referates für Mission, Ökumene, kirchliche Entwicklungsarbeit und Publizistik 1973 - 1993
„Die Ökumene ist aus der Mission erwachsen und die ökumenische Zusammenarbeit soll eine gemeinsame Mission ermöglichen.“ Kaum einen Satz habe ich von Walter Arnold in den 70er und 80er Jahren so häufig gehört wie diesen. Das war damals nicht selbstverständlich. Es gab nicht wenige Menschen in Württemberg, die meinten, Mission und Ökumene schlössen sich gegenseitig aus. Einige behaupteten, der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) habe sich unchristlich weit von der Bibel entfernt. Andere vertraten die Ansicht, dass die Mission durch ihr unkritisches Verhältnis zum Kolonialismus diskreditiert sei und nicht fortgesetzt werden solle. Demgegenüber betonte Walter Arnold die Zusammengehörigkeit dieser beiden Dimensionen kirchlicher Arbeit. Diese Verbindung zu veranschaulichen und zu begründen, sei eine der Hauptaufgaben des „Dienstes für Mission und Ökumene“ der Landeskirche.
Walter Arnold verband sein pietistisches schwäbisches Erbe mit einem ökumenischen Horizont. Das Theologiestudium führte ihn nach Tübingen, Zürich und Basel. Nach dem Examen ging er mit einem Stipendium des ÖRK für ein Jahr an ein Baptistisches Seminar in den USA. In Württemberg war er zunächst Vikar des Stuttgarter Jugendpfarrers Theo Sorg, dann Gemeindepfarrer in Ludwigsburg.
1960 heirateten Walter Arnold und die Ärztin Dr. med. Elfriede Seids (1925-2017). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Gabriele (seit 2016 Prälatin des Sprengels Stuttgart) und Christoph (Arzt).
1964 wählte ihn der deutsche CVJM zu seinem Generalsekretär und die Familie zog nach Kassel um.
1973 wurde er als Oberkirchenrat in die württembergische Kirchenleitung berufen und übernahm von Ulrich Fick das Referat für Mission und Ökumene, kirchlichen Entwicklungsdienst und Publizistik.
„Gott schuf den Menschen mit Leib und Seele. Seelsorge und Leibsorge gehören zusammen.“ Gegen manche Ängste, dass die Entwicklungshilfe die Mission verdrängen könnte, hat Arnold immer wieder darauf hingewiesen, dass zu jeder rechten Mission von Anfang an auch die Sorge für Kranke, für ausreichende Ernährung, für Bildung und für die Einhaltung der Menschenrechte gehörten.
Mit großem Engagement verfolgte er die Stationen des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Einen wichtigen Schritt sah er darin, dass die Kirchen zum ersten Mal seit der Reformation die Lehre vom „gerechten“ Krieg ablehnen und auf eine Überwindung der politischen Institution des Krieges hinarbeiten. Er trat dafür eine, dass Deutschland den Waffenhandel einschränkt und letztlich völlig davon Abstand nimmt. So förderte er auch die Gründung des Ökumenischen Netzes Württemberg als Zusammenfassung der Gruppen in der Landeskirche, die sich um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bemühen.
In den Jahren nach der Weltmissionskonferenz in Bangkok 1973 gab es in Württemberg eine heftige Diskussion, die in der Forderung gipfelte, die Landeskirche solle ihre Mitgliedschaft im ÖRK ruhen lassen. Nach zehn Jahren der Auseinandersetzung und Klärung beschloss die Landessynode, weiter im ÖRK mitzuarbeiten. Die Mitgliedschaft solle aber „selbständiger als bisher“ wahrgenommen werden. Als Konsequenz dieser Entwicklung kandidierte Arnold 1983 bei der Vollversammlung in Vancouver für einen Sitz im Zentralausschuss und wurde gewählt. Damit begann eine neue Phase der aktiven Mitarbeit der Landeskirche im ÖRK, die vor allem durch seine Person geprägt wurde.
Besonders setzte er sich für eine Annäherung der Evangelikalen zum ÖRK – und umgekehrt – ein. Dabei arbeitete er eng mit David Gitari, dem anglikanischen Erzbischof von Kenia, und dem indischen Missionstheologen Vinay Samuel zusammen.
Auf Arnolds Initiative hin trafen sich 1987 und 1989 in Württemberg zum ersten Mal Vertreter des ÖRK mit Theologen aus der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation und der weltweiten Evangelischen Allianz zu Gesprächen über das Missionsverständnis. Eine ähnliche Konsultation mit orthodoxen und evangelikalen Theologen fand durch seine Vermittlung Anfang 1993 wiederum in Württemberg statt.
Arnolds vielfältige Kontakte in alle Welt brachten viele Besucher nach Stuttgart. Viele von ihnen waren Gäste im Haus von Walter und Elfriede Arnold, die als Fachärztin für Anästhesie tätig war.
Walter Arnold stand der pietistischen Ludwig-Hofacker-Vereinigung nahe und hatte gute Kontakte zum synodalen Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“. Er warb dort um eine konstruktive Mitarbeit des Pietismus in der ökumenischen Bewegung. Er betonte, dass es ohne den Pietismus nie eine ökumenische Bewegung gegeben hätte, denn der habe die konfessionellen Grenzen durchlässig gemacht. Der Pietismus müsse im ÖRK mitarbeiten, um „die Kirchen in ihrer weltweiten missionarischen und evangelistischen Aufgabe zu unterstützen“ (Verfassung des ÖRK III,3). Mit seinem Bemühen um die Bibel könne der Pietismus helfen, die Worte „gemäß der Heiligen Schrift“ in der Basisformel des ÖRK ernst zu nehmen. Mit seiner kirchenkritischen Haltung könne er helfen, die stetige Aufgabe der „Erneuerung der Kirche“ (Verfassung des ÖRK III,5) nicht aus dem Auge zu verlieren.
Arnold förderte auch die Gründung der Hilfsorganisation „Hilfe für Brüder“. Er war der Meinung, dass Gott sowohl durch die ökumenische wie die evangelikale Bewegung wirke und diese daher zusam¬menarbeiten müssten.
Er sorgte dafür, dass die ganze Vielfalt der Ökumene in den Prälaturteams des „Dienstes für Mission, Ökumene und Entwicklung“ (DiMOE) präsent war. An Anfang waren darin vor allem die früheren Heimatmissionare der Basler und der Herrnhuter Mission tätig. Dazu kamen bald Entwicklungshelfer von „Dienste in Übersee“, Missionare evangelikaler Missionsgesellschaften und zurückkehrende Auslandpfarrer. Diese Vielfalt der Grundeinstellungen und der Erfahrungen machte die weltweite Kirche in Gemeinden und Schulen präsent. 1975 stieß mit Martin Ngnoubamjum aus Kamerun der erste ökumenische Mitarbeiter dazu. Weitere kamen u.a. aus den Kirchen in Ghana, Südafrika, Indien, Korea, Japan und Indonesien. Viele von ihnen wurden nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatkirchen als Bischöfe oder Professoren tätig.
Parallel zum DiMOE half Arnold bei der Gründung des „Zentrums für entwicklungsbezogene Bildung“ (ZEB), das 1998 an den DiMOE angeschlossen wurde. Dort wurden vor allem die Kontakte zu Weltläden und entwicklungsbezogenen Aktionsgruppen gepflegt.
Während seiner ganzen Dienstzeit war Walter Arnold der Vertreter der Landeskirche im Missionsrat des Evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland (EMS). Mehrere Jahre war er auch dessen stellvertretender Vorsitzender wie auch des Deutschen Zweiges der Basler Mission.
Er war in vielen Funktionen in Württemberg (z.B. Vorsitz des CVJM Stuttgart, Vorsitz im Beirat der Württembergischen Bibelgesellschaft, Mitglied im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat des Süddeutschen Rundfunks), in Deutschland ( u.a. im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik und im Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes) sowie weltweit (z.B. Präsident des YMCA Weltverbandes 1977-81) tätig.
Wegen einer schweren Erkrankung konnte er im Februar 1993 nicht mehr zum Treffen des Zentralausschusses des ÖRK nach Johannesburg fahren. Darauf kaum aus der Sitzung ein Brief an ihn, der von allen 140 Mitgliedern des „Parlaments der Ökumene“ unterschrieben war.
Das durch Walter Arnold repräsentierte Engagement der Landeskirche im Ökumenischen Rat wurde dadurch anerkannt, dass bei der Vollversammlung des ÖRK in Harare 1998 die junge württembergische Theologin Heike Bosien in den Zentralausschuss des ÖRK und Eberhardt Renz, 1993 Arnolds Nachfolger als Referent für Mission, Ökumene und Entwicklung im OKR und seit 1994 württembergischer Landesbischof, zu einem der Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen gewählt wurden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/arnold-walter (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Bacmeister, Albert
-
Von: Kienzle, Claudius
Inhaltsverzeichnis
Albert Bacmeister (1845-1920)
1: Familienverhältnisse
V Christoph Heinrich Wilhelm Bacmeister (1795-1863), Notar. M Heinricke Caroline geb. Neuffer (1808-1855). G Reinhold (im Alter von zwei Wochen verstorben), Karl Eugen, Ottilie Ernestine Luise, zwei Halbbrüder: Julius, Eduard. °° Luise Auguste geb. Gantz (*1845) am 21.05.1872 in Öhringen. K Walter, Richard (Zwillingsbrüder, R. stirbt einjährig).
2: Biographische Würdigung
-
Albert Bacmeister (1845-1920)
Fotograf: H. Brandseph, Stuttgart. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 462
Die Kindheit des am 25. Oktober 1845 in Neckartailfingen (OA Nürtingen) geborenen B. war von häufigen Ortswechseln geprägt, die durch den väterlichen Notarberuf bedingt waren. Blieb die Familie trotz der ersten Versetzung des Vaters nach Köngen zunächst in Neckartailfingen, folgten sie diesem wenige Jahre später nach Weilheim/Teck, von wo aus der junge B. die Lateinschule in Kirchheim/Teck besuchte. Nach dem frühen Tod der Mutter 1855 und der Beförderung des Vaters zum Gerichtsnotar in Nürtingen 1859 wurde B. als Hospes – die Aufnahmeprüfung, das Landexamen, hatte er nicht bestanden – ins Seminar Maulbronn aufgenommen. Wenige Monate bevor er 1863 die Konkursprüfung, die ihm die Aufnahme ins Evangelische Stift in Tübingen ermöglichte, ablegte, starb auch sein Vater. In der Folgezeit klagte B. über häufige Kopfschmerzen und rezidivierende Krampfanfälle. Dieses epileptische Anfallsleiden schränkte ihn im Laufe seines Studiums und Berufslebens immer wieder ein und kam erst in hohem Alter zum Erliegen.
An der Universität trat B., dessen Großvater bereits Pfarrer gewesen war, der Burschenschaft "Tübinger Königsgesellschaft Roigel" bei. Er hörte vor allem den Dogmatiker Maximilan Landerer (1810-1878), der für seine Vermittlungstheologie bekannt war, sowie dessen Schüler, den Kirchenhistoriker Carl Weizsäcker (1822-1899), der eine eher kritische Theologie lehrte. Zugleich besuchte er Vorlesungen des Literaturwissenschaftlers und Freundes von David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), mit dem er noch nach dem Studium in brieflichem Kontakt stand.
Nach der ersten theologischen Dienstprüfung, die er krankheitsbedingt erst 1868 ablegte, wurde er durch den Balinger Dekan Karl Ludwig Heinrich Haug, in dessen Kirchenbezirk er als Pfarrverweser amtierte, ordiniert. Weitere Dienstorte führten ihn in die Nähe seines Geburtsortes nach Mittelstadt und Großbettlingen. Die Gemeinde Oberensingen verlieh dem eltern- und heimatlosen B. 1869 das Bürgerrecht.
Den Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs erlebte er als Pfarrverweser in Wangen im Allgäu. Sofort richtete B., der im Krieg gegen Österreich 1866 zwar ausgehoben, aber nicht mehr einberufen worden war, eine „flehentliche“ – aber gleichwohl unberücksichtige – Bitte an die Kirchenleitung, ihn für den Kriegsdienst freizustellen oder ihn wenigstens als Felddiakon abzuordnen. Wenig später sah er sich in der Allgäuer Diaspora öffentlichen Anfeindungen des katholischen Stadtpfarrers ausgesetzt und bat gekränkt um Versetzung. Erst nachdem er sich der überkonfessionellen Solidarität der städtischen Ehrbarkeit versichert hatte, erklärte er sich bereit, zu bleiben.
Gleichwohl beorderte ihn die Kirchenleitung kurze Zeit darauf als Pfarrverweser nach Braunsbach ins Hohenlohische, von wo aus er mit Hinweis auf seine labile Gesundheit die Zulassung zur zweiten theologischen Dienstprüfung forderte. Ausschlaggebend dürfte jedoch der Wunsch nach einer eigenen Pfarrstelle und damit nach ökonomischer Absicherung gewesen sein. Das Konsistorium entsprach seiner wiederholten Eingabe nicht, sondern betraute ihn im April 1871 mit der Vertretung der Pfarrstelle in Schlaitdorf. Dort hoffte B. erneut auf eine ständige Anstellung und mobilisierte die Gemeinde zunächst erfolgreich gegen eine weitere Versetzungsanordnung. Anfang 1872 legte er das zweite Examen ab, in dessen schriftlichen Teil er sich schwerpunktmäßig mit religionspädagogischen Fragestellungen auseinandersetzte. Dabei plädierte er für eine Professionalisierung von Geistlichen im Hinblick auf ihre Funktion als Religionslehrer und Schulaufseher und forderte Kenntnisse in Psychologie, Didaktik, Methodik, Rechtskunde und Gesundheitspflege. Nach Übertragung der Patronatspfarrstelle Niederstetten heiratete er 1872 Auguste Gantz.
In Niederstetten beschäftigte sich B. weiter mit pädagogischen Fragen und verfasste zu innerkirchlichen Fortbildungszwecken mehrere Aufsätze, mit denen er seine 1875 erstmals veröffentlichte Biblische Geschichte vorbereitete. Da die Bibel die alleinige Grundlage für den schulischen Leseunterricht war, stellte B. in dem Lehrbuch, die wesentlichen (heils)geschichtlichen Texte des Alten und Neuen Testaments in didaktisch sinnvollen Abschnitten zusammen. Neu war dabei, dass nun nicht mehr der eigentliche Bibeltext verwendet werden sollte, sondern dass B. versuchte, kindgerechter zu formulieren und auf eine Textgliederung in Verse verzichtete. Bis 1919 erfuhr das Lesebuch zehn verschiedene Auflagen, die unterschiedliche Stofffülle aufwiesen und zunehmend auch als Geschichtsbuch für die Zeit des Frühchristentums betrachtet werden kann. Über diese publizistische Beschäftigung mit religionspädagogischen Fragen hinaus war B. auch 18 Jahre lang als Direktor der Schulkonferenz in den Kirchenbezirken Blaufelden und Öhringen und als Mitglied der Kommission für das biblische Lesebuch in der Lehrerfortbildung tätig.
Das Pfarramt in Niederstetten befriedigte B. nur bedingt. Bereits drei Jahre nach seiner Ernennung zum dortigen Pfarrer und ein Jahr nach der Geburt seiner Zwillingssöhne, von denen einer nach wenigen Monate starb, bewarb er sich 1875 aus nationalliberaler Gesinnung und in „glühe[ndem] Verlagen“, aber erfolglos, um eine Divisionspredigerstelle. Stattdessen wurde er ab 1879 Stadtpfarrer von Öhringen und konnte als Archivar des Hauses Hohenlohe sowie im „Historischen Verein für württembergisch Franken“ seinen wissenschaftlichen Interessen nachkommen. Diese veranlassten ihn an einem Preisausschreiben der gerade gegründeten holländischen „Teylers Fundatie“ in Haarlem teilzunehmen. Seine daraus entstandene Arbeit über die ethische Prinzipienlehre in Eduard von Hartmanns (1842-1906) Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins reichte er 1882 bei dem Pessimismusexperten Edmund Pfleiderer (1842-1902) in Tübingen als philosophische Dissertation ein.
In den folgenden Jahren setzte B. seine wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit fort. Er publizierte zahlreiche Aufsätze in der Protestantischen Kirchenzeitung für das evangelische Deutschland, dem theologischen Literaturblatt, der Allgemeinen Evangelischen-lutherischen Kirchenzeitung, den deutsch-evangelischen Blättern, den Blättern für Württembergischen Kirchengeschichte sowie dem kirchlichen Anzeiger in Württemberg.
Nachdem ihm 1889 die Dekanstelle in Geislingen übertragen worden war, zog er sich nur sieben Jahre später von dieser Führungsposition zurück und übernahm die Stelle des Ludwigsburger Garnisonspredigers. Damit verschaffte er sich jedoch gute Kontakte zum Herrscherhaus und zum Regierungsapparat, die später zu zahlreichen Ehrungen bis hin zur Verleihung des Titels Oberkirchenrat führten. Ihm gelang es, nicht zuletzt durch manipulativen Medieneinsatz – er verfasste im Schwäbischen Merkur einen anonymen Artikel, der den vorliegenden Architektenentwurf scharf kritisierte – den Neubau der Ludwigsburger Garnisonskirche voranzutreiben, die 1903 eingeweiht wurde. Bereits während der Bauphase hatte sich B. um die Dekanstelle in Ludwigsburg beworben, die ihm erst im zweiten Anlauf 1904 übertragen wurde und die er bis zu seiner Pensionierung 1917 innehatte.
In seiner Ludwigsburger Zeit setzte er seine religionspädagogische Tätigkeit fort und leitete die Fortbildungskurse der Predigtamtskandidaten für Religionsunterricht. Zugleich war er ab 1896 als Vorstand der Ludwigsburger Kinderverwahranstalt, der Charlottenkrippe, ab 1899 als Vorstand des „Vereins zur Unterstützung des Württembergischen Lutherstifts“ für Pfarrsöhne sowie ab 1904 als stellvertretender Verwaltungsratvorsitzender der „Evangelischen Kinder- und Brüderanstalt Karlshöhe“ im sozialen Bereich aktiv. Er engagierte sich zudem in der pfarrerlichen Standesvertretung, dem „Evangelischen Pfarrverein in Württemberg“. Anknüpfend an seine frühere Mitgliedschaft in der Landessynode kandidierte B. 1912 für den Wahlbezirk Öhringen – eine Kandidatur im eigene Kirchenbezirk war ihm laut Wahlgesetz versagt – und war dort stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für das Spruch- und Liederbuch sowie Sprecher einer Mittelpartei. Bereits 1888-1897 war er für verschiedene hohenlohische Kirchenbezirke Abgeordneter im Kirchenparlament, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsordnungskommission sowie geistlicher Ersatzmann für den Synodalausschuss, dem höchsten Gremium zwischen den ordentlichen Tagungen der Synode.
B. stand der liberalen Theologie nahe. Er beteiligte sich gegen den Widerstand der Kirchenleitung 1910 gemeinsam mit seinem Freund Theobald Ziegler, dem Biografen des umstrittenen Protagonisten der liberalen Theologie, David Friedrich Strauß, an der Einweihung eines Denkmals für diesen im Ludwigsburger Schlossgarten. Über beide verfasste B. biografische Abrisse im Staatsanzeiger für Württemberg. In seinen biblischen Geschichten versuchte er, vor allem in den späteren Auflagen, die Geschichte des Urchristentums nicht etwa heilsgeschichtlich zu deuten, sondern chronologisch zu präsentieren. Trotz seiner nationalliberalen Einstellung blieb er ein zuverlässiger Verfechter der Monarchie. In seinem Buch über das württembergische Königshaus, das zugleich als eine Kultur- und Infrastrukturgeschichte Württembergs des 19. Jahrhunderts gelesen werden kann, äußerte er zwar Sympathien für die Revolutionsideen von 1848, zeigte sich jedoch letztlich als kaisertreuer Befürworter der kleindeutschen Reichseinigung von 1871. Am 28. Juni 1920 verstarb er.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Schwäbischer Merkur 1920, Nr. 300, S. 5
Staatsanzeiger für Württemberg 1920, Nr. 151, S. 3
Walter Bacmeister, Die literarische Tätigkeit des Karl Albert Wilhelm Bacmeister, in: Familienverband der Bacmeister. Nachrichtenblatt, Anlage zu Nr. 56, Januar 1959. o.S..
Quellen:
LKAS A27, Nr. 67
LKAS PfA Garnisonsgemeinde Ludwigsburg, Nr. 19+20, 24
UAT 131/32b Nr. 15
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/bacmeister-albert (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Barth, Christian Gottlob
-
Von: Quack, Jürgen
Christian Gottlob Barth (1799 -1862)
-
Christian Gottlob Barth
Archiv der Basler Mission, QS-30.008.0014
Die erste Sammelbüchse für die Basler Mission stellte der Student Christian Gottlob im Herbst 1818 im Evangelischen Stift in Tübingen auf. Die Idee dazu bekam er von Robert Pinkerton aus London, den er kurz zuvor in Stuttgart getroffen hatte. Pinkerton war in die Schweiz und nach Deutschland gekommen, um Missionare für die englischen Missionsgesellschaften zu werben.
Barth wäre gerne selbst Missionar geworden, da er jedoch für seine alleinstehende Mutter sorgen musste, war das nicht möglich. Aber er wurde zum wichtigsten Freund der Basler Mission in Deutschland. Er predigte auf zahlreichen Missionsfesten und schrieb viele Missionslieder, z.B. einige Strophen des Liedes „Sonne der Gerechtigkeit“ (EG 263). Er wurde Pfarrer in Möttlingen, gründete den Calwer Missionsverein und gab ab 1828 das Calwer Missionsblatt heraus. Er stand in engem Kontakt mit vielen Missionaren – etwa 1000 Briefe jährlich wechselte er mit ihnen. In seinem Arbeitszimmer stand eine Uhr mit vier Zifferblättern, drei davon zeigten die Uhrzeiten in anderen Weltgegenden, wo diese Missionare tätig waren. 1832 veröffentlichte er „Zweymal zwey und fünfzig biblische Geschichten für Schulen und Familien“, das in 87 Sprachen übersetzt wurde.
Als 1838 Christian Gottlob Blumhardt (1779-1838), der erste Inspektor der Basler Mission starb, wählte das Komitee Christian Barth zu dessen Nachfolger. Aber Barth lehnte ab. Er hatte sich gerade aus dem Pfarrdienst entlassen lassen, um ganz für den von ihm gegründeten Calwer Verlag tätig zu sein. Er empfahl statt seiner Wilhelm Hoffmann, den Sohn des Gründers von Korntal, der dann auch gewählt wurde.
Barth war ein Mann mit knitzem Humor. Seine „Geschichte von Württemberg“ beginnt mit den Worten „Der geneigte Leser muss vor allen Dingen wissen, dass es zwei gelobte Länder in der Welt gibt, das eine ist das Land Kanaan oder Palästina, und das andere ist Württemberg. Das glauben wenigstens viele ehrliche Württemberger, besonders solche, die von anderen Ländern außer dem Namen nicht sehr viel wissen …“. Es war Barths Lebenswerk, dass die Württemberger mehr über die fremden Länder und die dort tätigen Missionare lernten.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/barth-christian-gottlob (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Bengel, Johann Albrecht
-
Von: Ising, Dieter
Johann Albrecht Bengel (1687-1752)
-
Johann Albrecht Bengel, Stich nach einem Gemälde
Aus: Oscar Wächter: Johann Albrecht Bengel. Lebensabriss, Character, Briefe und Aussprüche, 1865
Im Jahr 1687 in Winnenden geboren, musste Bengel als Kind vor einrückenden französischen Truppen aus seiner Geburtsstadt flüchten. Kurz darauf erlebte er die Plünderung und Brandschatzung Marbachs. Früh verlor er den Vater. Nach dem Besuch des Stuttgarter Gymnasiums bezog er 1703 das Tübinger „Stift“, das Begabten bei freier Kost und Logis das Theologiestudium ermöglichte.
1713 wurde er zum Lehrer an der Klosterschule Denkendorf bei Stuttgart ernannt. Als Vorbereitung auf die Stelle unternahm er eine Bildungsreise, die ihn bis nach Halle an der Saale führte. Dort beeindruckte ihn die Begegnung mit August Hermann Francke, einem der führenden Pietisten seiner Zeit.
In Denkendorf unterrichtete er bis 1741 den theologischen Nachwuchs. Die Schüler sollten sich mit großem Ernst auf den Pfarrberuf vorbereiten, ihre Seele „sammeln“ und das „Aufatmen zu Gott mitten unter der Arbeit“ nicht vergessen. Bengel verstand sich als ihr Lehrer und Seelsorger; er nahm sich vor, geduldig und gütig zu sein.
In dieser Zeit wurden ihm und seiner Frau Johanna Regina geb. Seeger zwölf Kinder geboren; sechs von ihnen starben früh.
Bengel war nicht nur ein engagierter Pädagoge. Mit Sorgfalt und Ausdauer widmete er sich wissenschaftlichen Arbeiten, vor allem dem Text und der Auslegung des Neuen Testaments, die ihn weithin bekannt machten.
Als man ihn 1741 zum Prälaten von Herbrechtingen ernannte, gehörte zur Prälatenwürde die Mitgliedschaft im württembergischen Landtag. Hier wurde Bengel aufgrund seines hohen Ansehens 1747 in den Großen und 1748 in den Engeren Landtagsausschuss gewählt. 1749 ernannte man ihn zum Prälaten von Alpirsbach; damit verbunden war ein Sitz im Konsistorium, der Stuttgarter Kirchenleitung.
Bengel hatte sich für diese Ämter nicht beworben. Er wurde, inzwischen 60 Jahre alt und gesundheitlich angegriffen, von den Berufungen überrascht. Sie eröffneten ihm ein umfassendes Einspruchsrecht bei wichtigen politischen und kirchlichen Entscheidungen. Nachdem 1743 die pietistischen Privat-Erbauungsstunden legalisiert worden waren, kann man die Bengel zuteil gewordene Stellung als landes- und kirchenpolitisches Zeichen verstehen. Mit ihm erhielt der Pietismus, der sich als „Lebens-Reformation“ verstand, einen festen Platz in Württemberg.
In Stuttgart ist Bengel am 2. November 1752 gestorben.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Burk, Johann Christian Friedrich, Dr. Johann Albrecht Bengel’s Leben und Wirken, meist nach handschriftlichen Materialien bearbeitet. Stuttgart: Joh. Friedr. Steinkopf 1831
Burk, Johann Christian Friedrich, Dr. Johann Albrecht Bengels literarischer Briefwechsel. Eine Zugabe zu dessen Leben und Wirken. Stuttgart: F. Brodhag 1836
Hehl, Werner, Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk. Stuttgart 1987
Hermann, Karl, Johann Albrecht Bengel. Der Klosterpräzeptor von Denkendorf. Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung 1937
Ising, Dieter, Radikaler Pietismus in der frühen Korrespondenz Johann Albrecht Bengels, PuN 31, 2005, 152–195
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/bengel-johann-albrecht (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Binder, Christoph
-
Von: Heizmann, Uwe
Christoph Binder (1519-1596)
Christoph Binder wurde als am 28. Dezember 1519 in Grötzingen (Lkr. Esslingen) als unehelicher Sohn des dortigen Priesters Georg Binder und der Katharina Bainhardt geboren.(1) Georg Binder lebte, obwohl als katholischer Priester eigentlich an das Zölibat gebunden, wie damals viele seiner Amtsgenossen in wilder Ehe.(2) Nach der Einführung der Reformation in Württemberg 1534 trat er zur evangelischen Konfession über und ehelichte wahrscheinlich noch im selben Jahr Katharina Bainhardt.(3) Georg Binder besaß in Grötzingen ein eigenes Haus, weshalb ein gewisses Vermögen angenommen werden kann, mit dem er seinem begabten Sohn eine gründliche Ausbildung ermöglichte. (4)
Ab 1557 war er Pfarrer sowie ab 1558 bis 1565 Dekan in Nürtingen. 1560 war er als Reformator für die Reichsstadt Weil der Stadt vorgesehen. Dieser Plan der herzoglichen Kanzlei wurde jedoch wegen des Widerstands der dortigen Bürger aufgegeben.(5) Binder war für Herzog Christoph mehrfach in wichtigen auswärtigen Kirchenangelegenheiten unterwegs. Möglicherweise war er in diesem Zusammenhang 1560 bis 1561 nach Reichenweier(6) im Elsass abgeordnet, um in der gleichnamigen württembergischen Herrschaft das lutherische Bekenntnis einzuführen. Mit demselben Auftrag wurde er in die weiter südlich gelegenen, zu Württemberg gehörenden Grafschaft Mömpelgard(7) entsandt.(8) Außerdem soll er 1562 ins Herzogtum Sachsen gereist sein, um in einem Religionsstreit zu vermitteln.(9) Am 14. Februar 1565 wurde er zum ersten evangelischen Abt des Klosters Adelberg (Klosterschule) ernannt. Dieses Amt hatte er bis 1590/95 inne. Zugleich war er von 1557 bis 1586/90 Generalsuperintendent in Denkendorf. 1594 nahm er am Reichstag von Regensburg teil. Er war auch herzoglich-württembergischer Rat. Im Februar 1595 trat er von seinen Ämtern zurück. Er starb am 31. Oktober 1596 in Adelberg.(10)
Die Dokumente zur Binders Einsetzung als Abt des Klosters Adelberg, Urkunde und Revers, sind im Hauptstaatsarchiv Stuttgart im Bestand A 469 I unter den Signaturen U 681 und U 682 überliefert und liegen hier als Transkriptionen vor:
Urkunde vom 14. Februar 1565 über die Einsetzung des bisherigen Pfarrers von Nürtingen, Christoph Binder, als Abt des Klosters Adelberg, einschließlich der Aufführung seiner Rechte, Pflichten, Besoldung usw., ausgestellt durch Herzog Christoph von Württemberg
Revers vom 14. Februar 1565 von Christoph Binder über seine Einsetzung als Abt des Klosters Adelberg, einschließlich der Aufführung seiner Rechte, Pflichten, Besoldung usw., Revers zur entsprechenden, von Herzog Christoph von Württemberg unterm selbigen Datum ausgestellten Urkunde
Veröffentlicht am: : 29.03.2019
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
Heizmann, Uwe: Binder, Christoph, in: Württembergische Kirchengeschichte Online, 2019
https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-christoph (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Binder, Johanna

-
Von: Kittel, Andrea
Inhaltsverzeichnis
Johanna Binder (1896-1990)
Fast fünfzig Jahre lang hat Johanna Binder mit ihrer Arbeit die textilen Kirchenausstattungen der württembergischen Landeskirche geprägt. Als Leiterin der Paramentenwerkstatt beriet sie unzählige Kirchengemeinden bei der Anschaffung liturgischer Altar-, Taufstein- und Kanzelbedeckungen, die sie dann nach Entwürfen von Künstlern mit ihren Weberinnen und Stickerinnen in hoher handwerklicher Qualität herstellte.
Johanna Binder war schöpferisch begabt und als gelernte Damenschneiderin durchaus erfolgreich. 1919 wurde sie „Lehrmeisterin“ der neu eingerichteten Fachklasse für Mode an der Württembergischen Staatlichen Kunstgewerbeschule – der heutigen Kunstakademie. Doch die Aussicht auf eine Karriere in der Modebranche schlug sie aus. Als 1924 der Bund Evangelischer Frauen beabsichtigte, mitten in der Inflation eine Evangelische Frauenarbeitsschule in Stuttgart zu gründen, und Johanna Binder bat, die Leitung zu übernehmen, sagte sie kurzerhand zu.
1: Evangelische Frauenarbeitsschule
Junge Mädchen sollten dort nach dem Schulabschluss in Sticken, Kleider- und Weißnähen unterrichtet werden, um sich für ihre zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter zu qualifizieren. Der evangelische Charakter der Schule wurde durch Morgenandachten und Vorträge über diakonische Themen gepflegt. In der Wirtschaftskrise waren mehrere städtische Nähschulen geschlossen worden, so dass der Zulauf zu der evangelischen Einrichtung mit Zentrale in der Furtbachstraße groß war. Schon im zweiten Schuljahr unterrichteten 19 Lehrerinnen in 9 Zweigstellen rund 400 Schülerinnen.
2: Paramente zum Schmuck der Kirchen
Noch im Gründungsjahr der Schule wurde auf Anregung des Vereins für christliche Kunst zusätzlich eine Paramentenwerkstatt angegliedert und ebenfalls unter die Leitung von Johanna Binder gestellt. Anfangs arbeitete man noch mit Tuch, Borten und Fransen. Als es in Deutschland eine Neubesinnung über Sinn und Zweck in der evangelischen Paramentik gab, machte Johanna Binder diesen Wechsel mit und erlernte, neben ihren vielfältigen Leitungsaufgaben, Spinnen von Flachs und Wolle, Färben mit Pflanzen, Weben und komplizierte Sticktechniken. Wertigkeit und „Echtheit des Materials“ waren für sie fortan Standard. 1938 legte sie mit Auszeichnung eine zweite Meisterprüfung ab und konnte nun in ihrer Werkstätte Fachkräfte ausbilden.
Nach ihrer Auffassung lag die Basis guter Paramentik in der engen Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Ausführenden, und so produzierte sie gemeinsam mit namhaften Kunstschaffenden über viele Jahre hinweg anspruchsvolle Werke.
Zur Produktpalette der Paramentenwerkstatt gehörte auch die Amtstracht für die Geistlichen. Bei der Einführung der Frauenordination 1968 war Johanna Binders Rat zur Form des Talars und des Baretts für die Pfarrerinnen sehr geschätzt. Zuvor hatte sie schon ein spezielles Frauenbeffchen entwickelt, das sich allerdings langfristig nicht durchsetzte.
Als Johanna Binder 1970, mit 74 Jahren, in den Ruhestand ging, konnte sie auf ein Berufsleben zurückblicken, das sie in der ganzen Vielfalt ausgefüllt hatte: Da war die Verantwortung für Angestellte, Auszubildende und Schülerinnen, ihre Zähigkeit und Improvisationskunst in wirtschaftlicher Not und Krieg, weite Beratungsreisen über Land und Fußmärsche mit schwerem Gepäck, ihr notwendiges Einfühlungsvermögen in die jeweiligen Kirchenräume, Verhandlungsgeschick, kreative Gestaltungsprozesse, Überzeugungskunst für würdige Ausstattungen….
Ihr begeistertes Engagement für die Paramentik hat Johanna Binder als diakonischen Auftrag verstanden. Den Weg dorthin eingeschlagen zu haben, hat sie nach eigenem Bekunden nie bereut.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-johanna (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Binder, Rosina
-
Von: Kittel, Andrea
Rosina Binder (1827-1908)
-
Rosina Widmann, geb. Binder
bmarchives Nr. QS-30.108.0006
Vor 175 Jahren fuhr die 19jährige Rosina Binder von Korntal über London mit dem Schiff nach Westafrika an die Goldküste, dem heutigen Ghana, um den ihr völlig unbekannten Missionar Johann Georg Widmann (1814-1876) zu heiraten. Als sie am 15. Januar 1847 bei ihrer Ankunft in Accra in einem Boot an Land gebracht wurde, ahnte sie noch nicht, dass sie 30 Jahre lang auf diesem Kontinent bleiben würde. Sie ahnte noch nicht, dass sie ein Mädcheninstitut, einen Kindergarten und eine Sonntagsschule gründen, in ihrem Haus Waisen und Verstoßene aufnehmen und darüber hinaus 11 Kinder gebären würde.
Rosina Binder war eine sogenannte Missionsbraut. Die Bauerstochter hatte kurzerhand zugesagt, als die Basler Mission für einen bereits ausgereisten Missionar eine Frau suchte. Sie stammte aus pietistischen Kreisen, und so war der Wunsch, ihr Leben in den Dienst des Herrn zu stellen und für das Reich Gottes tätig zu werden, schon früh genährt worden. Eine eigenständige Berufstätigkeit war für Frauen damals nicht vorgesehen. Die Heirat mit einem Missionar war die einmalige Gelegenheit sich im Glauben zu verwirklichen, die Enge der Heimat zu verlassen und nicht zuletzt auch ein Abenteuer zu begehen.
-
Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca. 1857
bmarchives Nr. QD-30.011.0062
Am 17. September 1846 wurde Rosina Binder in Korntal für ihren Dienst in Westafrika eingesegnet. Danach begann ihre Reise ins Unbekannte. Durch die langen Postwege hatte sie von ihrem Bräutigam noch kein persönliches Wort erhalten. Hinzu kam: Afrika galt als „Todesland“. Tropenkrankheiten, das Klima und die schlechte Infrastruktur hatten viele Missionare in kürzester Zeit dahingerafft. Nachdem zuvor mehrere bereits anvisierte Heiratskandidatinnen abgesprungen waren, hatte ihr Bräutigam 1846 verzweifelt an das Basler Komitee geschrieben: „Das arme Afrika ist zu sehr gefürchtet, so daß sich nicht leicht eine Person entschließen kann hierher zu kommen."
Nun aber war Rosina Binder auf dem Weg. Nach siebenwöchiger Schiffsreise, gebeutelt von Stürmen und Seekrankheit, erreichte sie die Küstenstadt Accra. Über ihre erste Begegnung mit dem Bräutigam schreibt sie in ihrem Tagebuch, dass sie beide miteinander auf die Knie sanken und Gott dankten, dass er sie so glücklich zusammengeführt habe. „Wir sahen uns nicht an, als sähen wir uns zum ersten Male, denn der Herr, der unseren Bund geschlossen (…) verband unsere Herzen noch ehe wir uns kannten in inniger Liebe.“ Eine Woche später waren sie verheiratet.
-
Missionsstation Akropong
bmarchives Nr. D-30.11.002
Rosina Widmann, geborene Binder gehört zu den ersten Missionarsfrauen der Basler Mission. Auf der Missionsstation ihres Mannes in Akropong erwartete sie vor allem Aufbauarbeit. Um Zugang zum weiblichen Teil der einheimischen Akan-Bevölkerung zu bekommen, lernte sie die Twi-Sprache. Mit großer Zähigkeit engagierte sie sich für christliche Mädchenbildung, Kinderbetreuung, Krankenversorgung, Seelsorge und ganz besonders für ausgestoßene missgebildete Kinder. Von ihren eigenen elf Kindern überlebten sechs. Diese wurden im schulpflichtigen Alter ins Basler Missionskinderhaus und zu Verwandten geschickt und dort aufgezogen. Obwohl sie deshalb ein lebenslanger Schmerz begleitete, blieb sie immer in ihrem Beruf an der Seite ihres Mannes im Missionsfeld. Erst als Johann Georg Widmann 1876 starb, kehrte sie, 50jährig, in ihre Heimat nach Korntal zurück, wo sie noch bis 1908 lebte.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Quelle: Tagebuch der Rosina Binder, Archiv der Basler Mission (ABM) Nr. D-10.4.9
Bildnachweise
-

- Rosina Widmann, geb. Binder
Rosina Widmann, geb. Binder
bmarchives Nr. QS-30.108.0006
-

- Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca.
Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca. 1857
bmarchives Nr. QD-30.011.0062
-

- Missionsstation Akropong
Missionsstation Akropong
bmarchives Nr. D-30.11.002
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-rosina (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Blaich, Martin
-
Von: Eisler, Jakob
Martin Blaich (1820-1903)
-
Martin Blaich
Evangelische Karmelmission, Schorndorf
Martin Blaich wurde am 23. September 1820 in Zwerenberg im Schwarzwald geboren. 1848/49 meldete er sich für das Studium bei der Basler Mission, wurde aber zur Abreise nach Ostafrika mit Johann Ludwig Krapf bestimmt. Wegen seiner schlechten Gesundheit blieb er in Württemberg und konnte in die Basler Mission nicht eintreten. Dagegen wurde er in die Missionsschule des „Deutschen Tempels“ am Kirschenhardthof bei Marbach aufgenommen und wurde Evangelist der Tempelgesellschaft im Schwarzwald. Mit Johannes Seitz trat er im Jahre 1878 aus dieser aus und gründete den „Evangelischen Reichsbrüderbund“ als Frucht der Erweckungsbewegung in Ostpreußen. Blaich unternahm einige Reisen nach Palästina. In den Jahren 1872 und 1881 war er für die Kirchler-Gemeinde in Haifa als Seelsorger tätig. 1891 gründete er auf dem Karmelberg in Haifa die Evangelische Karmelmission. 1893 errichtete Blaich in Preußisch Bahnau (heute Selenodolskoje) ein christliches Erholungsheim, wo er am 19. August 1903 starb.
Martin Blaich war ein begehrter Seelsorger und Erweckungsprediger und betätigte sich in der Heilung von Menschen durch Handauflegung und Gebet. Blaich war in Kreisen um Johann Chr. Blumhardt sen. bekannt. Er schrieb viele kleine Schriften und gab zusammen mit Johannes Seitz die Zeitschrift „Der Evangelische Brüderbote“ heraus.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
-

- Martin Blaich
Martin Blaich
Evangelische Karmelmission, Schorndorf
-

- Grab von Blaich in Bahnau in Ostpreußen (vor 1945)
Grab von Blaich in Bahnau in Ostpreußen (vor 1945)
Privatbesitz Dr. Jakob Eisler
-

- Haus von Blaich auf dem Karmelberg
Haus von Blaich auf dem Karmelberg
Evangelische Karmelmission, Schorndorf
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/blaich-martin (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Blumhardt, Christian Gottlieb
-
Von: Ising, Dieter
Christian Gottlieb Blumhardt (1779-1838)
-
Christian Gottlieb Blumhardt (Lithographie J. Velten / Kauffmann)
gemeinfrei (Quelle: Württembergische Landesbibliothek)
Er war ein theologisch gebildeter Mann, körperlich leidend, in seinen Entscheidungen vorsichtig, manchmal ängstlich. Aber den von ihm ausgebildeten über 300 Basler Missionsschülern hat er ein Gefühl für Gerechtigkeit eingeprägt, besonders gegenüber leidenden Menschen, die er als "ehrwürdige Menschen-Klasse" bezeichnet. Dazu gehören für ihn auch die Opfer der Sklaverei.
Der 1779 in Stuttgart geborene Christian Gottlieb Blumhardt stammt aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater Johann Matthäus Blumhardt ist Schuhmacher, die Mutter Christine Barbara geb. Völcker eine Schuhmacherstochter. Christian Gottlieb, von 1798 bis 1803 Theologiestudent in Tübingen, ist einer der frommen Studenten, die den "Verein christlicher Studierender" gründen, auch "das Kränzchen" oder "die Pia" genannt. Später haben der "Pia" unter anderen Ludwig Hofacker, Christian Gottlob Barth und Johann Christoph Blumhardt angehört. 1803 wird Christian Gottlieb von Christian Friedrich Spittler, dem überlasteten Sekretär der Christentumsgesellschaft, nach Basel gerufen. Er soll ihm das Veröffentlichen von Berichten abnehmen und die Erbauungsstunden der Gesellschaft halten. Blumhardt und Spittler, der entscheidungsfreudige Praktiker, ergänzen sich in idealer Weise.
Der für die Tätigkeit in Basel beurlaubte Blumhardt wird 1807 vom Stuttgarter Konsistorium zurückgerufen, um kirchliche Dienste in Württemberg zu übernehmen. Anfangs Vikar in Derendingen bei Tübingen, wird er 1809 Pfarrer in Bürg, heute Ortsteil von Neuenstadt am Kocher. Im gleichen Jahr heiratet er Julie geb. Maier.
Die Anfangsjahre der Basler Mission
Aber Spittler lässt ihn nicht los und beruft ihn zum Inspektor der 1815 gegründeten Basler Mission. So prägt Blumhardt die Anfangsjahre dieses großen Werks, das bis heute Missionare in alle Welt schickt. In den ersten Jahren beschränkt man sich auf die Ausbildung von Sendboten für die englische Church Missionary Society, was aber zu Differenzen führt. Seit 1821 werden Basler Missionare in eigene Arbeitsgebiete entsandt, nach Südrussland und Persien, an die westafrikanische Goldküste und nach Südwestindien.
Blumhardt, der Theologe und Schriftsteller, gibt 1816–1838 das Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften heraus. 1828–1837 tritt er mit dem dreibändigen Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi an die Öffentlichkeit. Bereits 1807 hat er sein Buch Lazarus der Leidende, Kranke, Sterbende und Auferweckte publiziert.
Als im Jahr 1827 Basler Missionare nach Liberia, ins malariaverseuchte Westafrika, entsandt werden sollen, hat Blumhardt vorrangig das Leiden der einheimischen Bevölkerung im Blick. Wenn "die schnöde und barbarische Habsucht der Europäer jedes Jahr wenigstens 60.000 unglückliche Schlachtopfer armer Neger den Sklavenketten Westindiens überliefert", wenn die Sklavenhändler das Klima nicht scheuen – sollen sich dann die Verkündiger des Evangeliums von dort fernhalten? Das wäre "eine Schmach des Namens Christi".
Christian Gottlieb ist der Cousin des Vaters von Johann Christoph Blumhardt, dem Theologen der Hoffnung und Seelsorger in Möttlingen und Bad Boll. Ihre Lebenswege kreuzen sich, als der junge Johann Christoph 1830 Missionslehrer in Basel wird. Sein Vorgesetzter sei ihm ein väterlicher Freund gewesen, schreibt Johann Christoph. Er und seine Frau Doris geb. Köllner werden im September 1838 von Christian Gottlieb Blumhardt getraut. Einige Wochen später erkrankt der Inspektor. Er stirbt am 19. Dezember 1838 in der Hoffnung, auch nach seinem Tod an Gottes "Reichssache auf Erden", der Mission, teilnehmen zu können: "Wenn ihr euch hier unten über einen Sieg freut, so denket immer, ich feire droben mit."
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/blumhardt-christian-gottlieb (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Blumhardt, Christoph Friedrich
-
Von: Ising, Dieter
Inhaltsverzeichnis
Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)
1: Familienverhältnisse
-
Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)
Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nachlass Jäckh
Vater: Johann Christoph (16.7.1805–25.2.1880), Pfarrer in Möttlingen und 1852 Leiter von Bad Boll. Mutter: Dorothea (Doris), geb. Köllner (1816–1886). Geschwister: Maria (1840–1923); Carl (1841–1892), Fabrikant bei Elberfeld; Theophil (1843–1918), Pfarrer im Dorf Boll; Rahel (* und † 1845); Nathanael I. (* und † 1846); Nathanael II. (Landwirt in Bad Boll, dann Neuseeland); Bertha (1853–1854). Am 12.5.1870 heiratet Christoph Friedrich Blumhardt die Tochter des Hofgutpächters von Einsiedel, Emilie Pauline geb. Bräuninger (7.12.1849–14.9.1929).
Kinder: Dorothea (1872–1947) ¥ Theophil Brodersen; Herrmann (1873–1909), Arzt; Clara (*1874) ¥ Johannes Weber; Katharina (1875–1960), Hebamme; Elisabeth (1877–1962) ¥ Dr. Eduard Vopelius; Salome (1879–1958) ¥ Prof. Richard Wilhelm; Friedrich (1881–1941), Farmer in Neuseeland ¥ Martha geb. Honeck; Hanna (1883–1971), Lehrerin ¥ Prof. Hermann Bohner; Georg (1885–1918), Diplomingenieur; Gottliebin (1889–1976), Lehrerin; Immanuel (1892–1916), Landwirt.
2: Biographische Würdigung
Geboren zu einer Zeit, als sein Vater Johann Christoph die erkrankte Gottliebin Dittus, eine junge Frau aus der Möttlinger Gemeinde, seelsorgerlich betreute, hat Christoph Blumhardt die Anfänge der Möttlinger Bewegung miterlebt. Die Erweckung der Gemeinde, Gebetsheilungen, der Zustrom Auswärtiger und die öffentliche Kritik an seinem Vater haben seine Kindheit bestimmt. 1852 zog die Familie nach Bad Boll, wo der Vater im Kurhaus ein Seelsorgezentrum gründete, das Menschen aus ganz Europa besuchten. Die durch Erweckungen und Heilungen verstärkte Hoffnung des Vaters auf eine baldige Ausgießung des Heiligen Geistes über die ganze Welt prägte auch Christoph Blumhardt.
Im Tübinger Theologiestudium (1862–1866) beschäftigten ihn die Reibungsflächen zwischen dem Erleben in Bad Boll und der „wissenschaftlichen Sphäre der Theologie“. Er setzte sich der wissenschaftlichen Kritik aus, gab aber das im Elternhaus erworbene Fundament seiner Glaubensüberzeugung nicht preis. Nach dem 1. Theologischen Examen wurde er Vikar im badischen Spöck bei Pfarrer Peter, einem Freund des Vaters und Nachfolger von Aloys Henhöfer. Vikariate an wechselnden Orten führten ihn in die Nähe Bad Bolls. Vom Vater früh als Nachfolger ins Auge gefasst, plagten ihn Zweifel, ob er dieses Amt nicht bloß als Epigone, sondern im vollmächtigen Sinne werde ausüben können.
Etwas ratlos wurde er 1869 Vikar und Sekretär seines Vaters. Erst als Gottliebin Dittus, die mit ihren Geschwistern den Blumhardts nach Bad Boll gefolgt war, 1872 im Sterben lag und die Umstehenden mit ihrer entschiedenen Hoffnung auf Gottes Reich beeindruckte, gewann Christoph Blumhardt einen eigenen Zugang zum avisierten Beruf. Nach des Vaters Tod übernahm er 1880 die Leitung Bad Bolls, das er anfangs ganz in dessen Sinne führte.
Bald wurde ihm klar, dass dieses als geistliches Zentrum nur fortbestehen konnte, wenn neue Wege eingeschlagen wurden. So konnte er den frommen Egoismus der Heilungsuchenden in Bad Boll, den bereits der Vater misstrauisch beäugt hatte, mit der biblischen Hoffnung: „Dein Reich komme!“ nicht in Einklang bringen. Ende 1893 stellte Christoph die Predigttätigkeit im Kurhaus für einige Zeit ein. 1898 wurde zudem die ständige seelsorgerliche Inanspruchnahme durch ein Herzleiden in Frage gestellt.
An der Gültigkeit der Möttlinger Erfahrungen hielt er fest. Seine Kritik traf jedoch nicht nur den Heilungsegoismus, sondern auch die Stellung seines Vaters zu Mission und Kirche. Deren Bedeutung für das Reich Gottes konnte Christoph Blumhardt nicht mehr sehen.
Die mit Kolonialismus einhergehende Mission seiner Zeit war ihm ein Dorn im Auge. Seine Überzeugung, man müsse auf dem Missionsfeld von der Vorstellung des „armen Heiden“ wegkommen, vielmehr mit den Menschen auf Augenhöhe verkehren, gab dem Missionsverständnis einen wichtigen Impuls. Dabei ging er jedoch so weit, Mission und Taufe selbst in Frage zu stellen. Die Menschen sollen, so meinte er, vom neuen Geist Christi beseelt werden; dieser komme aber „nicht aus äußerer Taufe“. Die Sakramente seien „kein Gemeinschaftsleim“, sondern machten nur „lüstern nach mehr und noch intensiveren Hypnosen“ (Christoph Blumhardt an Richard Wilhelm, 26.4.1902; in: Christus in der Welt, 82 f.).
Auch die Bedeutung der Kirche für das Reich Gottes wurde ihm fraglich. Wiederum ging es um die Kirche seiner Zeit, die sich in der sozialen Frage auf das Verbinden von Wunden beschränkte (Wicherns Innere Mission), aber nicht die Machtfrage stellte. 1899 wurde Christoph Blumhardts Eintreten für den Sozialismus von der Stuttgarter Kirchenleitung mit der Aufforderung beantwortet, den Pfarrertitel abzulegen. Dem kam er nach und schied aus dem Dienst der Württembergischen Landeskirche aus.
Äußerer Anlass war für ihn die sogenannte „Zuchthausvorlage“ im Berliner Reichstag. Arbeiter, welche arbeitswillige Kollegen beim Betreten des Betriebs behindern, wurden mit Zuchthaus bedroht. In einer sozialdemokratischen Versammlung in Göppingen stellte Christoph Blumhardt klar, dass er eine Parteinahme für die Niedrigen als Nachfolge Jesu ansah, der so betrachtet auch ein Sozialist gewesen sei. Das „Antwortschreiben an seine Freunde“ bekannte sich zur Gleichachtung aller Menschen, auch der Proletarier, die „auf Erden nicht nur geplagte, sondern selige Geschöpfe Gottes sein sollen“. Im Jahr 1900 trat er in die SPD ein; im Wahlkreis Göppingen wählte man ihn mit großer Mehrheit in den württembergischen Landtag.
In der SPD erkannte er gelebte Nachfolge Christi; zugleich versuchte er, die Partei im Geist des Evangeliums zu beeinflussen. Damit wurde Christoph Blumhardt zu einem der Väter des Religiösen Sozialismus. Der kapitalistischen „Herrschaftsmoral“ setzte er eine „Gemeinschaftsmoral“ entgegen, die zur gemeinschaftlichen Verwaltung der Produktionsmittel führen sollte. Die Forderungen blieben im Grundsätzlichen, weil historische Erfahrungen mit Kommunismus und Stalinismus auf der einen Seite und mit Sozialer Marktwirtschaft auf der andern noch fehlten. Dennoch wurde Blumhardts Profil sichtbar, der – bei deutlicher Wahrnehmung des Klassengegensatzes - den Klassenkampf in Form einer gewaltsamen Machtergreifung des Proletariats ablehnte: „Da steht Trotz gegen Trotz, und es schweigt der höhere Ton des Reiches Gottes.“ Ungeachtet harter Auseinandersetzungen sah er den Sozialismus angetrieben durch die versöhnenden Kräfte des Reiches Gottes. Die grundsätzliche Ausrichtung des politischen Handelns auf den kommenden Christus, der zudem als der eigentlich Handelnde gesehen wurde, war ihm wichtig. Sein Briefwechsel mit dem Schweizer Pfarrer Howard Eugster-Züst macht es ganz deutlich: „Es wird schließlich Gottes Reich heißen, nicht sozialdemokratisches Reich.“ Damit geriet er in Konflikt mit seiner Partei.
Karl Barth, der das theologische Denken bis heute entscheidend geprägt hat, lernte als Student Christoph Blumhardt in Bad Boll kennen. Die Einsicht, dass das kommende Gottesreich nicht ohne weiteres mit menschlichem Fortschrittshandeln identisch ist, taucht in Barths Dialektischer Theologie wieder auf. Einfluss übte Blumhardt auch auf Eduard Thurneysen, Hermann Kutter und Leonhard Ragaz. Sozialdemokratische Persönlichkeiten wie Clara Zetkin besuchten Bad Boll; August Bebel schrieb anerkennende Worte.
Nach dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landtag erkrankte Christoph Blumhardt 1906 auf einer Palästinareise an Malaria. Er zog sich nach Jebenhausen ins Haus Wieseneck zurück, hielt aber weiter Predigten im nahen Bad Boll. Frühzeitig warnte er vor dem drohenden Weltkrieg. Nach einem Herzanfall 1911 übernahm Eugen Jäckh einen Teil der Predigten. 1917 machte ein Schlaganfall den endgültigen Rückzug in die Stille notwendig.
Die Besitzverhältnisse des Kurhauses wurden neu geregelt. Bislang im Besitz der Familie Blumhardt, wobei Christoph Blumhardt als Generalbevollmächtigter der Vermögensgemeinschaft vorstand, wurde 1913 die Bad Boll GmbH gegründet. Als Geschäftsführer berief man den Basler Theologen Samuel Preiswerk, der zugleich die Funktion des Hausvaters übernahm; sein Nachfolger wurde Blumhardts Schwiegersohn Eduard Vopelius. Nach Christoph Blumhardts Tod 1919 beschloss der engere Freundeskreis, dem auch die Weggefährtin Anna von Sprewitz angehörte, die Herrnhuter Brüdergemeine zu bitten, Bad Boll als Geschenk zu übernehmen und im Blumhardtschen Sinne weiterzuführen.
Die alte Gewohnheit, Johann Christoph Blumhardt in kirchlich-„konservativen“ Kreisen, Christoph Blumhardt dagegen in kirchenpolitisch „progressiven“ Gruppen – jeweils auf Kosten des andern – wertzuschätzen, ist mit den Ergebnissen der Forschung nicht zu vereinbaren. Beide Blumhardt verbinden auf ihre Weise Erwecklichkeit mit gesellschaftlichem Handeln. Der Vater legt den Akzent auf die Individualseelsorge, beschränkt sich aber nicht darauf, sondern wirkt auch als Wirtschaftsförderer und Synodaler. Der Sohn predigt nicht nur gegen ungerechte gesellschaftliche Strukturen. Auch er ist Individualseelsorger; auch bei ihm kommt es zu Gebetsheilungen seelisch und körperlich Leidender.
Erstabdruck in: Württembergergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band I. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2006. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/20 (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Blumhardt, Johann Christoph
-
Von: Ising, Dieter
Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)
-
Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nachlass Jäckh
Johann Christoph Blumhardt wurde 1805 in Stuttgart als Kind armer Leute geboren. Nach dem Besuch des Stuttgarter Gymnasiums und des Niederen Seminars Schöntal studierte er von 1824–1829 evangelische Theologie an Universität und Stift Tübingen. Nach dem Vikariat in Dürrmenz 1829/1830 wurde er Lehrer an der Missionsschule in Basel, wechselte 1837 als Pfarrgehilfe nach Iptingen und erhielt 1838 seine erste Pfarrstelle in Möttlingen. Dort erlebten er und seine Frau Doris geb. Köllner die Heilung der Gottliebin Dittus, die Erweckung des Dorfes und Heilungen zahlreicher seelischer und körperlicher Leiden. In Möttlingen entwickelte er die Anfänge seiner Theologie der Hoffnung, bevor er 1852 in Bad Boll ein Seelsorgezentrum gründete. Seine Erlebnisse und Hoffnungsgedanken machte er unter den internationalen Gästen Bad Bolls, auf zahlreichen Reisen und in einer Anzahl von Veröffentlichungen publik. Der unlängst erschienene Briefwechsel Johann Christoph Blumhardts (ca. 3.900 Dokumente) gibt darüber hinaus neue Einblicke in sein Leben und Werk.
Wir begegnen hier einem Theologen, der Gottes Zukunft eine zentrale Bedeutung zuweist und darüber hinaus vom Schon-jetzt des Erhofften sprechen kann. Er steht in einer Linie, die sich von Philipp Jakob Speners „Hoffnung besserer Zeiten" durch die Theologiegeschichte zieht und etwa bei Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger und Philipp Matthäus Hahn auf unterschiedliche Weise sichtbar wird. Bei Johann Christoph Blumhardt kulminiert sie in einer lebendigen Naherwartung, in einem radikalen Ernstnehmen der göttlichen Verheißungen, einem ökumenischen Denken, einer ganzheitlichen Seelsorge.
Es beginnt mit den rätselhaften Ereignissen um Gottliebin Dittus, eine junge Frau aus seiner Möttlinger Gemeinde. Sie haben Blumhardt unter aufgeklärten Zeitgenossen den Ruf eines Teufelsaustreibers eingebracht. Die anschließende Erweckung seiner Gemeinde glauben manche mit Hilfe psychoanalytischer Kategorien in den Griff zu bekommen. Damit verbundene Heilungen seelischer und körperlicher Erkrankungen haben ihn zudem als Wunderheiler erscheinen lassen.
Ein Blick auf die historischen Quellen ist angebracht. Die veröffentlichten Schriften und Briefe Blumhardts zeigen, dass es ihm um ein geistliches Neuwerden geht, um den oft schmerzlichen und dann befreienden Prozess der Selbsterkenntnis und Buße, das Ablegen frommer Halbheiten, die Bereitschaft, das Leben ohne Rückhalt nach dem Wort Gottes zu gestalten. Er gebraucht dafür das Wort „Bekehrung", setzt sich aber scharf ab von einem erzwingerischen Verständnis, das den Geschenkcharakter des Neuanfangs vergisst.
So drängt er nicht, sondern wartet, bis man zu ihm kommt. Und die ganze Möttlinger Gemeinde kommt, erschüttert von dem, was mit Gottliebin Dittus vorgegangen ist. In Blumhardts Amtszimmer können die Menschen reden, erzählen von sexuellen Problemen, von Alkoholismus, von Betrügereien. Was diese Situation von der des therapeutisches Gesprächs unterscheidet, ist das gemeinsame Gebet. Man steht vor Gott; er ist der Hörende und Antwortende, Blumhardt nur der Vermittler.
Die Antwort fällt entsprechend aus. Die Möttlinger machen nicht den Eindruck, sich bloß etwas von der Seele geredet zu haben. Im Ort weht eine andere Luft; aus freien Stücken trifft man sich in Gebetskreisen. Die Dokumente aus dieser Zeit geben nicht den Eindruck säuerlicher Frömmigkeit, auch nicht den eines schwärmerischen Enthusiasmus. Man achtet auf geistliche Nüchternheit; kein Strohfeuer soll es werden, sondern eine Gemeinde, von der etwas ausstrahlt.
Es kommt zu Heilungen seelischer, aber auch körperlicher Krankheiten. Anfangs ist Blumhardt selbst überrascht, dann versteht er dies genauso wie die Erweckung als Geschenk Gottes. Ihr gegenüber ist Heilung sekundär, eine zusätzliche Gabe, die sich ebenfalls nicht erzwingen lässt. In den Berichten kommen Beteiligte und Zuschauer, nicht nur Blumhardt, zu Wort. Da ist von Zwangsvorstellungen die Rede, von Magenbeschwerden, aber auch von Gliederweh, Unterleibskrankheiten, Sehbehinderungen. Epileptiker erzählen von Blumhardts Gebet und dem erschütternden Eindruck der Gegenwart Gottes; einige von ihnen sind darauf jahrelang anfallsfrei.
Als Menschen des 21. Jahrhunderts haben wir das Recht, hier nachzufragen. In der Tat kommt Bekanntes ins Spiel wie etwa Autosuggestion, die feste Überzeugung, bei Blumhardt geheilt zu werden. Verschüttete Energien werden mobilisiert. Die Einfühlsamkeit des Seelsorgers und seine pädagogische Begabung tun ein Übriges. Dennoch lässt sich der deutliche Eindruck nicht verwischen, dass sich etwas ereignet, was sich wissenschaftlicher Deutung letztlich entzieht. Rationale Betrachtung ist notwendig, rationalistische Befangenheit dagegen überflüssig. Und so ist es ein Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit, den Horizont aufklärerischen Weltverständnisses offen zu halten. Es geht nicht gegen die Aufklärung, es geht um ihre Tiefe.
Christen reden hier vom Wirken des Heiligen Geistes, das Menschen verändert und sie dazu bringen kann, gegen gesellschaftliches Unrecht aufzustehen, für Versöhnung einzutreten, aber ihnen auch das Geschenk seelischer und leiblicher Heilung macht.
Dies alles versteht Blumhardt als Teil eines Prozesses, der auf seine eigentliche Erfüllung noch hintreibt. Nur ein Vorgeschmack kann es sein angesichts des Elends in der Welt. Auf eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes hofft er, die bald eintreten wird, so bald, dass man sie mit Händen greifen kann. Danach wird Christus sein Reich aufrichten.
Blumhardts Naherwartung hat sich nicht erfüllt. Werden Möttlingen und Bad Boll damit letztlich zu Peinlichkeiten der Kirchengeschichte? Offensichtlich ist das Kommen von Gottes Reich nicht auf einer linearen Zeitschiene zu denken. Gottes Geschichte mit den Menschen ist kein Intercityexpress, der über die Stationen „Geistausgießung" und „Christi Wiederkunft" planmäßig die heilsgeschichtliche Vollendung erreicht. Daher hat Jürgen Moltmann von „messianischen Augenblicken" gesprochen, die sich in der Geschichte ereignen. Sie sind nicht von Dauer, sondern Impulse, die neu auf Gottes Zukunft weisen, Umkehr ermöglichen, Kräfte freisetzen. Die Kräfte wirken und verlöschen wieder; neue messianische Augenblicke werden erhofft.
Was hindert daran, auch Möttlingen und Bad Boll in dieser Weise zu verstehen? Nicht als Zeugnisse einer „schönen" Vergangenheit stehen sie dann vor uns, sondern als messianischer Augenblick, der damals Zukunft eröffnet hat und dies auch heute tun kann.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Friedrich Zündel: Pfarrer Johann Christoph Blumhardt. Ein Lebensbild. Zürich und Heilbronn 11880, 51887 (engl.: Pastor Johann Christoph Blumhardt. An Account of His Life. Edited by Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore, translated by Hugo Brinkmann. Blumhardt Series, 1. Eugene/Oregon 2010)
Dieter Ising: Johann Christoph Blumhardt. Leben und Werk. Göttingen 2002, 2. Aufl. St. Goar 2017 (engl.: Johann Christoph Blumhardt. Life and Work. A New Biography. Translated by Monty Ledford. Eugene/Oregon 2009).
Johann Christoph Blumhardt: Krankheit und Heilung an Leib und Seele. Auszüge aus Briefen, Tagebüchern und Schriften, hg. von Dieter Ising (Edition Pietismustexte, Bd. 6). Leipzig 2014, 2. Aufl. 2016.
Beitrag von Dieter Ising auf Kirchengeschichte Online zum Verhältnis Vater und Sohn
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/blumhardt-johann-christoph (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Böklen, Ernst
-
Von: Butz, Andreas
Inhaltsverzeichnis
Ernst Böklen (1863-1935)
1: Familienverhältnisse
V Hermann B. (30.10.1827-31.12.1903), Kaufmann. M Julie, geb. John (4.5.1827-11.4.1893). G Anna (* 1865), Gustav (* 1866), Wilhelm (* 1848). ∞ 30.9.1890 Auguste, geb. Roth (8.10.1866-9.6.1960), Tochter des Johann Georg Roth, Fabrikant in Ravensburg. K Martha (* 1891); Elisabeth (* 1893); Sophie (*1895)
2: Biographische Würdigung
-
Ernst Boeklen (1863-1936), um 1930
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 2779
Böklen wurde am 22. Juli 1863 in Stuttgart geboren. Seine besonderen Interessen galten schon in seiner Studienzeit, unter dem Einfluss seiner akademischen Lehrer Julius von Grill und Emil Kautzsch, dem Alten Testament. Die alttestamentarische Religion in ihren Zusammenhängen mit der allgemeinen Religionsgeschichte zu sehen und selbst zu erforschen, veranlasste ihn, eine zweimal, 1892 und 1894 von der Teylerschen Theologischen Gesellschaft in Haarlem gestellte Preisaufgabe über den „Einfluss des Parsismus auf das Judentum“, zu beantworten, das zweite mal mit dem Erfolg, dass ihm die silberne Medaille dieser Gesellschaft zuerkannt wurde. Einen Teil dieser Arbeit überarbeitete er und veröffentlichte sie. Bei seiner Promotion wurde diese Arbeit dann als Dissertation angenommen. Professor Wilhelm Bousset stand ihm bei dieser Umarbeitung beratend zur Seite. Richtungweisend für seine wissenschaftliche Weiterentwicklung wurde dann ab etwa 1898 seine Bekanntschaft mit den Werken von Ernst Siecke, in welchen Astronomie, Astrologie und alte Mythologien in Beziehung zu einander gesetzt werden. Vor allem der Einfluss der Wahrnehmung des zu- und abnehmenden Mondes auf den Menschen und als Mondkalender für seine Orientierung in der Zeit sieht B. immer wieder als Schlüssel für die Deutung der Mythen an, und er versucht dies durch die Vergleichung der Mythenstoffe der unterschiedlichen Völker zu belegen. Durch diesen Anstoß gelangte er zu einem ganz neuen Verständnis des Alten Testaments. Die erste Frucht seiner durch Siecke gewonnenen Anschauungsweise war seine Abhandlung über die Sintflutsage. Wenige Jahre später schloss sich der als liberal geltende Pfarrer mit Siecke und ähnlich gerichteten Forschern wie Lessmann, Hüsing, Ehrenreich und anderen zu der Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung zusammen, die sich aber nach nur kurzem Bestehen während des Kriegs und infolge dessen wieder auflöste. Die Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung vertrat den Standpunkt, dass die Mythen vermutlich durchweg, zum mindesten ganz überwiegend, die Schicksale der Himmelskörper behandelten, und es seien zunächst und im engeren Sinne, Erzählungen dieser Art, welche im Verständnis dieser Gesellschaft unter einem Mythos verstanden wurden.
Einen etwas anderen Ansatz verfolgte B. mit seinen beiden Sneewitchenstudien, wo er das Märchen in eine Motivreihe zerlegt, welche er in zahlreichen anderen Märchen wieder findet. Diese seien nur Varianten dieses besonderen Märchentyps, für den er jedoch keine Deutung liefert. Seine Arbeit über die „Unglückszahl 13“, welche bezeichnenderweise 1913 erschien, vergleicht das Vorkommen dieser Zahl in den Mythen, und leitet die Bewertung dieser Zahl aus dem Mondkalender ab.
Die sich ihm mehr und mehr aufdrängende Überzeugung von dem innigen Zusammenhang zwischen Mythos und Sprache und den ähnlichen Bedingungen ihrer beiderseitigen Entstehung veranlasste ihn, seine Anschauungen hierüber in dem Buch über „Die Entstehung der Sprache im Lichte des Mythos“ vorzulegen. Bei der Entstehung der Sprache habe die naive Wahrnehmung des zu- und abnehmenden Mondes eine Schlüsselrolle gespielt, indem der Ursprung des Sprechens das Nachahmen der Mondphasen gewesen sei, was er durch die vergleichende Untersuchung von Mythen zu stützen sucht.
Seinen Ruhestand verbrachte B. in seinem als Alterssitz erworbenen Häuschen in Murrhardt, wo auch seine Tochter Sophie lebte. Dort konnte er sich weiterhin mit seinen Studien beschäftigten. Für die Murrhardter Zeitung schrieb er in
größeren Abständen ortskundliche Artikel. B. verstarb am 21. Mai 1935 durch einen plötzlichen Schlaganfall während eines Besuches bei der Familie seiner Tochter, die mit ihrem Mann, dem Sägewerksdirektor Rudolf Sigel in Villach in Kärnten lebte. B. war zur Konfirmation seines jüngsten Enkelkindes angereist.
Die unveröffentlichten Manuskripte einiger weiterer Arbeiten des Mythenforschers gingen an die Württembergische Landesbibliothek. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Neuen Testaments, so den Gleichnissen Jesu, seiner Auferstehung und Passion, seiner „Wahl zum König“. Aber auch eine Untersuchung über das Brautwerbermärchen im Alten und im Neuen Testament findet sich unter diesen Arbeiten. Auch hier versuchte er, die Inhalte durch systematisches Vergleichen in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Schwäbischer Merkur 1936, Nr. 120
Hermann Ehmer/Hansjörg Kammerer, Biographisches Handbuch der Württembergischen Landessynode, 2005, 98
Quellen:
LKAS, A 127, 380
WLB, Cod.hist.oct.226
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/boklen-ernst (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Brenz, Johannes
-
Inhaltsverzeichnis
1: Lebensdaten
Johannes Brenz (1499-1570)
1.1: Eltern
Johannes Brenz erblickte am 24. Juni 1499 als ältester Sohn von Johannes Hess, genannt Brenz, und Katharina Henig in der Freien Reichsstadt Weil der Stadt das Licht der Welt. Der Vater war 24 Jahre lang Vorsitzender des Stadtgerichts („Schultheiß“), die Mutter stammte aus Enzvaihingen. Wahrscheinlich hatte er drei jüngere Brüder.
1.2: Ausbildung
Nach den ersten Schuljahren in Weil der Stadt wurde Brenz im Jahr 1510 auf die Lateinschule in Heidelberg geschickt, schon 1511 wechselte er nach Vaihingen an der Enz. Am 13. Oktober 1514 schrieb er sich an der Universität Heidelberg zum Studium der Freien Künste („Artes liberales“), einer Art Grundstudium, ein. Dabei widmete er sich insbesondere den antiken Sprachen, unter anderem wurde er von Johannes Oekolampad im Griechischen unterrichtet. 1518 legte er die Magisterprüfung ab. In dem daran anschließend begonnenen Theologiestudium erlangte er hingegen keinen Abschluss. Neben Oekolampad lernte er in Heidelberg Martin Bucer, Theobald Billicanus und weitere Repräsentanten der späteren reformatorischen Bewegung kennen. Prägend war für ihn die Begegnung mit Luther, der am 26. April 1518 in Heidelberg über die Kreuzestheologie disputierte („Heidelberger Disputation“).
1.3: Beruflicher Werdegang
-
Johannes Brenz (1499-1570), Holzschnitt
Gemeinfrei
1522 übernahm Brenz die Stelle eines Prädikanten in der Freien Reichsstadt Schwäbisch Hall; schon bald begann er, im reformatorischen Sinne zu predigen. Im folgenden Jahr empfing er gleichwohl noch die Priesterweihe in seiner Heimatstadt. Als Berater nahm er an zahlreichen Versammlungen teil, unter anderem für Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach am Augsburger Reichstag im Jahr 1530. 1548 musste der die Stadt als Gegner des kaiserlichen Religionsgesetzes („Interim“) verlassen. Unter dem Schutz des württembergischen Herzogs lebte er verborgen an verschiedenen Orten. Mehrere Berufungen ins Ausland schlug er aus. Ab 1550 war er als Berater des auf seinen Vater folgenden Herzogs Christoph tätig. Er konnte aber erst 1554 offiziell in dessen Dienst treten: als Propst und herzoglicher Rat für Kirchenfragen. Bis zu seinem Tod am 11. September 1570 füllte er die Stelle aus, die nicht nur mit zahlreichen Reisen durch das Land und Gesandtschaften ins Ausland, sondern auch mit dem regelmäßigen Predigtdienst an der Stiftskirche verbunden war.
1.4: Familie
Brenz war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit der verwitweten Margarete, Tochter des Haller Ratsherrn Kaspar Gräter, gingen sechs Kinder hervor. Nachdem Margarete im November 1548 verstorben war, heiratete er eine Nichte seines Haller Freundes und Kollegen Johann Isenmann, Katharina, geb. Isenmann. Sie gebar ihm 13 Kinder. 13 der 19 Kinder überlebten ihn und hinterließen eine große Nachkommenschaft, zu der bekannte Persönlichkeiten wie die Theologen Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger und Dietrich Bonhoeffer, der Philosoph Hegel, die Dichter Uhland und Hesse sowie die Familie von Weizsäcker gehört.
2: Biographische Würdigung
Nachdem sich Brenz bereits in Heidelberg der reformatorischen Lehre zugewandt hatte, trat er in Schwäbisch Hall offen als Anhänger Luthers auf und wurde zum Reformator der Reichsstadt. Im Bauernkrieg 1525 zeichnet er sich durch eine milde Haltung gegenüber den Aufständischen aus. Seine behutsamen Schritte, die Stadt der Reformation zuzuführen, gipfelten 1527 in dem Entwurf einer Kirchenordnung, die allerdings nur teilweise in Kraft trat. Von großer Bedeutung sind Brenz‘ Katechismen: Der 1528 erschienene ist einer der ersten evangelischen Katechismen überhaupt. Wirksamer wurde jedoch sein zweiter, 1535 veröffentlichter Katechismus. Er wurde schließlich Teil der württembergischen Kirchenordnung und – z.T. in Kombination mit Luthers Katechismus – viele Jahrhunderte als Lehrbuch verwendet. Auch über die Grenzen Halls hinaus war Brenz tätig: Im Abendmahlsstreit trat er früh auf die Seite Luthers. Seit 1528 beriet er Markgraf von Brandenburg-Ansbach; 1529 nahm er am Marburger Religionsgespräch und 1530 am Augsburger Reichstag teil. Außerdem wirkte er seit 1535 bei der Einführung der Reformation in Württemberg mit. Nachdem die Evangelischen im Schmalkaldischen Krieg besiegt worden waren, widersetzte er sich dem Versuch Kaiser Karls V., mit Hilfe eines Religionsgesetzes („Interim“) die religiöse Einheit im Reich wiederherzustellen, die mit der Aufgabe des größten Teils der reformatorischen Errungenschaften verbunden gewesen wäre. Er floh vor den kaiserlichen Truppen und lebte mehrere Jahre an unterschiedlichen Orten, wobei er sich weiterhin als theologischer Schriftsteller und Gutachter betätigte.
1550 übernahm Herzog Christoph die Regierung. Als Beleg für seine reformatorische Gesinnung kann das Württembergische Bekenntnis gelten, das, von Brenz verfasst, 1553 dem Konzil von Trient vorgelegt wurde. Eine ausführliche Verteidigung des Bekenntnisses aus Brenz‘ Feder, die „Apologie“, wurde zur theologischen Grundlage für die nach 1552 erneuerte evangelische Kirche im Herzogtum. 1553 rief ihn der Herzog nach Stuttgart, seit dem 24. September 1554 trug er offiziell den Titel des Propstes an der Stiftskirche. Konsequent ging er an den Aufbau der Kirche. Es entstanden zahlreiche Ordnungen, die 1559 in der Großen Württembergischen Kirchenordnung zusammengefasst wurden. Vor allem aber war Brenz als Schriftausleger tätig: Seine Predigten und Bibelkommentare wurden für viele Generationen zum Vorbild und beeinflussten nicht zuletzt den württembergischen Pietismus (vgl. J.A. Bengel).
Theologisch blieb Brenz zeitlebens Schüler Luthers. Die Bindung an die Schrift und die Zentralstellung der Rechtfertigungslehre kennzeichnen seine Lehre. Kompromisslos für die wahre Lehre eintretend, war Brenz gleichwohl zurückhaltend im gewaltsamen Vorgehen gegen Täufer und bei der Verdammung andersdenkender Evangelischer. In den Auseinandersetzungen nach Luthers Tod beschwor Brenz, der neben Melanchthon die größte Autorität im lutherischen Lager hatte, die Einheit des Luthertums im Gegenüber zum wieder erstarkenden römischen Katholizismus. Durch Brenz erhielt Württemberg eine eindeutig lutherische Prägung. Als sich in den 1550er Jahren Calvins Abendmahlslehre auszubreiten begann, trat Brenz vehement für Luthers Ansichten ein, wodurch er in Gegensatz zu Melanchthon geriet. Anknüpfend an Luther behandelte er insbesondere die Frage, was die Einheit von Gott und Mensch in Christus für die Gegenwart Christi im Abendmahl bedeutet. Die großen christologischen Schriften, die in diesem Zusammenhang entstanden, wurden grundlegend für die Ausprägung einer Tübinger Theologie im 17. Jh. Brenz betont darin, dass Christus als Mensch und Gott in vollkommener Einheit der Person auch nach seiner Himmelfahrt in der Welt wirksam gegenwärtig ist.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Quellen:
Werke, hg. v. M. Brecht/G. Schäfer, Bd. 1ff., Tübingen 1970ff
Confessio Virtembergica, hg. v. M. Brecht/H. Ehmer, Holzgerlingen 1999.
Literatur:
J. Baur, Johannes Brenz. Ein schwäbischer Meisterdenker auf den Spuren Luthers, in: Ders., Lutherische Gestalten – heterodoxe Orthodoxien, Tübingen 2010, 18–46
H. Chr. Brandy, Die späte Christologie des Johannes Brenz, BHTh 80, Tübingen 1991
M. Brecht, Die frühe Theologie des Johannes Brenz, BHTh 36, Tübingen 1966
M.A. Deuschle, Brenz als Kontroverstheologe. Die Apologie der Confessio Virtembergica und die Auseinandersetzung zwischen Johannes Brenz und Pedro de Soto, BHTh 138, Tübingen 2006
I. Fehle (Hg.), Johannes Brenz 1499–1570, Schwäbisch Hall 1999.
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/brenz-johannes (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Brastberger, Immanuel Gottlob
Immanuel Gottlob Brastberger (1716-1764)
-
Immanuel Gottlob Brastberger
gemeinfrei (Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart)
Der Schüler Bengels und Nürtinger Dekan verfasste eine Predigtsammlung im Geist des Pietismus, die zu den am weitesten verbreiteten Büchern des 19. Jahrhunderts gehörte.
Immanuel Gottlob Brastberger wurde als Dekanssohn am 10. April 1716 in Sulz am Neckar geboren. Nach dem Theologiestudium im Tübinger Stift, wo er Friedrich Christoph Oetinger als Repetent erlebte, zog er als Garnisonspfarrer in die gerade aufgebaute neue Residenzstadt Ludwigsburg. Die barocke Pracht war dem Pietisten ein Dorn im Auge. Schwere Krankheit prägte sein Leben und seinen Glauben. 1745 kam Brastberger als Pfarrer nach Oberesslingen. 1756 wurde er Dekan in Nürtingen und damit an der Kirche, an der sein Lehrer Johann Albrecht Bengel einst Vikar gewesen war. Im Jahr seines Aufzugs hielt Brastberger eine aufsehenerregende Predigt zum Gedenken an den verheerenden Stadtbrand von 1750, in der er die Katastrophe als Gericht Gottes deutete. Als Bibelwort wählte er seltsamerweise das Jesus-Wort von dem, der gekommen ist, „ein Feuer anzuzünden“ (Lukas 12,49). Er hielt eine Erbauungsstunde, zu der über 70 Menschen strömten, obwohl nach dem Pietisten-Rescript von 1743 nur 15 erlaubt waren. Von Krankheit gezeichnet starb er mit nur 48 Jahren.
Ein Buch geht um die Welt
Berühmtheit erlangte Brastberger als Verfasser einer Predigtsammlung, die in vielen schwäbischen Häusern zu den Andachtsbüchern gehörte, aus denen bei der Hausandacht vorgelesen wurde. Dazu wurde das Werk „Evangelische Zeugnisse der Wahrheit“ (1. Aufl. 1758) durch die Auswanderer auch in der ganzen Welt verbreitet. Das Buch verband sie mit der schwäbischen und mit der ewigen Heimat. Es erreichte neben der Bibel und dem Koran die höchsten Auflagen des 18. und 19. Jahrhunderts und ist 1883 schon in 85. Auflage erschienen, samt Kommissionsausgaben in Amerika und Russland. Es enthält 92 Predigten nach dem Kirchenjahr, in einfacher Sprache verfasst. Brastberger schilderte seine Absicht im Vorwort: „Mir war es darum zu tun, die Seelen nur aufzumuntern, daß sie die elenden Sandgebäude eines landläufigen, bodenlosen Christentums niederreißen, und den Grund zu einem wahren, tätigen, Gott gefälligen Christentum durch die Gnade in sich legen lassen.“
Nach einem Gottesdienst in der Nürtinger Stadtkirche brachte mir einmal ein älteres Ehepaar „seinen“ Brastberger – eine Ausgabe aus St. Petersburg, die ihre Vorfahren einst mitgenommen, die sie selbst als Russlanddeutsche in Ehren gehalten und schließlich wieder mitgebracht hatten. Was für eine Reise des Brastberger‘schen Predigtbuchs, einer Art „portativer Heimat“ (Heinrich Heine)!
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/brastberger-immanuel-gottlob (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Canz, Wilhelmine
-
Von: Kittel, Andrea
Wilhelmine Canz (1815-1901)
-
Wilhelmine Canz
Quelle: Großheppacher Schwesternschaft
1856 gründete Wilhelmine Canz in Großheppach im Remstal die erste Bildungsanstalt für evangelische Kleinkinderpflegerinnen in Württemberg. Die „Großheppacher Schwesternschaft“ residiert mittlerweile in Beutelsbach und umfasst neben dem Mutterhaus eine evangelische Fachschule für Sozialpädagogik, eine evangelische Fachschule für Altenpflege, ein Wohn- und Pflegestift sowie ein Kinder- und ein Gästehaus.
Am 27. Februar 1815 wurde Wilhelmine Canz in Hornberg im Schwarzwald geboren. Schon in jungen Jahren setzte sie sich mit Grundfragen des Glaubens auseinander. Durch ihren Bruder, einen Theologen, hatte sie die spannungsgeladene Auseinandersetzung zwischen hegel‘schem Idealismus und biblischem Glauben mitverfolgt. 1843 begann die damals 28-Jährige an ihrem Roman „Eritis sicut Deus“ („Ihr werdet sein wie Gott“) zu arbeiten, den sie 1852 zunächst anonym veröffentlichte. Das Buch, eine Erwiderung auf David Friedrich Strauß‘ „Das Leben Jesu“, war heftig umstritten. Im Kreuzfeuer der Kritik zu stehen galt für Frauen in der damaligen Zeit als nicht angemessen. Wie viele ihrer Geschlechtsgenossinnen fand Wilhelmine Canz schließlich ihr eigentliches Betätigungsfeld in der Diakonie.
Im Jahr 1856 gründete sie in Großheppach im Remstal die erste Bildungsanstalt für evangelische Kleinkinderpflegerinnen in Württemberg. Dass die Kleinkinderbetreuung auf professionelle Füße gestellt werden musste, hatte sie bei Regine Jolberg gesehen, die einige Jahre zuvor eine entsprechende Ausbildungsstätte im badischen Nonnenweiler eröffnet hatte. Doch einfach sollte für Wilhelmine Canz auch dieses Projekt nicht werden. In kirchlichen Kreisen stand man ihrem Vorhaben skeptisch gegenüber. In der Verwandtschaft erntete sie Hohn und Spott, und bei Damenkaffees lachte man über ihre Idee, kostenlos Kinder von Bauernweibern zu hüten und einfache Mägde zu Erzieherinnen heranbilden zu wollen.
Der Erfolg gab Wilhelmine Canz am Ende recht: Die Bildungsanstalt konnte beständig ausgebaut werden. An lernwilligen jungen Frauen gab es keinen Mangel. Die ausgebildeten Kleinkinderpflegerinnen wurden in einer Schwesternschaft nach genossenschaftlichem Prinzip organisiert und in die überall neu entstehenden „Kleinkinderpflegen“ gesandt. Nach den damals neuesten pädagogischen Erkenntnissen wurden die Kinder dort betreut, erzogen und gefördert. Notwendige Anerkennung erfuhr die Großheppacher Einrichtung durch Königin Olga, die 1870 höchstpersönlich zu Besuch kam und Wilhelmine Canz später mit dem Olga-Orden ehrte.
41 Jahre lang führte Wilhelmine Canz die Bildungsanstalt bis zu ihrem Ruhestand 1897. Als „Mutter Canz“ am 15. Januar 1901 starb, zählten 349 Schwestern zur „Großheppacher Schwesternschaft“. Heute residiert das Werk in Beutelsbach und umfasst neben dem Mutterhaus eine evangelische Fachschule für Sozialpädagogik, eine evangelische Fachschule für Altenpflege, ein Wohn- und Pflegestift sowie ein Kinder- und ein Gästehaus.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/canz-wilhelmine (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Christaller, Johann Gottlieb
-
Von: Quack, Jürgen
Johann Gottlieb Christaller (1827-1895)
-
Archiv der Basler Mission, QS-30.006.0256.01. Foto:Hermann Brandseph, Stuttgart
Es war keine leichte Aufgabe, die dem jungen Johann Gottlieb Christaller anvertraut wurde: Er sollte eine afrikanische Sprache erforschen, die bisher keine Schrift besaß, sollte ein Wörterbuch und eine Grammatik, dazu Schulbücher und eine Bibelübersetzung anfertigen. Nur eines war schon deutlich: diese Sprache besaß viel mehr Töne als das deutsche Alphabeth Buchstaben besaß.
Christaller wurde 1827 im württembergischen Winnenden geboren und wuchs nach dem frühen Tod des Vaters in Armut auf. Er lernte den Beruf des Schreibers, also eines Verwaltungsangestellten im örtlichen Rathaus. Durch den Besuch der Missionsstunden des Pfarrers motiviert, meldete er sich in Basel für die Ausbildung zum Missionar. Schon früh wurde dort seine große Sprachbegabung erkannt. Daher wurde er 1852 mit dem Auftrag ausgesandt, die Sprache der Region um Akropong auf der Goldküste im heutigen Ghana zu erforschen. Diese war bisher unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt: Otschi, Otji, Otsui, Chee, Tshi oder Tyi.
-
Archiv der Basler Mission, D 30.64.154.
Christaller suchte den Kontakt mit den Menschen und war fasziniert. Er kam geradezu ins Schwärmen, wenn er die Vorzüge der afrikanischen Sprachen schilderte: sie seien reich an malerischen Wortformen und Ausdrücken „und wem erst der Sinn für den beständigen Wechsel der hohen und tiefen Töne in größeren und geringeren Abständen mit allerlei Zwischenstufen aufgegangen ist, der muss diesen Sprachgesang anmutig und seelenvoll finden.“ Begeistert berichtete er nach Basel, er sei dabei, die „Früchte, Blüten, Laub und Zweige des Bäumchens der Otschi-Sprache“ kennenzulernen und in eine systematische Ordnung zu bringen. Dabei entdeckte er die Bedeutung der unterschiedlichen Tonhöhen: „Begonnen wird meist in höheren Tönen, dann hüpft und fließt und bewegt sich der Strom der Rede wellenförmig mit hohen oder tiefen Schlusssilben (…).“(1) In enger Zusammenarbeit mit seinen einheimischen „Sprachgehilfen“ verstand er es, die vielschichtigen Bedeutungshorizonte zu entschlüsseln und in geschriebenes Wort zu übertragen. Um die unterschiedlichen Töne und die Tonhöhe schriftlich festzuhalten, schuf er ein System von 39 Vokalzeichen.
Neben der Arbeit an der Sprache um Akropong, die heute Twi genannt wird, untersuchte er mit Unterstützung einheimischer Mitarbeiter auch zahlreiche andere afrikanische Sprachen und Dialekte.(2) Seine Mitarbeiter stammten aus der ersten Generation einheimischer Christen, die, ausgebildet in den Basler Missionsschulen, selbst unterrichtend, evangelistisch und schreibend tätig waren. Es gelang diesem interkulturellen Team nicht nur Sprachen zu verschriftlichen, sondern auch spezifische, kulturell verortete Ausdrucksweisen zu übersetzen und die Grundlagen für eine Twi-Literatur zu schaffen. Ihr Beitrag zu Bildung, Sprache und Kultur ebnete den Weg zu einer selbständigen Kirche in Ghana.
Wegen seiner schwachen Gesundheit kehrte Christaller mit seiner Familie 1868 nach Deutschland zurück und ließ sich in Schorndorf nieder. Seine Sprachstudien führte er zeitlebens fort. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen gab er seit 1883 die erste ghanaische Zeitschrift in den Sprachen Twi und Ga (heute: „Christian Messenger“) heraus – selbstverständlich gemeinsam mit seinen afrikanischen Weggefährten, die ihn immer wieder in Schorndorf besuchten.
Die mittlerweile selbständige Presbyterian Church of Ghana (PCG) schätzt Johann GottliebChristaller bis heute sehr. Als sie 1986 in Akropong ein Forschungs- und Studienzentrum zur Frage von Mission, Kultur und Sprache einrichtete, nannte sie es „Akrofi*-Christaller Memorial Centre“, heute eine kleine Universität mit Studierenden aus ganz Afrika. Der Gründungsrektor Kwame Bediako sagte über Christaller mit großem Respekt: Er ist einer unserer Ahnen geworden.“
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/christaller-johann-gottlieb (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Claß, Helmut
-
Von: Stegmann, Andreas
Helmut Claß (1913-1998)
Lebensdaten
Eltern: Helmut Claß wurde am 1. Juli 1913 als ältester Sohn von Oberreallehrer Dr. Hermann Claß und Johanne Claß (geb. Goller) in Geislingen / Steige geboren. Das Elternhaus war kirchlich geprägt; vor allem durch seine Mutter lernte Claß früh die Lebenswelt und Traditionen des württembergischen Pietismus kennen.
Ausbildung: Claß besuchte von 1919 bis 1921 die Volksschule in Geislingen-Altenstadt, von 1921 bis 1927 das Reformrealgymnasium in Geislingen und von 1927 bis 1931 das Zeppelingymnasium in Stuttgart. Im Sommersemester 1931 begann Claß das Studium der Evangelischen Theologie an der Theologischen Schule in Bethel; im Sommersemester 1932 wechselte er nach Tübingen; 1933 ging er für das Sommersemester nach Marburg; und vom Wintersemester 1933 bis zum Sommersemester 1935 schloss er in Tübingen sein Studium ab. Seine wichtigsten akademischen Lehrer waren Karl Heim, Rudolf Bultmann und – obwohl Claß nicht bei ihm studierte – Karl Barth. Neben der aktuellen theologischen Diskussion wurden für Claß im Studium auch das Luthertum und den Pietismus wichtig. Er kannte und schätze Martin Luthers Schriften und war vertraut mit den Klassikern des lutherischen und insbesondere württembergischen Pietismus von Spener bis zu den Blumhardts. Der Kirchenkampf 1933/34 war für Claß ein eindrückliches Erlebnis; von Anfang an stand er auf Seiten der Bekennenden Kirche und hielt treu zu Landesbischof Theophil Wurm.
Beruflicher Werdegang: Im Frühjahr 1936 legte Claß die Erste Theologische Dienstprüfung ab, wurde am 8. März 1936 ordiniert und absolvierte anschließend bis 1939 sein Vikariat an St. Bernhard in Esslingen, in der Evangelischen Diakonissenanstalt Schwäbisch Hall, als Pfarrverweser in Tiefenbach (Dekanat Crailsheim) und als Mitarbeiter des Evangelischen Jungmännerbunds im Soldatenheim auf dem Truppenübungsplatz Münsingen. Nachdem er im Frühjahr die Zweite Theologische Dienstprüfung erfolgreich absolviert hatte, wurde er im Juli 1939 auf die dritte Pfarrstelle an der Kilianskirche Heilbronn berufen. Von Oktober1939 bis Dezember 1947 konnte Claß wegen Kriegsdienst – Claß war Offizier der Luftnachrichtentruppe – und sowjetischer Kriegsgefangenschaft seinen pfarramtlichen Dienst nicht ausüben. 1948/49 nahm er seinen Dienst wieder auf und wurde zusätzlich Heilbronner Stadtjugendpfarrer. Von 1950 bis 1958 war Claß württembergischer Landesjugendpfarrer, von 1958 bis 1968 leitender Pfarrer der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Herrenberg und 1968/69 Prälat von Stuttgart. 1969 wurde Claß zum württembergischen Landesbischof gewählt. 1971 übernahm zusätzlich den Vorsitz im Diakonischen Rat des Diakonischen Werks und 1973 den Vorsitz des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland. Nach Erreichen des 65. Lebensjahrs schied Claß 1979 aus dem Amt des EKD-Ratsvorsitzenden und des württembergischen Landesbischof. Während seiner Ruhestandsjahre engagierte er sich aber weiterhin für die Kirche, etwa indem er bis 1986 Vorsitzender des Diakonischen Rats blieb und weitere kirchliche Ämter übernahm (z.B. das des ersten Beauftragten des Rats der EKD für den Kontakt zu den evangelischen Kommunitäten). Am 4. November 1998 starb Helmut Claß in Nagold-Pfrondorf; sein Grab befindet sich auf dem Stuttgarter Waldfriedhof.
Familie: Helmut Claß war verheiratet mit Hilde Claß (1914–2001). Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: Martin (* 1940), Christoph (* 1943), Hanna (* 1950) und Gottfried (* 1954).
Ehrungen: 1972 Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen; 1979 Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland; 1979 Ehrenritterkreuz des Johanniterordens; 1988 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg; 1993 Brenzmedaille der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Biografische Würdigung
Helmut Claß hat sich in seinem gesamten beruflichen Wirken als Pfarrer verstanden, der durch Verkündigung und Seelsorge die Menschen zum Glauben führen und im Glauben bestärken wollte. Leitend war dabei die paulinische Rede von Wort und Dienst der Versöhnung (2.Kor. 5,18–21): Die Kirche verdanke sich dem heilschaffenden Gotteswort und habe dieses Gotteswort zu bezeugen – und zwar in ihrer religiösen Verkündigung wie in ihrem diakonischen Handeln. Verkündigung und Diakonie - ,Heils- und Weltdienstʻ – hingen für Claß eng zusammen. Zusammengehalten wurden sie durch die evangelische Spiritualität, das heißt durch eine um Bibel, Gottesdienst, Sakramente und Gebet kreisende alltägliche Frömmigkeitspraxis. Die durch die evangelische Spiritualität zu Wort und Dienst der Versöhnung befähigte Kirche war nach Claß zugleich missionarisch und diakonisch – sie war ,missionarisch-diakonische Kircheʻ, wie ein Leitbegriff seiner Bischofsberichte lautet. Dieses kirchliche Programm setzte Claß in den 1950er und 1960er Jahren in der kirchlichen Basisarbeit um, als er als Landesjugendpfarrer die ländliche Jugendarbeit der Kirche neu organisierte und als leitender Pfarrer der Herrenberger Diakonieschwesternschaft die schwesternschaftliche Diakonie modernen Anforderungen anpasste. Auf beiden Arbeitsfelder erwies Claß sich als anziehender Verkündiger und Seelsorger sowie als kompetenter Organisator und Netzwerker. Auch in seiner kirchlichen Leitungstätigkeit als Prälat von Stuttgart, als württembergischer Landesbischof und als EKD-Ratsvorsitzender bemühte sich Claß um die Verwirklichung seines kirchlichen Programms. Er nutzte die Möglichkeiten, in Kirche und Öffentlichkeit für einen zugleich am biblisch-reformatorischen Christentum orientierten und für Herausforderungen der gegenwärtigen Welt evangelischen offenen Glauben zu werben. Das war angesichts der religiösen Krise der 1960er und 1970er Jahre und der die Kirche zerreißenden kirchlichen und gesellschaftlichen Konflikte nicht leicht. Die kirchlichen Organisationsreformen (z.B. die Revision der EKD-Grundordnung), die gesellschaftspolitischen Diskussionen (z.B. um den Schwangerschaftsabbruch, um das politische Engagement kirchlicher Amtsträger oder um das Verhältnis von Kirche und Staat), die ökumenischen Beziehungen (z.B. zum Ökumenischen Rat der Kirchen oder zu Kirchen auf der Südhalbkugel), der Linksextremismus (z.B. das Verhältnis der Kirche zur DKP und zur RAF), die innerkirchliche Pluralisierung (z.B. durch die organisatorische Verfestigung der Bekenntnisbewegung) oder die Kirche und Gesellschaft von unten verändernden ,neuen sozialen Bewegungenʻ (die über Basisinitiativen und Kirchentage den westdeutschen Protestantismus zu beeinflussen begannen) boten viel Konfliktstoff. Claß meisterte diese Herausforderung, weil er sich als Vermittler verstand: In seiner kirchlichen Leitungstätigkeit versuchte er die auseinanderstrebenden Lager innerhalb der Kirche zusammenzuhalten und er bemühte sich um gleichermaßen sachgerechte wie akzeptable Kompromisse.
Eine angemessene Würdigung von Claß‘ Person und Wirken ist zur Zeit nur vorläufig möglich, weil die kirchengeschichtliche Forschung die Geschichte des westdeutschen Protestantismus zwischen 1945 und 1989 und damit auch die kirchlichen Protagonisten dieser Zeit erst allmählich erschließt. Die Zeitgenossen jedenfalls haben Claß hoch geschätzt: Der Journalist Karl-Alfred Odin beispielsweise hat Helmut Claß 1979 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als „Vorbild für den evangelischen Bischof“ bezeichnet und ihm große Verdienst um die Erneuerung des westdeutschen Protestantismus durch die „Rückführung der Gemeinden zu evangelischer Spiritualität“ zugeschrieben (1). Tatsächlich gehört Claß zu einer Gruppe von kirchlichen Leitungsverantwortlichen, zu der auch der Hamburger Bischof Hans-Otto Wölber oder Hannoversche Bischof Eduard Lohse zu zählen sind, die der evangelischen Kirche der Bundesrepublik Wege aus der religiösen Krise der 1960er und 1970er Jahre gewiesen haben.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Personalakte Helmut Claß: LKAS A 327, Nr. 2284
Stegmann, Andreas: Helmut Claß und die Diakonie, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 109 (2012), S. 472–500
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/class-helmut (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Dieter, David
-
Von: Eisler, Jakob
David Dieter wurde am 13. Oktober 1863 als Sohn des Schullehrers Johann Jakob Dieter und der Katharina geb. Hiller in Schopfloch bei Kirchheim unter Teck geboren. Er besuchte zunächst die Grundschule in seinem Heimatort und dann die in Altenstadt bei Geislingen. 1872 kam er in die Lateinschule in Waiblingen, wechselte 1875 in die Lateinschule nach Schorndorf und 1876 nach Göppingen, von wo aus er im Herbst 1877 in das Seminar Maulbronn aufgenommen wurde. 1879 übersiedelte er in das Seminar Blaubeuren.
Im August 1881 bestand er die Aufnahmeprüfung für das Seminar in Tübingen, in welchem er die vier Studienjahre ohne größere Unterbrechung durchlaufen hat. Seine erste Stelle als Vikar übernahm er in Waiblingen im Hebst 1885 bis Mai 1886. Danach war er Vikar und Lehrer auf dem Tempelhof bei Crailsheim von Mai 1886 bis 1890.
Im Jahre 1890 unternahm er eine wissenschaftliche Reise nach Palästina, Syrien, Ägypten und Italien. Bei dieser Reise lernte er in Jerusalem die Tätigkeit des Syrischen Waisenhauses kennen. Diese Erziehungseinrichtung trennte sich gerade von ihrem Mutterhaus St. Chrischona und wurde selbstständig. Von Anfang an wurde neben der schulischen Ausbildung großes Gewicht auf handwerkliche Arbeit gelegt, so dass im Laufe der Zeit eine große Zahl verschiedener Werkstätten im Waisenhaus eingerichtet wurde. Somit konnten die Schüler gemäß ihren Neigungen und Begabungen einen Beruf erlernen, der ihnen ein selbstständiges Leben ermöglichte. Es handelt sich dabei um die größte Erziehungsanstalt des Orients. Johann Ludwig Schneller, der erste Leiter und Gründer der Einrichtung, forderte Pf. Dieter auf, in den Vorstand einzutreten, was David Dieter nach seiner Rückkehr nach Stuttgart tat. Dieses Amt begleitete er bis zu seinem Tod. Von Juli 1890 bis 1899 war er zweiter Geistlicher der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. 1892 heiratete er Pauline Emilie geb. Katz, beide hatten 4 Kinder.
Während seiner 9jährigen Tätigkeit bei der Inneren Mission leitete er dreieinhalb Jahre die Stuttgarter Stadtmission. Am 26. November 1899 wurde er zum Stadtpfarrer an der Friedenskirche in Stuttgart ernannt. Diese Stelle konnte er nur weniger als drei Jahre ausfüllen, da er bereits am 23. Februar 1903 an einer Lungenentzündung verstarb.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/dieter-david (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Dittus, Gottliebin
-
Von: Ising, Dieter
Gottliebin Dittus (1815-1872)
-
Gottliebin Dittus verh. Brodersen (1815-1872)
LKAS, D 50 (Blumhardt-Archiv), Bildmappe Gottliebin Dittus
Will man verstehen, was vor über 150 Jahren in Möttlingen, einem Dorf am Rande des Schwarzwaldes oberhalb von Calw, geschehen ist, empfiehlt sich zuallererst ein Blick in die Berichte eines Augenzeugen, der, in die Ereignisse wider seinen Willen hineingezogen, eine maßgebliche Rolle im Verlauf der Krankheit und schließlichen Glaubensheilung der Gottliebin Dittus (1815–1872) gespielt hat. Die Rede ist von Johann Christoph Blumhardt (1805–1880), seit 1838 in Möttlingen auf seiner ersten Pfarrstelle, später Seelsorger in Bad Boll. Man sollte seine Schilderung, die Krankheitsgeschichte der G. D. in Möttlingen, (1) auf sich wirken lassen, bevor man zu den Berichten und Deutungen anderer übergeht. Letztere, verfasst von Theologen, Medizinern, Psychotherapeuten, manchmal auch von Menschen, die sich nicht zu den „Fachleuten“ rechnen und einfach nur – positiv oder negativ – von den Möttlinger Ereignissen berührt sind, bewegen sich in dem weiten Spektrum zwischen unkritischem Nacherzählen und rationalistischer Ablehnung des Blumhardtschen Berichts. Diese Stimmen aus dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart können helfen zu ergründen, was es denn nun mit der Krankheit und Heilung der Gottliebin Dittus auf sich hat. Andererseits kann eine Prüfung der Ereignisse anhand der historischen Quellen, die den Erkenntnishorizont offenhält und sich nicht auf Vorentscheidungen festlegen lässt, Aufschluss darüber geben, was es mit den Urteilen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart auf sich hat.
Lassen wir also Blumhardt erzählen. Im April 1842 erfährt er von seltsamen Vorkommnissen in der Wohnung der besagten Gottliebin. Diese, eine junge Frau von 26 Jahren, lebt mit drei Geschwistern zusammen in einem engen Logis, dem Untergeschoss des heutigen Gottliebin-Dittus-Hauses in Möttlingen, das seit 1988 eine Ausstellung beherbergt.(2) Es herrscht drückende Armut und Traurigkeit; Vater, Mutter und mehrere Geschwister sind kurz zuvor, innerhalb weniger Jahre, gestorben. In den Jahren 1841 und 1842 werden die Bewohner von unerklärlichen Poltergeräuschen erschreckt. Eine durchsichtige Gestalt, nur von Gottliebin wahrgenommen, bittet um im Haus versteckte Papiere, die auch gefunden und als Utensilien zum Ausüben von Zauberei gedeutet werden.(3)
Ohnmachten und Krämpfe, an denen die junge Frau zu leiden hat, können vom behandelnden Arzt nicht gedeutet werden; auch Blumhardt weiß sich angesichts der bewusstlos daliegenden Frau nicht zu helfen. An einem Sonntagabend im Juni 1842 sieht er schweigend ihren heftigen Konvulsionen zu, die den ganzen Körper ergriffen haben; Schaum fließt aus dem Mund. Da überkommt es ihn; er ergreift ihre Hände, legt sie zum Beten zusammen und ruft: „Wir haben lange genug gesehen, was der Teufel tut; nun wollen wir auch sehen, was Jesus vermag.“ Das Erstaunliche geschieht: Die Kranke erwacht, spricht die betenden Worte nach; die Krämpfe hören auf.(4)
Damit sind die Weichen für Blumhardts künftiges Handeln gestellt. Für ihn handelt es sich von nun an um keine natürliche Krankheit, sondern um Angriffe des Satans; Heilmittel kann nur das Gebet sein. Blumhardt fühlt sich als Seelsorger gefordert, nicht als Rezitator exorzistischer Formeln, die Gottliebin Dittus zum Objekt degradieren würden. Er besucht sie häufig, betet mit ihr, fordert sie auch selbst zum Gebet auf und ermutigt sie zu Geduld und Glauben an den, der nach 1 Joh 3,8 gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören.
Die Ereignisse werden immer dramatischer. Der angebliche Geist, nach Gottliebins Aussage mit der früheren Erscheinung identisch, beginnt aus ihr zu reden. Nach Blumhardts Handauflegung und Gebet fährt der Geist aus und bekennt, er finde keine Ruhe; als Strafe für im Leben begangene Sünden sei er vom Satan gebunden. Die Anwesenden, außer Blumhardt noch wenige Vertraute, konstatieren in den nächsten Tagen ein „Ausfahren“ weiterer Geister, indem sie würgende Bewegungen der Kranken auf diese Weise deuten. Nun klagt sie über Brustblutungen, die ihr von Vampiren beigebracht würden; sie hat starke Schmerzen, Brandwunden; es kommt zu Selbstmordversuchen. In all dem begleitet sie Blumhardt als treuer Seelsorger. Allmählich erscheint ihm ihr Krankenlager als Schauplatz einer zentralen Auseinandersetzung zwischen dem Reich der Finsternis und der Macht des auferstandenen Christus. Die Pflicht, hier nicht klein beizugeben, sondern im Vertrauen auf göttliche Hilfe auszuharren, wird ihm von Woche zu Woche deutlicher.(5)
Blumhardts und Gottliebins Glaube wird auf eine harte Probe gestellt. Wenn es scheint, als hätte die Geschichte ihr Ende erreicht, kommt es wieder zu Rückfällen, auch zu völlig neuen Erscheinungen. Am 8. Februar 1843 sieht die junge Frau im Geiste ein schreckliches Erdbeben in Westindien, was kurz darauf durch Zeitungsberichte bestätigt wird.(6) Einen Monat darauf erbricht sie ein Messer, Nadeln und ein 3 Zoll breites Stück Eisen, alles nach Blumhardts Überzeugung in sie „hineingezaubert“. Aus ihrem Kiefer, der Herzgrube und aus dem Oberleib treten Nägel, Scherben, Knochen, Eisen, Fensterblei, verbogene Drahtstücke und anderes hervor. Wie immer sind auch hier Augenzeugen anwesend. Blumhardts Frau hilft beim Herausziehen der Gegenstände, die von Blumhardt anfangs aufbewahrt und später vernichtet werden.(7)
-
Dittus-Haus, Möttlingen
Fotograf: Werner Mast, Möttlingen
An Weihnachten 1843 treiben die Ereignisse ihrem Höhepunkt entgegen. Diesmal ist nicht Gottliebin Dittus betroffen, sondern die „Besessenheit“ überträgt sich auf ihren Bruder Hansjörg und die Schwester Katharina. Aus dieser lässt sich nach Blumhardts Schilderung ein „Dämon“ vernehmen, „der sich diesmal nicht als einen abgeschiedenen Menschengeist, sondern als einen vornehmen Satansengel ausgab, als das oberste Haupt aller Zauberei, dem vom Satan die Macht dazu erteilt worden sei und durch den dieses Höllenwerk nach den verschiedensten Seiten hin zur Förderung des satanischen Reichs sich verzweigt hätte, mit dem aber nun, da er in den Abgrund fahren müsse, der Zauberei der Todesstoß gegeben werde, an dem sie allmählich verbluten müsse.“ Aus Katharina dröhnt ein Schrei der Verzweiflung; dann brüllt es aus ihr heraus: „Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger!“ – ein Ruf, der im Dorf weithin vernommen wird. Ist es bisher gelungen, die Geschichte weitgehend vertraulich zu behandeln, tritt nun ihr siegreicher Abschluss an die Öffentlichkeit. Der Dämon verschwindet und kommt nicht wieder. „Das war der Zeitpunkt, da der zweijährige Kampf zu Ende ging.“(8)
Für Blumhardt steht die Realität der erscheinenden Geistergestalt und der Geisterstimmen nie in Frage. Selbstverständlich folgt er Gottliebins Hinweis, hier träten verstorbene, vom Teufel gebundene Personen auf. Wenn sich etwas aus ihr gegen Blumhardt richtet, sie mit drohenden Gebärden auf den betenden Seelsorger losfährt, mit fremder Stimme spricht, wenn würgende Bewegungen auftreten, konstatiert er, nicht sie selber sei die handelnde Person. Auch die aus ihr hervortretenden Gegenstände sind, so Blumhardt, in diese hineingezaubert worden. Hier wirkt sich seine Vorprägung aus, das Aufwachsen im biblischen Realismus der Stuttgarter Gemeinschaftsbewegung, die enge Verbindung mit Gottlieb Wilhelm Hoffmann, dem Gründer von Korntal, die Tübinger Vorlesungen bei Adam Karl August Eschenmayer, die Bekanntschaft mit Justinus Kerner, eine von Blumhardt miterlebte Geisteraustreibung in Basel. Überall wird an der Existenz einer Geisterwelt(9) festgehalten; man widersetzt sich der Bestreitung durch die Aufklärungstheologie.
Wie können wir heute das Geschehen um Gottliebin Dittus verstehen? Wohl nicht als Bestätigung der spiritistischen Hypothese, die Geister Verstorbener könnten herbeigerufen und befragt werden. Dagegen kann die These von Medizinern und Psychotherapeuten, das, was sich zwischen Blumhardt und Gottliebin abgespielt habe, sei in den Kategorien heutiger Psychotherapie zu verstehen, einiges Rätselhafte plausibel machen. Hier ist man sich weitgehend einig, dass Geisterstimmen und entsprechende Bewegungen von Gottliebin selbst produziert wurden, allerdings in einem tranceähnlichen Zustand. Es handle sich um eine hysterische Symptomatik, begründet im unbewussten Streben nach Zuwendung und Beachtetwerden. Blumhardt sei bereitwillig auf dieses Schauspiel eingegangen, ohne dessen wahre Bedeutung zu erkennen; dies habe die Symptome zeitweise verstärkt. Allerdings wird ihm bescheinigt, durch unerschütterliches Ausharren bei seiner „Patientin“ und das Aufzeigen einer befreienden Perspektive sich – wenn auch in den Vorstellungen seiner Zeit verhaftet – als Vorläufer der Psychotherapie erwiesen zu haben.
Nachdenkliche Vertreter dieser Auffassung machen zugleich auf deren Grenzen aufmerksam. So gibt der Psychiater Walter Schulte(10) zu bedenken, dass sich ein Teil der Erscheinungen auf diese Weise nicht erklären lässt. Die aus der Haut der Kranken hervortretenden Gegenstände können nicht von ihr selbst hineinpraktiziert worden sein, um damit Aufmerksamkeit zu erregen; hier geht die Interpretation als Hysterie ins Leere. Blumhardt betont, dass beim Austreten keine Wunde entstanden und auch zuvor keine Wunde sichtbar gewesen sei. Am Wahrheitsgehalt des Berichteten mag man zweifeln, jedoch vermittelt die Lektüre der Schriften und Briefe Blumhardts den Eindruck eines Menschen, der die Wahrheit sagen will. So kommt auch Schulte zu dem Schluss, man sei hier an der Grenze der medizinischen Deutbarkeit angelangt. Wolle man das Geschehen mit Hilfe von Massensuggestion, Selbsttäuschung, Schwindel und Zauberkunststücken vollständig erklären, würde man „einen bitteren Geschmack auf der Zunge nicht los“. So führen neue Erkenntnisse nur teilweise zur Erhellung der Möttlinger Ereignisse. Gegenüber unseren Verstehensmöglichkeiten erweist sich das Geschehen als überschüssig.
Was haben uns Krankheit und Heilung der Gottliebin Dittus heute noch zu sagen? Ein skurriler Nachhall mittelalterlicher Teufelsaustreibung, durch neue Erkenntnisse weitgehend entzaubert und für uns nicht mehr von Belang? Man betrachte die leidende Gottliebin, die, von Krämpfen geschüttelt, von Blutverlusten geschwächt und von Selbstmordgedanken bedroht auf ihrem Lager liegt. Hilfe erfährt sie nicht durch Aufklärung über seelische Hintergründe ihres Leidens, sondern durch einen Seelsorger, der sie und sich selbst vor das Angesicht Gottes stellt. Damit wird – jenseits von Dämonengläubigkeit, aber auch jenseits einer rein verstandesmäßigen Deutung – die Aktualität dieses Krankenlagers deutlich. Die kranke Frau erfährt die Treue Blumhardts, sein Ausharren bei ihr und sein Anhalten im Gebet. Darüber hinaus erfahren beide die Treue Gottes, der ihren Gebeten antwortet. Es verschwinden ja nicht nur einige psychopathologische Erscheinungen wie das Hervorbringen der angeblichen Geisterstimmen – das hätte eine übliche Psychotherapie auch bewirkt. Gottliebin wird heil im ganzheitlichen Sinne: körperlich (auch wenn später wieder ernste Erkrankungen auftreten), seelisch und geistlich. Sie wird in der Tiefe ihres Seins angerührt und verwandelt in einer Weise, die auf andere ausstrahlt. Sie ist jetzt nicht mehr das arme Ding, das ihr Bedürfnis nach Zuneigung und vielleicht auch gesellschaftlicher Geltung hinausschreit; sie hat nun einen tragenden Grund, der, wenn auch an Blumhardts Nähe gekoppelt, doch über ihn weit hinausgeht. Dass Blumhardt sie später, wie unten zu zeigen sein wird, als Mitarbeiterin in sein Haus aufnimmt, darin hat man bisweilen den eigentlichen Grund ihrer Heilung gesehen. Die neue Rolle mag das Geborgenheits- und Geltungsbedürfnis der intelligenten, aber armen Frau zufriedengestellt und zur Genesung beigetragen haben. Dass ihr Neuwerden jedoch darin nicht aufgeht, sondern tiefer gegründet ist, wird beim Betrachten des weiteren Lebensweges sichtbar.
Zuvor noch ein Blick auf Blumhardt. Auch er ist im Lauf der Ereignisse verwandelt worden. Hat er sich bislang trotz allen Engagements für die Gemeinde im Alltagsgeschäft aufgerieben, so macht ihn nun die Erfahrung, mit dem Bösen gleichsam „handgemein“ geworden zu sein, das letztlich doch dem heilmachenden Gott weichen musste, zu einem Zeugen der göttlichen Macht. Sein Wort wird jetzt gehört, anders als vorher. Erst kommen einzelne Gemeindeglieder zu ihm, legen auf eigenen Wunsch die Beichte ab und erbitten die förmliche Absolution. Dann wird er in seinem Amtszimmer gleichsam überlaufen von Beichtwilligen, die mitunter bitterlich weinen, was auch „die härtesten Männer nicht unterlassen können“.(11) Dennoch macht die Erweckung, die in kurzer Zeit die ganze Gemeinde ergreift, keinen überspannten Eindruck, eher den eines großen Aufatmens. Die Menschen kommen aus bisherigen Verbohrtheiten und Sackgassen heraus, können sich in rückhaltlosem Vertrauen Gott an den Hals werfen und neu anfangen zu leben. Blumhardt kann dieser Gemeinde ein würdiger Seelsorger sein, die Menschen auf ihren ersten Schritten in ein neues Leben begleiten, die Bewegung in nüchternen Bahnen halten, den Möttlingern und den immer zahlreicher werdenden Auswärtigen eindrücklich predigen. Überrascht stellt er nach einiger Zeit fest, dass seine Berührung manchmal zur Heilung seelischer und körperlicher Krankheiten führt. Am Krankenbett der Gottliebin Dittus hat er nicht nur etwas gelernt, was ihn menschlich und beruflich weiterbringt; etwas Objektives hat sich ihm mitgeteilt, das auf andere ausstrahlt.
In der Stuttgarter Gemeinschaftsbewegung, in Korntal und Basel ist Blumhardt die Naherwartung des ersten Tausendjährigen Reiches und der Wiederkunft Christi begegnet; zuvor rechnet man mit Bedrängnissen durch den Antichristen. Diese nach vorn gerichtete, ängstliche und letztlich doch freudige Erwartung gründet sich auf Johann Albrecht Bengels Auslegung der Offenbarung Johannis. Blumhardt sieht auch die Möttlinger Ereignisse in diesem Horizont. Den Kampf mit dem Bösen, Gottliebins Heilung, die Erweckung der Gemeinde und die Heilungen versteht er, so beeindruckend sie sind, nur als Vorspiel einer bald eintretenden weltweiten Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott, der will, dass alle Menschen und nicht nur ein paar „Fromme“ gerettet werden, wird auf der ganzen Welt eine Bußbewegung – ein, wie Blumhardt sagt, „Rennen und Jagen zum Reiche Gottes“ – erwecken als Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi, die ein Friedensreich einleiten, aber auch ein Gericht sein wird. Christen haben nicht mit den Händen im Schoß diese Entwicklung zu verfolgen, sondern für das Kommen von Gottes Reich zu beten und sich und andere darauf vorzubereiten. Hierin sieht Blumhardt von jetzt an seine Hauptaufgabe. Die Heilung der Gottliebin Dittus und erst recht die Erweckung haben ihn zum Theologen der Hoffnung gemacht.
Auf diesem Weg begleitet ihn neben anderen auch Gottliebin, nicht als Mitläuferin, sondern als Mitbeterin und gern gehörte Beraterin. 1844 überträgt ihr Blumhardt die Leitung der neugegründeten Möttlinger Kleinkinderschule, da er keine geeignetere Person als sie weiß. Bei all dem bleibt sie ein Mensch von zerbrechlicher Gesundheit. So kommt sie, wie Blumhardt dem befreundeten Christian Gottlob Barth am 9. August 1845 mitteilt, durch „eine Art Wassersucht“ und Erbrechen von geronnenem Blut in Lebensgefahr. Bereits vom Tod gezeichnet liegt sie da und hat alle Hoffnung aufgegeben, als Blumhardt für sie noch einmal betet. Diesmal treten weder Spuk noch Geisterstimmen auf; in weniger als fünf Minuten kommt es zu einer deutlichen Besserung. Eine Veränderung ist mit Gottliebin Dittus vorgegangen. Das gewachsene Vertrauen auf Gottes Hilfe ist es, das ihr Seelsorger jetzt nur in Erinnerung rufen muss.
1846 nimmt Blumhardt sie ganz in sein Haus und seine Familie auf. Sie wird, wie er in der Nachschrift zur Krankheitsgeschichte feststellt, „die treueste und verständigste Stütze meiner Frau in der Haushaltung und Kindererziehung“. Gottliebin erwirbt sich darüber hinaus das Vertrauen Kranker, die das Möttlinger Pfarrhaus aufsuchen; vor allem Geisteskranke haben „das ungemessenste Zutrauen“ zu ihr. Sie nimmt kein Geld für ihre Tätigkeit, ist also nicht Dienstperson im Hause, sondern „an Kindes Statt angenommen“; dies gilt auch für ihre Schwester Katharina und den Bruder Hansjörg.
Bevor Blumhardt sich 1852 zum Erwerb des Kurhauses Bad Boll entschließt, eines ausgedehnten Gebäudes mit 129 Zimmern, schickt er seine Frau Doris und Gottliebin dorthin. Ihm ist das Urteil der beiden Frauen wichtig; schließlich sollen sie später die Bad Boller Hauswirtschaft leiten und die erwarteten zahlreichen Gäste versorgen. Diese „musterten alles von der Bühne bis zum Keller, und der Mut kam ihnen mehr und mehr, namentlich da so viele Mobilien und Betten vorhanden waren, daß man sogleich mit Aufnahme von Gästen beginnen konnte.“ Zu guter Letzt „gaben sie sich die Hand und sagten wie aus Einem Munde: ,Gelt, das lassen wir nicht hinaus!’ Mit dem festesten Eindruck, das Haus sei für den gedachten Zweck geeignet und die Last der Verwaltung sei für sie beide zu wagen, kamen sie nach Möttlingen zurück.“(12) Besser kann das Ansehen, das Gottliebin Dittus in Blumhardts Familie genießt, nicht geschildert werden. Gemeinsam mit seiner Frau ist sie an Entscheidungen, die den Fortgang der Reichsgottesarbeit betreffen, maßgeblich beteiligt. Blumhardts Briefe und die Berichte anderer enthalten keine Andeutungen über eine Rivalität der beiden Frauen. Blumhardts Ehe mit Doris erweckt durchgängig den Eindruck einer glücklichen Verbindung. Doris Blumhardt und Gottliebin Dittus haben ihre gemeinsame Arbeit mit der gleichen Zielrichtung getan, in der Erwartung des bald in eine neue Phase tretenden Reiches Gottes. Dafür wird gebetet und bis zur Erschöpfung gearbeitet.
Friedrich Zündel, der Gottliebin persönlich kennengelernt hat, schildert sie als eine Persönlichkeit, die von ihrer ärmlichen Jugend her „etwas Grobkörniges“ behalten habe. Sie sei nichts weniger gewesen als liebenswürdig oder anmutig; ihre Lebenserfahrungen hätten sie vielmehr dazu befähigt, den geistlichen Zustand der Besucher präzise wahrzunehmen und gegebenenfalls deutliche Worte zu sagen. „Darum waren für sie Rang, Stand und dergleichen so gut wie nicht vorhanden, und darum war auch ihr Scharfblick lästig.“ Wer jedoch hinter ihr rauhes Wesen habe schauen können, habe einen „heißen, heiligen Ernst der Liebe und Fürbitte“ wahrgenommen und die Entschlossenheit, dem kommenden Gottesreich den Weg zu bereiten.(13)
Im Jahr 1855 heiratet Gottliebin Dittus den aus Nordfriesland stammenden und in Bad Boll von Gehbeschwerden geheilten Theodor Brodersen; aus der Ehe gehen drei Söhne hervor. Seit Dezember 1862 wird sie wegen eines Magenleidens, dem weitere Krankheiten folgen, längere Zeit in einem Stuttgarter Krankenhaus behandelt. Bis zu ihrer vorläufigen Entlassung im Juli 1863 schreibt Blumhardt ihr häufig, manchmal täglich. Er tröstet sie auf ihrem schmerzhaften Krankenlager, berichtet vom täglichen Gebet der Bad Boller für Gottliebin, erzählt von neu angekommenen Gästen und hält auch mit eigenen Sorgen und Zweifeln nicht hinter dem Berg. Ob „unsre Sache in ihrem richtigen Gang ist“, ob die Arbeit in Bad Boll auch wirklich Gottes Reich fördere und nicht vielmehr aufhalte, dieser Gedanke wird ihm manchmal zur Qual. Und wird er selbst vor der Zeit sterben müssen, wenn „so viel im Rückstand“ ist? Hinzu kommt die Sorge um seine Kinder, denen noch manches fehlt, einmal Nachfolger ihres Vaters sein zu können. Der Seelsorger, der sich in Bad Boll und auf Reisen ungezählter Hilfesuchender annimmt, erhält dann seinerseits von Gottliebin ein tröstendes und Mut machendes Gedicht.(14)
In der Folgezeit wird sie nicht mehr gesund. In mühevollem Auf und Ab schleppt sie sich dahin und stirbt am 26. Januar 1872 an Magenkrebs. Blumhardt ist an diesem Tag auf Reisen. Seine Frau und sein Sohn Christoph erleben, wie nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Hoffnung auf das Reich Gottes Gottliebins letzte Stunden bestimmt. Für Christoph, bisher voller Zweifel, ob er als Nachfolger seines Vaters geeignet sei, ist dies eine Erfahrung, die ihn lebenslang fest mit der gemeinsamen Sache verbindet.(15)
Gottliebin Dittus hat einen Weg genommen, der das Geschenk der Heilung aus Glauben konsequent festhält. Hinter die Feststellung von Hans Jörg Weitbrecht, ihre spätere Entwicklung sei nur ein „schönes Beispiel für den ,Fassadenwechsel’ geltungsbedürftiger Psychopathen“(16), darf ein Fragezeichen gemacht werden. Wie schon erwähnt, hat ihre Heilung eine tiefgehende Veränderung zur Folge. Nicht ihre „Fassade“ hat einen neuen Anstrich bekommen, sondern das ganze Haus, wenn es denn von Geltungssucht beherrscht wurde, ist eingerissen und neu gebaut worden.
Glaubensheilungen sind nicht auf Frauen beschränkt. Theodor Brodersen und viele andere Männer haben ebenfalls ein geistliches Neuwerden und dann auch Befreiung von Krankheit erfahren, etwa der Epileptiker, der im Bad Boller Sprechzimmer unter Blumhardts Gebet von der, wie er es schildert, „Majestät des gegenwärtigen Gottes“ überwältigt wird. Er kann nicht anders, als sich vor diesem Gott auf die Knie zu werfen – als er aufsteht, ist er gesund. Einen Rückfall in die Krankheit hat es offensichtlich auch Jahre nach diesem Erlebnis nicht gegeben.(17) Ferner sind Erscheinungen von „Besessenheit“, hysterische Ausbrüche und Visionen auch bei Männern bezeugt. So berichtet der Vater eines stummen Kindes, der Blumhardt 1846 in Möttlingen aufgesucht hat, er sei auf dem Rückweg „wahnsinnig“ geworden, habe den Heiland und den Teufel gesehen und erst durch acht Männer gebunden werden können.(18)
Was ist das Besondere am geistlichen Neuwerden und Heilwerden der Gottliebin Dittus? Zwischen ihr und Blumhardt wird mit der Zeit die Einbahnstraße der Seelsorge aufgehoben; an ihre Stelle tritt gegenseitiger Zuspruch und gemeinsames Gebet. Keiner hat den andern geistlich überwältigt; vielmehr werden beide durch das Eingreifen eines Dritten überwältigt. Mit dieser Erfahrung ausgerüstet, machen sie sich auf, Gott den Weg zu bahnen.
Erstmals veröffentlicht in: Weib und Seele. Frömmigkeit und Spiritualität evangelischer Frauen in Württemberg. Katalog zur Ausstellung im Landeskirchlichen Museum Ludwigsburg vom 16. Mai bis 8. November 1998, S. 97–102.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Blumhardt, Johann Christoph: Krankheit und Heilung an Leib und Seele. Auszüge aus Briefen, Tagebüchern und Schriften. Hg. von Dieter Ising (Edition Pietismustexte; Bd. 6). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014.
Zündel, Friedrich: Pfarrer Johann Christoph Blumhardt. Ein Lebensbild. 5. Aufl. Zürich 1887. Eine Neuausgabe der 5. Aufl. wird im Leibniz Verlag St. Goar vorbereitet. –Engl.: Pastor Johann Christoph Blumhardt. An Account of His Life. Edited by Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore, translated by Hugo Brinkmann (Blumhardt Series; Bd. 1). Eugene/Oregon: Wipf and Stock 2010.
Ising, Dieter: Johann Christoph Blumhardt. Leben und Werk. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002, 2. ergänzte Aufl. St. Goar: Leibniz Verlag 2016. – Engl.: Johann Chris-toph Blumhardt. Life and Work. A New Biography. Translated by Monty Ledford. Eu-gene/Oregon: Wipf and Stock 2009.
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/dittus-gottliebin (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Duncker, Max
-
Von: Butz, Andreas
Max Duncker (1862-1941)
Familienverhältnisse
V Carl D., Kaufmann (30.7.1813-3.2.1872). M Wilhelmine, geb. Betz (9.1.1822-22.7.1901). G 2. ∞ 1) 1888 Klara, geb. Roller (1865-1905) Tochter des Jakob Roller, Kanzleirat in Tübingen; 2) 1907 Martha, geb. Blum (1880-1918), Tochter des Eugen Otto Bernhard von Blum, Prälat. K Max (1909 - 1998), Dekan; Ludwig (1911 - 2002), Pfarrer; Christoph (1914 - 1998), Dekan
Biographische Würdigung
D. wurde am 7. Juli 1862 in Geislingen als Sohn des Stadtrates und Eisen-, Spezerei- und Farbwarenhändlers Carl D. geboren, und wuchs daselbst mit zwei Schwestern und einer elternlosen Cousine auf. Der Vater starb als der Junge erst neun Jahre alt war. Er besuchte die Schulen seiner Heimatstadt, kurze Zeit auch das Lyzeum in Nürtingen, um dann im Herbst 1876 als Seminarist in das niedere evangelisch-theologische Seminar einzutreten, erst in Schöntal, und dann ab 1878 in Urach. Im Herbst 1880 bezog er die Universität Tübingen, zunächst um seiner militärischen Dienstpflicht als Einjährig-Freiwilliger zu genügen, und dann, um dort als Angehöriger des höheren evangelisch-theologischen Seminars Theologie zu studieren. Nach der ersten theologischen Dienstprüfung fand er im unständigen Kirchendienst Verwendung, in Großsüßen, Plieningen, Maulbronn und Wangen im Allgäu. Im Sommer 1887 machte er, durch ein Staatsstipendium unterstützt, eine Studienreise nach Mittel- und Norddeutschland und Skandinavien. Im Frühjahr 1888 wurde er nach abgelegter zweiter Dienstprüfung zum Pfarrer in Klingenberg am Neckar ernannt.
In seine Zeit in Klingenberg fiel auch der Anfang seiner historischen Forschungstätigkeit. Der überschaubare Arbeitsanfall in dieser kleinen Landgemeinde erlaubte es dem Pfarrer ohne Vernachlässigung seines Amtes und ausgehend von der Lokalgeschichte seinen wissenschaftlichen Neigungen nachzugehen. Den Heilbronner Archivar Rektor Dr. Dürr unterstützte er dann in dieser Zeit bei der Bearbeitung der Oberamtsbeschreibung mit reformationsgeschichtlichen Studien.
Seine Beförderung auf das Pfarramt Belsen im Sommer 1898 versetzte ihn in die Nähe Tübingens. Seine historischen Kenntnisse erweiterte und vertiefte er hier vor allem durch den Besuch von Vorlesungen der Professoren Walter Goetz und Heinrich Günter. Ab 1899 konnte er durch Ausgrabungen im Innenraum der dortigen Kapelle, welche er dort mit dem Landeskonservator durchführte, sowie auch durch eingehende weitere Untersuchungen, die Erkenntnisse über dieses rätselhafte Bauwerk vermehren. D. hat über diese interessante Kapelle mehrfach publiziert und referiert. Deshalb wurde später der Weg hinauf zum Belsener Kirchlein nach D. benannt.
Für den zweiten Band der Oberamtsbeschreibung Heilbronn beschrieb er den Ort Talheim an der Schozach, dessen Geschichte zu erforschen angesichts der verschiedenen dort ansässigen Geschlechter und Lehensträger keine einfache Aufgabe war, und wozu er zunächst das dortige Schlossarchiv ordnen musste.
Im Auftrag der Kommission für Landesgeschichte, der er als Mitglied angehörte, nahm er die Pfarr- und Gemeinderegistraturen der evangelischen Orte der Oberämter Brackenheim, Besigheim, Cannstatt, Maulbronn, Rottenburg und Tübingen für die Württembergischen Archivinventare auf. Auch durch diese Tätigkeit wurde er an neuen geschichtlichen Stoff herangeführt. Seine Forschungen ergaben zahlreiche Veröffentlichungen in den Tübinger Blättern und den Reutlinger Geschichtsblättern, dem Mitteilungsblatt des Sülchgauer Altertumsvereins, dessen Leitung er übernahm. Im Auftrag der Kommission für Landesgeschichte bearbeitete er das Verzeichnis der württembergischen Kirchenbücher, welches 1912 erstmals erschien, und im Jahre 1938, da inzwischen vergriffen, völlig neu bearbeitet eine Neuauflage erfuhr, bei der auch eine weitere, verwandte Quelle, die Kirchenkonventsprotokolle berücksichtigt werden konnten. In einer ausführlichen Einleitung beschreibt er in diesem Verzeichnis die Einführung der Kirchenbücher in den einzelnen Territorien. Die Pfarrer beider Konfessionen mussten ihm auf Anweisung ihrer Behörden, also des Ev. Konsistoriums beziehungsweise des Bischöflichen Ordinariates, die notwendigen Unterlagen einreichen.
Seine im Herbst 1912 erfolgte Ernennung zum Stadtpfarrer in Neckarsulm ermöglichte ihm, die früher begonnenen Studien über Heilbronn zu einer Dissertation bei Prof. Walter Götz auszuweiten. Während des ersten Weltkrieges und in den Jahren danach fand D. neben seinen Aufgaben als Neckarsulmer Pfarrer, und zum zweiten Mal zum Witwer geworden, wenig Gelegenheit für neuere Forschungen. Seine dortige Arbeit war weitaus verzweigt, auch durch die Versorgung der Gemeinde in Gundelsheim. In der Kriegszeit kam dazu noch der Dienst als Lazarettpfarrer auf Schloss Hornegg dazu. In seinem Ruhestand ab 1933, den er in Tübingen verbrachte, konnte er sich wieder vermehrt der historischen Forschung widmen ,vor allem in den Beständen des dortigen Städtischen Archivs, besonders den Spitalakten, und publizierte Jahr um Jahr in den Tübinger Blättern größere Arbeiten, so etwa über die Geschichte der Pfarrei Derendingen bis 1800, über die Salzburger Emigranten in Tübingen im Jahr 1732, über das Tübinger Spital im Mittelalter.
Darüber hinaus entfaltete er eine fruchtbare Tätigkeit als Pfleger des Landesamts für Denkmalpflege, als staatlicher und kirchlicher Archivpfleger des Bezirks, als reges Mitglied in historischen Vereinen, vor allem in dem Sülchgauer Altertumsverein, dessen Versammlungen er durch seine Vorträge und sein Wissen bereicherte.
Unermüdlich widmete er sich vielfältigen kirchen- und landesgeschichtlichen Forschungen, in denen er stets Neues aus den Urkunden oder Akten herausholte und zu einem anschaulichen Kulturbild verarbeitete. Noch einige Tage vor seinem Tod übergab er dem Herausgeber der Tübinger Blätter, Peter Goessler, ein Manuskript über Beziehungen des Spitals zum Schönbuch und seinen Waldgerechtigkeiten, und selbst am Tag vor seinem Tod am 15. Juni 1941 ging er in der dortigen Universitätsbibliothek historischen Forschungen nach.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Stadtpfarrer Dr. M. Duncker, in: Reutlinger Geschichtsblätter 38/39 (1931/1932)
Ludwig Duncker, Nachruf auf Max Duncker, in: ZWLG 5 (1941), 457 f.;
Peter Goessler, Zur Erinnerung an Stadtpfarrer a.D. Dr. Max Duncker, in: Tübinger Blätter 32 (1941), 51 f.
Peter Goessler, Zum Gedächtnis an Dr. Max Duncker, in: Tübinger Chronik vom 17.6.1941
Ludwig Duncker: Max Duncker: Pfarrer und Geschichtsforscher, 1862-1941, in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken 16 (1986), 318-337
Heinrich Betz, Max Duncker (1862-1941), in: Reutlinger Geschichtsblätter N.F. 29 (1990), 56-57.
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/duncker-max (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Flattich, Johann Friedrich
-
Von: Ehmer, Hermann
Johann Friedrich Flattich (1713-1797)
-
Johann Friedrich Flattich
gemeinfrei (Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart)
Er gründete ein Internat im Pfarrhaus, war ein gesuchter Prediger und setzte sich dafür ein, dass Menschen lernten, gut zu wirtschaften. "Wenn man wenig braucht, muss man wenig erwerben und sich um so weniger Sorgen machen", war einer seiner Leitsprüche.
Viele kennen das Büchlein "Zwischen Kanzel und Acker" von Georg Schwarz. Es ist ein 1940 erstmals erschienener und seither immer wieder aufgelegter Roman, keine Lebensbeschreibung des württembergischen Pfarrers Johann Friedrich Flattich. Dieser wurde 1713 in Beihingen am Neckar als Sohn eines Schulmeisters geboren. Der Vater starb früh, weshalb die Mutter froh war, dass ihr Sohn die kostenlose Ausbildung zum württembergischen Theologen machen konnte. Nach dem Examen war der junge Flattich zunächst Vikar in Hoheneck bei Ludwigsburg, 1742 wurde er Garnisonsprediger auf dem Hohenasperg, worauf er sich umgehend mit Christiana Margareta Groß, einer Pfarrerstochter, verheiratete. Das Ehepaar hatte im Laufe der Jahre 14 Kinder, wovon jedoch nur sechs das Erwachsenenalter erreichten. Die beiden Söhne wurden Pfarrer. Eine der vier Töchter, Beata, wurde die zweite Ehefrau des Mechanikerpfarrers Philipp Matthäus Hahn.
Pfarrer und Erzieher
Schon auf dem Asperg begann Flattich damit, junge Leute in Kost und Wohnung zu nehmen, die er unterrichtete und erzog. Flattich verstand es, die Schüler zum selbständigen Lernen zu bringen, indem er ihnen den Stoff in überschaubaren Portionen darbot. Durch diese individuelle Methode entlastete er sich selbst und hatte damit so viel Erfolg, daß ihm stets Schüler zugeschickt wurden. 1747 wurde er nach Metterzimmern versetzt, 1760 nach Münchingen. Für das dortige Pfarrhaus ließ er auf eigene Kosten einen Anbau errichten, der einen Arbeitsraum und Schlafräume für die Schüler bot. Dieses Internat im Pfarrhaus bedeutete eine große Arbeitslast für die Pfarrfrau. Als sie 50jährig starb, hat ihr Flattich einen bewegenden Nachruf gewidmet.
Prediger, Seelsorger und Ratgeber
Neben seiner "Information", wie er seinen Unterricht nannte, versah Flattich sein Pfarramt. Von 1777 bis zu seinem Tod wurde er darin nacheinander von seinen beiden Söhnen, die Vikare bei ihm waren unterstützt. Flattich war ein gesuchter Prediger, viele Leute kamen von auswärts, um ihn zu hören und sich von ihm seelsorgerlich beraten zu lassen. Leider ist keine seiner Predigten erhalten, doch haben wir eine Anzahl seiner Briefe.
Vor allem lag ihm das "Hausen" am Herzen, das richtige Wirtschaften und Haushalten. Sparsamkeit war in der Mangelgesellschaft des 18. Jahrhunderts die einzige Möglichkeit zum Überleben. Wenn man wenig braucht, so Flattich, muß man wenig erwerben und sich um so weniger Sorgen machen. Seine eigene Lebenshaltung war äußerst bescheiden, er hat dann aber auch ein ansehnliches Vermögen hinterlassen.
Bis zum heutigen Tag werden Flattich-Anekdoten erzählt, die vielleicht den Geist Flattichs atmen, aber ansonsten meist erfunden sind. Einer seiner Söhne hat jedoch 1825 Regeln der Lebensklugheit im Volkston herausgegeben. Es ist dies eine Blütenlese aus Flattichs Briefen über das Thema des Hausens. Dieses Büchlein über das richtige Haushalten wurde im 19. Jahrhundert in zahlreichen Auflagen gedruckt und ist somit Flattichs Vermächtnis an die Nachwelt.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/flattich-johann-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Gauger, Joseph
-
Von: Lächele, Rainer
Inhaltsverzeichnis
Joseph Gauger (1866-1939)
1: Familienverhältnisse
V Johann Martin Gauger (5.2.1816-3.9.1873), Lehrer am Erziehungsheim Paulinenpflege
M Pauline Christine geb. Schmid (+ 1897)
G 10, u.a. die Schwestern Luise, Heinrike und Maria (Ehefrau des Direktors Heinrich Ziegler, Wilhelmsdorf), Bruder Samuel Gauger (13.11.1859-29.5.1941), Dekan in Ludwigsburg
∞ 1898 Emeline Gesenberg
2: Biographische Würdigung
Joseph Gauger, geboren am 2. April 1866 in Winnenden, entstammte dem württembergischen Pietismus. Geprägt durch den Vater fand er selbst schon früh Anschluss an pietistische Gruppen wie der Hahnschen Gemeinschaft. Die zeitlebens enge Verbindung Gaugers zur Inneren Mission begann mit seiner Tätigkeit als Lehrer an der bekannten „Bildungsanstalt für Kleinkinderpflegerinnen“ in Großheppach. Sein pädagogisches Talent war schon hier deutlich zu spüren. 1889-1893 studierte er zunächst die Rechte, dann die evangelische Theologie in Tübingen. 1898 wurde er sTadtpfarrverweser in Giengen an der Brenz. Noch im selben Jahr verließ er die Württembergische Landeskirche, um in die Dienste der „Evangelischen Gesellschaft“ in Elberfeld zu treten. Damit ging er gewissermaßen vom württembergischen zum niederrheinischen Pietismus über. Die „Evangelische Gesellschaft“, die sich seit 1848 der Mission in Deutschland widmete, hatte als Ziel die Sammlung der „Kerngemeinde“ entschiedener Christen unabhängig von der verfassten Kirche, wenn auch in die Kirche wirkend. Hier war Gauger für die Verlagsarbeit und die so genannte Schriftenmission zuständig. Die bedeutete ein starkes Engagement für die Erbauungszeitschriften der „Evangelischen Gesellschaft“ wie „Licht und Kraft“ und die „Mitteilungen“, doch vor allem für das Blatt „Licht und Leben“, das den Horizont der Gemeinschaftsleute erweiterte und ihn in ganz Deutschland bekannt machte. Darüber hinaus fand seit 1923 Gaugers Monatsblatt „Gotthardbriefe“ mehrere tausend Leserinnen und Leser. In ihnen wurden die brennenden politischen Fragen der Zeit von einem christlich-konservativen Standpunkt aus betrachtet. Der musikalisch begabte Gauger trat darüber hinaus mit christlichen Liedsammlungen hervor, wie etwa dem „Evangelischen Psalter“ von 1930. Zentrale Themen in der Publizistik der „Evangelischen Gesellschaft“ waren die charismatischen Bewegungen seiner Zeit, die liberale Theologie insbesondere im Fall des Kölner Pfarrers Karl Jatho und die Bedeutung des Bekenntnisses in der Kirche. Gauger faszinierte seine Zeitgenossen mit Berichten über seine Reisen, die ihn nach Italien und Ägypten, aber auch nach Palästina führten. In diesen bebilderten Bändchen y schwärmte er etwa von Rom, das allerorten Kunst und Geschichte im Überfluss biete, aber auch vom „Morgenland“, das sich ihm in Ägypten darbot. Er bot Blicke auf die ägyptische Moderne mit einer Schilderung des Staudamms von Makwar, aber auch den Pyramiden Tribut zollte.Politisch engagierte sich Gauger in Wuppertal mit der Gründung der „Freien Evangelischen Wahlvereinigung“ im Jahre 1930, die bei der Kommunalwahl in Wuppertal 13.000 Stimmen auf sich vereinigte und als Fraktion in das Stadtparlament einziehen konnte. Schon 1932 warnte Gauger vor dem Nationalsozialismus, weil er „durch seinen Rassebegriff seine Religion und seine Weltanschauung bestimmen lasse“. Die eindeutige Stellungnahme Gaugers für die Bekennende Kirche nach 1933 führte zu schweren Konflikten mit dem nationalsozialistischen Regime. Seine offene Rede in „Licht und Leben“ brachte ihm Haussuchungen, Verhaftungen und weitere Schikanen ein. Er wurde aus dr Reichsschrifttumkammer ausgeschlossen. 1938 wurde „Licht und Leben“ verboten. Am 1. Februar 1939 starb Gauger in Elberfeld.
Erstabdruck in: Württembergergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band I. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2006. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/gauger-joseph (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Gmelin, Julius
-
Von: Butz, Andreas
Inhaltsverzeichnis
Julius Gmelin (1859-1919)
1: Familienverhältnisse
V Friedrich August G. (1821-1894), Kaufmann M Wilhelmine, geb. Windecker (1832-1866). G 7. ∞ 21.9.1884 (Cannstatt) Elise, geb. Kriech (26.7.1858-4.5.1935), Tochter des Georg Kriech, Pfarrer K Wilhelm (1888-1912); Anna (1889-1920); Max (1890-1910); Eugenie (1891-1944); Elise (1891-1971); Adolf (1893-1917); Johanna (1895-1951); Karl (1896-1916); Lina (*1897); Antonie (1899-1953); Thusnelde (1900-1946)
2: Biographische Würdigung
-
Julius Gmelin (1859-1919)
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 3330
In Ludwigsburg am 28. April 1859 geboren, verlor er bereits mit sieben Jahren seine erst 34jährige Mutter. Als Vermächtnis hinterließ sie ihm zur Konfirmation einen Brief, worin sie unter anderem schrieb: „Wenn du den geistlichen Stand erwählst, stehen Dir nochmals besondere Verheißungen zur Seite. Wenn du aber ein träger Hirte bist, nutzest Du weniger als der schlechteste Taglöhner und versperrst nur anderen den Platz …“. Einen großen inneren Halt gab ihm sein Patenonkel Moriz Gmelin, Archivrat in Karlsruhe, aufgrund dessen Anregung er neben der Theologie auch Geschichte studiert hat. Der Vater verzog 1875 nach Frankfurt am Main.
Seine Frau lernte G. als Vikar in Plattenhardt kennen. Sie war die Tochter des dortigen Pfarrers. Nach seiner Versetzung als Diakon in Waldenberg bei Öhringen konnte er mit ihr seinen Hausstand gründen.
Mit seiner Zeit als Pfarrer in Großaltdorf begann eine Zeit von großer geistiger Produktivität. Gmelin war ein kritischer und engagierter Geistlicher, der in seiner frühen Schrift „Evangelische Freiheit“ bereits zahlreiche Anregungen zu geben versuchte, wie sich die Kirche seiner Meinung nach in der damaligen Gegenwart positionieren sollte und wie sie sich weiterentwickeln könne. Er sah sich als Streiter für dogmatische Freiheit und eine durchgreifende Neuordnung der evangelischen Kirche.
Sein Gerechtigkeitssinn schlug sich in seinen Forschungsinteressen nieder, und er ging deshalb gerne einer Anregung durch Professor Bernhard Kugler nach, durch eine sorgfältige Arbeit die Arbeit von Hans Prutz über die Prozesse gegen den Templerorden zu widerlegen.
Während seiner Zeit in Großgartach verfasste er auch seine „Hällische Geschichte“, die erste umfangreiche Lokalgeschichte dieser bedeutenden Reichsstadt, allerdings – entgegen des ursprünglichen Vorhabens - mit deutlichem Schwerpunkt auf dem Mittelalter und der Reformationszeit. Wie er selber einleitend bekannte, wollte er damit ein wissenschaftlich fundiertes, aber auch für eine breite Leserschaft geeignetes Werk vorlegen.
Während seiner Amtszeit als Pfarrer in Großgartach stellte er seine Kräfte in den Dienst der Errichtung eines neuen Gemeindehauses mit Kindergarten, und setzte sich in besonderem Maße für die Verbesserung des dortigen Kirchengebäude ein, das er bei Amtsantritt in schlechtem Zustand vorfand, und das dann nach Plänen von Prof. Martin Elsässer 1912-1913 im so genannten Stuttgarter Jugendstil grundlegend vergrößert und erneuert werden konnte. Straßen in Großgartach und in Schwäbisch Hall tragen heute seinen Namen. In seiner Freizeit befasste er sich mit Geschichte, Familien- und Völkerkunde, und mit dem Gesangbuchwesen. Seine Losungen waren „Frei und Fromm“ und „Streiten ist nicht gefährlich, aber Schlafen“. In Großgartach gründete er die Zeitung „Warte vom Heuchelberg“, um die geistige Verbindung seiner Gemeindeglieder untereinander und eines Kreises darüber hinaus zu stärken.
Als eifriger Förderer nationalliberaler Einheitsbestrebungen stand er dem Reichstagsabgeordneten Friedrich Naumann nahe, den er übrigens nur um wenige Tage überleben durfte. Häufig in der Neckar-Zeitung deren Redaktion von dem G. politisch nahe stehenden Theodor Heuss geleitet wurde, aber auch in anderen Blättern, richtete er sich in engagierten Artikeln, Erklärungen und Protesten an die Öffentlichkeit, zu Fragen, die aus seiner Sicht die Freiheitlichkeit der Evangelischen Kirche berührten, etwa die Dienstentlassungen der Pfarrer Christoph Schrempf, Friedrich Steudel, Maienfels, und Gottfried Traub, Dortmund. Auch in Bezug zu der seiner Ansicht nach verfehlten Praxis der Veranstaltung von Kirchenbau-Lotterien äußerte er sich kritisch. In politischer Hinsicht war es ihm ein Anliegen, die Öffentlichkeit über – wie er es sah - Mängel bei der Wahlreform aufzuklären. Er sah es als seine Pflicht an, sich kritisch zu äußern, und sich mit seiner Sicht der Dinge nicht unterzuordnen. Damit setzte er sich immer wieder in Gegensatz zu seiner vorgesetzten Behörde, weshalb er mehrfach in disziplinarische Verfahren verwickelt und zu Geldstrafen verurteilt wurde.
Wegen einer 1902 gehaltenen Osterpredigt, in welcher er zum Ausdruck gab, dass er nicht an die leibliche Auferstehung glauben könne, wurde er vom Konsistorium geahndet. Dieser Fall wurde von der nationalen Presse mit Aufmerksamkeit verfolgt.
1911 war er führend an der Gründung der Vereinigung „Freunde evangelischer Freiheit in Württemberg“ beteiligt.
In seiner Schrift „Warum wir nicht siegen durften“ schildert er unter anderem, dass ihm 1917 von der militärischen Zensurbehörde der Abdruck von zwei für das Gemeindeblatt geplanten Aufsätzen, der erste über das Thema „Buße“, der zweite ein Abdruck seiner Predigt zum „Glockenabschied“, verboten wurden. Im weiteren Verlauf, in welchem er auch Informationen über einen als geheim gekennzeichneten, an die Pfarrer gerichteten Erlass an die Presse weitergab, verhängte das Konsistorium gegen ihn zwei Geldstrafen. G. war ein entschiedener Gegner der Zensur. Seine sehr kritische Kenntnisnahme des Völkermordes an den Armeniern brachte ihn in Konflikt mit der Zensurbehörde, und führte auch zur Entfremdung von politischen Freunden. Trotz seiner patriotischen Einstellung war er nicht blind für die Fehlentwicklungen des Ersten Weltkrieges und äußerte sich vor allem kritisch zu den Auswüchsen des Militarismus.
Die Trennung von Staat und Kirche lag ihm besonders am Herzen.
Seinen elf Kindern war er ein liebevoller Vater, und es war ein schwerer Schicksalsschlag, dass er sämtliche vier Söhne früh verlor. Sein Sohn Max, erlag nur wenige Tage nach seiner Auswanderung nach Brasilien in Manaos dem gelben Fieber. Der angehende Tierarzt Wilhelm machte seinem Leben als 20jähriger selber ein Ende. Die beiden weiteren Söhne des pazifistisch eingestellten Pfarrers wurden beide ein Opfer des ersten Weltkrieges, einer davon durch eine in Galizien erhaltene Verwundung, der ältere genau ein Jahr darauf nach einem gefährlichen Einsatz als Fliegeroffizier an der Aisne.
Schon vor Beginn des ersten Weltkrieges war bei ihm ein Herzfehler festgestellt worden, den er nicht genügend beachtete. G. verstarb am 29. August 1919 im Alter von nur 60 Jahren in Großgartach unerwartet an einem nächtlichen Herzschlag.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Rolf Eilers: Julius Hermann Gotthelf Gmelin (1859-1919), in: Die Familie Gmelin, 60-62
Gerd Wunder: Julius Gmelin, in: Württ. Franken 57 (1973), 306-308.
Quellen:
LKAS, A 27, 936
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/gmelin-julius (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Gundert, Hermann
-
Von: Quack, Jürgen
Herman Gundert (1814-1893)
-
Hermann Gundert
Archiv der Basler Mission, QS-30.016.0002
Herman Gundert ist nicht zu übersehen: Über fünf Meter hoch ist sein Denkmal, das seit dem Jahr 2000 an einer Hauptstraße in Thalassery (früher: Tellicherry) im südlichen Indien steht. Hier hat er von 1839 bis 1859 als Missionar und Sprachforscher, Schulinspektor und Übersetzer viel bewirkt. Die Christen in Indien ehren ihn als einen ihrer Kirchengründer. Journalisten halten sein Andenken hoch, weil er die erste indische Tageszeitung in einheimischer Sprache herausgab. Pädagogen denken an ihn, weil er der erste indische Schulinspektor im Bundesstaat Kerala (früher: Malabar) war und die örtliche Malayalam-Sprache erforschte. Er schrieb die erste Grammatik und das erste Wörterbuch dieser Sprache und übersetzte die Bibel in Malayalam. Deshalb wird er auch „Luther Keralas“ genannt.
Gundert wurde am 4. Februar 1814 in Stuttgart geboren, wo sein Vater als erster Sekretär der Württembergischen Bibelgesellschaft tätig war. Nach dem Theologiestudium in Tübingen ging der junge Mann zunächst als Hauslehrer nach England, von wo er mit einem englischen Missionar nach Indien fuhr. Dort schloss er sich der Basler Mission an.
Auf der Schifffahrt nach Indien lernte er die Schweizer Lehrerin Julie Dubois kennengelernt. Die beiden heirateten 1838. Sie war die erste Missionarsfrau der Basler Mission in Indien und sehr aktiv. Sie gründete einige Mädchenschulen in verschiedenen Orten. Das Ehepaar hatte acht Kinder.
Krankheitshalber musste Gundert 1859 nach Deutschland zurückkehren. In Calw wurde er zunächst Mitarbeiter von Christian Gottlob Barth in dessen Calwer Verlag und ab 1862 sein Nachfolger. Er starb 1893.
-
Hermann Gundert und seine Frau Julie
Archiv der Basler Mission, QL-30.006.0264
Die von ihm in Indien gesammelten Manuskripte und Texte liegen heute im Archiv der Universität Tübingen. Dort lehren seit 2015 auf dem "Gundert Chair" regelmäßig Gastdozenten aus dem Südwesten Indiens die Sprache Malayalam.
Auch in Calw ist seine Spur nicht zu übersehen: Die große Hermann Gundert Schule vereint ein Berufliches Gymnasium, ein Berufskolleg, Berufsschulen und eine Berufsfachschule unter ihrem Dach. Der früher in Indien als Dozent tätige Pfarrer Albrecht Frenz gründete die Hermann-Gundert-Gesellschaft, um sein geistiges Erbe und den wissenschaftlichen Austausch mit Indien zu pflegen.
Weitere Spuren hat sein Enkel Hermann Hesse in verschiedenen Büchern gelegt. In seinen Schriften „Großväterliches“ und „Kindheit des Zauberers“ beschreibt er ihn liebevoll. In „Siddhartha“ lebt er als Fährmann „Vasudeva“ und im „Glasperlenspiel“ als Musikmeister fort.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/354 (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hahn, Beata
-
Von: Kittel, Andrea
Beata Regina Hahn (1757-1824)
-
Eintrag im Taufregister Mettingen für Regina Beata Flattich (später Hahn). Ein Porträt ist nicht überliefert.
Geboren wird sie am 29. November 1757 in Metterzimmern. Im Pfarrhaushalt Flattich wird großer Wert auf religiöse Erziehung und humanistische Bildung gelegt – auch bei den Töchtern.
Im Alter von 18 Jahren heiratet Beata Regina Flattich 1776 den angesehenen Pfarrer Philipp Matthäus Hahn, nachdem dessen erste Frau bei der Geburt eines Kindes gestorben war. Hahn ist Pfarrer in Kornwestheim, Pietist und gleichzeitig einer der einfallsreichsten Erfinder seiner Zeit. Gefördert von Herzog Carl Eugen, konstruiert er Waagen, Uhren und Rechenmaschinen.
Reibungsvolles Eheleben
„Die Beata ist noch ungebildet, jung, heiter, nimmt nichts schwer, steht noch in jugendlicher Unschuld (…) hat Freude an meinen mechanischen Sachen (…).“ So begründet Hahn in seinem Tagebuch, dass seine Wahl nach intensiver Brautschau auf die jüngere von zwei Flattichtöchtern fiel. Doch einfach sollte die Ehe für beide Seiten nicht werden. Ständig gibt es Reibereien um die Haushaltsführung, hauptsächlich aber wegen Beata Reginas mangelndem Gehorsam. In seinem Tagebuch notiert Philipp Matthäus: „Frau war wieder eigensinnig, widersprach mir unablässig und gab mir nicht nach.“ Schließlich beklagt er, dass sie „von Jugend auf mehr zu den Sprachen erzogen worden war“ und eben nicht zur Hausfrau. Sie hingegen wünscht sich von ihrem Ehemann „mehr zärtliche Liebe und Karesie“. Wenn sie mit ihren Einwänden nicht durchdringt, wird sie still, „melancholisch“.
Beata Regina Hahns Familienalltag ist schwer. Da gibt es den großen Haushalt mit Mägden, Gehilfen und vielen Besuchern. Aus Hahns erster Ehe sind vier Kinder zu versorgen. Sie selbst bekommt acht Kinder, von denen fünf früh sterben. Ständig grassieren im Haus Krankheiten – mal sind es „Hitz und Kopfweh“, mal die „Blattern“.
Herausgeberin von Hahns Schriften
Als Philipp Matthäus Hahn 1790 stirbt, sieht sie sich erstmals in der Lage selbständig zu wirken. Gemeinsam mit ihrer noch jugendlichen Tochter Beate bemüht sie sich um die Weiterverbreitung von Hahns geistlicher Lehre indem sie aus seinen nachgelassenen Manuskripten Druckvorlagen erstellt. 1795 gibt sie die „Erbauungsstunden über die Offenbarung des Johannes“ heraus. Für Darstellungen von Hahns Leben entwerfen Mutter und Tochter das Idealbild eines pietistisch-frommen Heiligen. Beata Regina merzt die Ehekonflikte aus den Tagebüchern, tilgt heterodoxe Äußerungen aus Predigtentwürfen und befördert damit ein Hahn-Bild, das das gesamte 19. Jahrhundert über Wirksamkeit behält.
Bei allem Eigensinn bleibt Beata Regina Hahn in der damals für Frauen bestimmten Rolle der „Gehilfin“. Sie selbst tritt mit eigenen Glaubensäußerungen nicht in Erscheinung. Doch legt sie den Grundstein für das Werk ihrer Tochter, die später als Beate Paulus die weibliche Symbolfigur des württembergischen Pietismus wird.
Am 16. April 1824 stirbt Beata Regina Hahn in Münchingen.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Philipp Matthäus Hahn: Die Kornwestheimer Tagebücher 1772-1777, hrsg. von Martin Brecht u. Rudolf F. Paulus, Berlin, New York 1979 (KwTb)
Philipp Matthäus Hahn: Die Echterdinger Tagebücher 1780-1790, hrsg. von Martin Brecht u. Rudolf F. Paulus, Berlin, New York 1983 (EchTb)
Christian Väterlein (Hg.), Philipp Matthäus Hahn 1739-1790. Pfarrer, Astronom, Ingenieur, Unternehmer. Ausstellungen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Städte Ostfildern, Albstadt, Kornwestheim, Leinfelden-Echterdingen. Teil 1 Katalog und Teil 2 Aufsätze. Quellen und Schriften zu Philipp Matthäus Hahn Band 6, Stuttgart 1989
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hahn-beata (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hardegg, Georg David
-
Von: Eisler, Jakob
Georg David Hardegg (1812–1879)
-
Georg David Hardegg (1812-1879)
Aus: Hans Brugger, Die deutschen Siedlungen in Palästina, Bern 1908.
Georg David Hardegg wurde am 2. April 1812 als Sohn eines Gastwirts in Eglosheim bei Ludwigsburg geboren. Er absolvierte eine Kaufmannslehre und ging 1830 nach Belgien, wo er von den Ideen der dortigen Revolution ergriffen wurde. Als er 1832 nach Ludwigsburg zurückkehrte und die Ideen einer „Deutschen Republik“ verbreitete, wurde er als „Revolutionär“ zu 14 Jahre Haft verurteilt, die er später z.T. in Verbannung in der Schweiz verbrachte. 1844 wurde Hardegg begnadigt und kehrte nach Ludwigsburg zurück. Während seiner Inhaftierung auf dem Hohen Asperg (1832–1840) hatte Hardegg lediglich Zugang zu Schriften von Bengel und die Bibel. Daher rührte seine Beziehung zur Religion und zur Mystik.
Über das Buch Christoph Hoffmanns „Stimmen der Weissagung über Babel und das Volk Gottes“ lernten sich Hoffmann und Hardegg kennen. Gemeinsam entwickelten sie den Gedanken, ein „Volk Gottes“ zu gründen, dass sie in das Heilige Land führen wollten. Hardegg ergänzte Hoffmann optimal, indem er Hoffmanns eher weltfremden Plan, nach Jerusalem zu ziehen, energisch in die Praxis umsetzen wollte. Bald formierte sich um Hoffmann und Hardegg eine Gruppe namens „Jerusalemsfreunde“, später Tempelgesellschaft oder Templer genannt.
Im Jahre 1857 beschlossen die Templer eine Erkundungsgruppe ins Heilige Land zu senden. Im Januar 1858 reisten Hoffmann und Hardegg als Vorsteher der Gemeinde mit Joseph Bubeck, einem diplomierten Winzer, nach Palästina. Hoffmann interessierte sich - seinem idealistischen Naturell nach - eher für die heiligen Stätten, während der realistische Hardegg alle praktischen Details gründlich erforschte. Die unfreundliche Haltung der Bevölkerung und der türkischen Regierung bewog sie allerdings, ihren Anhängern eine vorläufige Aufschiebung der Siedlungspläne zu empfehlen. 1861 erfolgte aufgrund der religiösen Aktivitäten der Tempelgesellschaft der Bruch mit der evangelischen Landeskirche von Württemberg.
1868 entschlossen sich die Vorsteher, die Auswanderung endgültig in Angriff zu nehmen. Die Tempelgesellschaft legte eine Missions- und Ansiedlungskasse an. Eine Kommission hatte zu entscheiden, wer wann auswandern durfte. Hoffmann und Hardegg, die als erste nach Palästina auswanderten, reisten zunächst nach Konstantinopel und versuchten dort, einen Ferman (Erlaubnis) zu erhalten. Obwohl dies misslang; setzten sie ihre Reise nach Palästina fort. Am 30. Oktober 1868 erreichte Hardegg Haifa wo er den „Vorposten und Empfangsstation“ für künftige Einwanderer errichtete.
1869 wurde die Kolonie Haifa gegründet und Hardegg wurde ihr Vorsteher. Zur selben Zeit knüpfte Hardegg auch Kontakte mit dem Gründer der Religion der Bahai. Bereits seit Beginn der Kolonisierung herrschte zwischen den beiden Vorstehern der Templergemeinde, Hoffmann und Hardegg, Spannungen. Der Konflikt verschärfte sich, als sich Hardegg eigenmächtig über die Finanzierung eines Projektes für eine Landwirtschaftsschule aus der Templerkasse entschied.
Im Jahre 1874 trat Hardegg aus der Gesellschaft aus, gleichzeitig mit ihm ein Drittel der Kolonisten aus Haifa sowie einige aus Jaffa/Sarona. Zwölf Jahre blieb die Splittergruppe um Hardegg ohne Status und finanzielle Unterstützung. Sämtliche andere protestantische Gemeinden und Missionsgesellschaften in Europa darunter auch die englische „Church Missionary Society“ verweigerten Hardeggs Bitten um Hilfe. Im Jahre 1878 gründete Hardegg mit den anderen ausgetretenen Templern den Tempelverein, später der „Reichsbrüderbund“. Nach Hardeggs Tod im folgenden Jahr schwand der Zusammenhalt seiner Anhänger. Über das letzte Jahr Hardeggs in Haifa wird berichtet, dass: „von der Bogenhalle seines Hauses in Haifa aus schaute er lang und gerne über die Meeresweite. Suchte er wohl in überirdischer Ferne, was ihm im Leben nicht gewährt worden – die Menge des Volkes, das seinem Ruf hätte folgen sollen…“
Georg David Hardegg starb am 10. Juli 1879 in Haifa und wurde auf dem Templerfriedhof begraben. Sein Grab kann bis heute in Israel besucht werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hardegg-georg-david (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hartenstein, Karl
-
Von: Quack, Jürgen
Karl Hartenstein (1894-1952)
-
Karl Hartenstein und seine Frau Margarete, 1926
Archiv der Basler Mission, QS-30.023.0008
1926 suchte die Basler Mission nach einem neuen Direktor. Verschiedene Namen wurden genannt, u.a. der Stuttgarter Oberkirchenrat Eduard Knapp. Der empfahl jedoch stattdessen Karl Hartenstein (geb. 1894), der seit 1923 Pfarrer in Urach war: „Zweifellos eine der erfreulichsten Gestalten in der jüngeren Theologengeneration, unter schweren Kriegserlebnissen früh gereift, während seiner Tübinger Zeit Vertrauensmann vieler Studenten, wissenschaftlich auf der Höhe, in Bengel verwurzelt, von Kierkegaard und Barth stark beeinflusst, auf der Kanzel ein Zeuge, ein treuer Seelsorger, bei den Gemeinschaften gut angeschrieben, auch von solchen, die theologisch anders stehen, geachtet, ein feinfühliger, liebenswürdiger Mensch, kurz: Ich würde ihm volles Vertrauen entgegenbringen und mich für unsere Basler Mission von Herzen freuen.“
So wählte das Komitee den erst 32-jährigen Hartenstein zum Direktor der größten evangelischen Mission auf dem europäischen Festland. Schon als Theologiestudent war er im Ersten Weltkrieg Befehlshaber einer Artillerie-Abteilung geworden, auf seiner Pfarrstelle in Urach hatte er Initiative und Durchsetzungskraft bewiesen.
Als Leiter der Basler Mission setzte sich Hartenstein besonders für die Selbständigkeit der aus der Mission herauswachsenden einheimischen Kirchen in Afrika und Asien ein. Er wurde zur wichtigsten Stütze der Bekennenden Kirche in der Missionsbewegung und bewahrte sie vor einer Eingliederung in die von den Deutschen Christen kontrollierte Reichskirche.
Bei Kriegsausbruch legten er und alle Deutschen ihre Leitungsämter in der Basler Mission nieder, um zu verhindern, dass die Engländer und Franzosen die Basler Mission als „deutsche“ Organisation behandelten, ihren Besitz in Übersee beschlagnahmten und die Missionare auswiesen – wie sie es im Ersten Weltkrieg getan hatten.
Er ging als „Bevollmächtigter“ der Basler Mission nach Deutschland zurück. Die Landeskirche berief ihn 1941 zum Prälaten in Stuttgart und Stellvertreter des Landesbischofs Theophil Wurm. Er vertrat die Landeskirche 1948 bei der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam und wurde Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hartenstein starb 1952. Bis zu seinem Tod war er Leiter der „Deutschen Heimatgemeinde“, die sich 1954 als „Basler Mission – Deutscher Zweig“ organisierte.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hartenstein-karl (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hebich, Samuel
-
Von: Quack, Jürgen
Samuel Hebich (1803-1868)
-
Samuel Hebich
BMDZ
Der 1803 als Pfarrerssohn in Nellingen bei Ulm geborene Samuel Hebich lernte den Beruf des Kaufmanns und machte für eine Lübecker Firma Geschäftsreisen nach Schweden, Finnland und Russland. Aber sein Wunsch, Missionar zu werden, wurde immer größer. Aus Geldmangel lehnte die Basler Mission zunächst seine Aufnahme ab. Nur eine große Spende einer finnischen Missionsfreundin ermöglichte seine Ausbildung.
Hebich reiste 1834 mit zwei Kollegen nach Südindien aus. Mit der Kannara-Sprache hatte er es schwer – aber in engem Kontakt mit den Menschen war er wie kaum ein anderer Missionar. Seine Art zu predigen, zu lehren und zu ermahnen löste bei den einen Respekt, bei anderen Spott aus. Hebich verhielt sich allen Menschen gegenüber gleich, ohne Standesunterschiede zu machen. Er sprach Leute auf der Straße und in ihrem eigenen Haus an, um sie zum Glauben zu ermahnen, Fürsten wie einfache Arbeiter und Bettler. Bekannt als „Bartmann“ zog er zahlreiche Zuhörer auf Märkten und am Rande hinduistischer Feste an. Auch für viele englische Soldaten wurde er zum Prediger und Seelsorger.
Da die indischen Christen durch die Taufe in der Regel aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wurden, war es der Basler Mission wichtig, Arbeitsmöglichkeiten für sie zu schaffen. Landwirtschaftliche Projekte mit Kaffee und Zucker schlugen fehl, aber die handwerklichen Betriebe schufen hunderte Arbeitsplätze. Hebich gründete Schulen, Webereien und Schreinereien. Sehr bekannt wurden die Ziegeleien, deren Produkte als besonders haltbar galten.
Der „Langbart“, der 25 Jahre ohne Heimaturlaub in Indien tätig war, ist dort nicht vergessen. In der Stadt Kannur (früher Cannanore) ist eine Kirche nach ihm benannt, in Mangalore eine Berufsfachschule. Beide gehören zur „Kirche von Südindien“, die aus der Arbeit von Samuel Hebich und seinen Freunden herausgewachsen ist.
1859 kehrte er wegen seiner angeschlagenen Gesundheit nach Europa zurück. Nach einigen Jahren als Reiseprediger starb er 1868 in Stuttgart und wurde in Korntal beerdigt.
Auch in seinem Heimatort Nellingen ist er nicht vergessen. Ein Straßenname und eine Tafel am Pfarrhaus erinnern an den originellen Prediger, eindringlichen Seelsorger und erfolgreichen Entwicklungshelfer.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hebich-samuel (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hedinger, Johann Reinhard
Johann Reinhard Hedinger (1664-1704)
-
Johann Reinhard Hedinger
gemeinfrei (Quelle: Württembergische Landesbibliothek)
Er übertrug zu Beginn des 18. Jahrhunderts die frühe pietistische Theologie Philipp Jakob Speners nach Württemberg und verfasste als Hofprediger wichtige Lehrbücher zu den kirchlichen Handlungsfeldern im Geist des Pietismus.
Am 7. September 1664 wurde Hedinger in Stuttgart als Sohn eines Hofjuristen und einer Prälatentochter geboren. Nach den Klosterschulen Hirsau und Bebenhausen kam er 1681 zum Studium ins Tübinger Stift. Anschließend machte er eine große Bildungsreise, auf der er auch die Pflanzstätten sowie die Begründer der pietistischen Bewegung, Philipp Jakob Spener in Frankfurt und August Hermann Francke in Halle besuchte. Danach wurde er Reise- und Feldprediger des württembergischen Herzoghauses. 1694 verheiratete er sich mit Christina Barbara, geb. Zierfuß (1674 – 1743), aus Kirchheim/Teck. Im gleichen Jahr ging Hedinger als Professor für Naturrecht nach Gießen, bevor er 1699 zum Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart berufen wurde. Seine besondere Stellung am Hof, bei der er Zugang zu allen Ständen hatte, nutzte er zu seelsorgerlicher Arbeit und deutlicher Kritik am Herzog und seiner aufwändigen Hofhaltung. In seiner Antrittspredigt rief er dem Herzog zu: „Rette, Fürst, deine Seele!“
Praktischer Theologe
Hedinger verfasste die ersten praktisch-theologischen Werke des württembergischen Pietismus: In seiner Predigtlehre mahnte er ein gründliches Bibelstudium an und lehnte rhetorische Kunststücke des Barock ab: „Ist denn der Heilige Geist eine Taube oder ein Papagei?“ Weiter entwickelte er eine eindrückliche Seelsorgelehre, in der er auch sensibel auf das Krankheitsbild der Depression einging. Er setzte durch, dass ein Stuttgarter Hofmusiker nach seiner Selbsttötung ordentlich bestattet wurde. Seine Katechetik enthält außergewöhnliche pädagogische Einsichten in die Entwicklung des Kindes und eigene Lehrpläne für die Mädchen. Die Einführung der Konfirmation in Württemberg 1723 folgte einem gottesdienstlichen Entwurf Hedingers von 1701, in dem die Segnung der Jugendlichen im Vordergrund steht. Da er auch als Liederdichter und Bibelkommentator tätig war, kann er als erster praktischer Theologe des württembergischen Pietismus gelten.
Seine Lebenszeit zwischen der Pracht des Barock und dem Geist des frühen Pietismus war kurz: Hedinger starb mit vierzig Jahren am 28. Dezember 1704 in Stuttgart. Lange noch wurden die Anekdoten von seinem Glaubensmut vor Fürstenthronen im Land weitererzählt und seine theologischen Werke als Unterrichtsbücher für Theologen verwendet.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hedinger-johann-reinhard (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hesse, Johannes
JOHANNES HESSE (1847-1914)
Johannes Hesse wurde 1847 als Sohn eines Arztes im heutigen Estland geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Reval (heute: Tallinn) ging er nach Basel, wo er zum Missionar ausgebildet wurde. 1869 wurde er nach Indien entsandt. Da er das tropische Klima nicht vertrug, musste er vier Jahre später nach Deutschland zurückkehren.
Er wurde nach Calw geschickt, wo der ehemalige Indienmissionar Hermann Gundert den von Christian Gottlob Barth gegründeten Calwer Verlag leitete. Zunächst war Hesse für die dort erscheinenden Missionszeitschriften verantwortlich, nach Gunderts Tod übernahm er 1893 deren Leitung.
Hesse war auch selbst schriftstellerisch tätig und veröffentlichte mehrere Bücher. Weit verbreitet waren „Vom Segensgange der Bibel durch die Heidenwelt“, „Das Missionsjahrhundert“ und „Frühlingswehen in der Völkerwelt: 45 Missionsgeschichten“. Hilfreich für viele Pfarrer wurde „Mission auf der Kanzel“. Dazu schrieb er die Biographien seines Schwiegervaters und des Inspektors Josenhans. Er war auch Herausgeber des „Evangelischen Missions-Magazins“, der weit verbreiteten Fachzeitschrift der Basler Mission.
In Calw lernte er Gunderts Tochter Marie kennen. Sie war 1842 in Indien geboren worden und 1862 mit ihren Eltern zurückgekehrt; sie half ihrem Vater bei der Verlagsarbeit mit Übersetzungen aus dem Englischen. Dabei lernte sie den englischen Missionar Charles W. Isenberg kennen, mit dem sie 1865 erneut nach Indien ging. Die Lungentuberkulose ihres Mannes zwang sie zur Rückkehr nach Deutschland, wo Isenberg 1870 starb.
Die junge Witwe wurde die erste Englischlehrerin an einer höheren Schule in Württemberg. Dort lernte sie Johannes Hesse kennen. Sie heirateten 1874 und hatten sechs Kinder. Das zweite Kind war der später berühmte Schriftsteller Hermann Hesse, der 1877 geboren wurde.
Nach dem Tod seiner Frau 1902 zog Johannes Hesse 1905 mit seiner Tochter Marie, genannt Marulla, nach Korntal. Diesem Ort, der damals eng mit der Basler Mission verbunden war, widmete er das Buch „Korntal einst und jetzt“. Marulla blieb auch nach dem Tod ihres Vaters 1916 in Korntal und arbeitete dort als Erzieherin. Auf dem alten Korntaler Friedhof, auf dem auch viele Missionare begraben sind, erinnert ein gemeinsamer Grabstein an Vater und Tochter.
Da sowohl seine Großeltern als auch seine Eltern in Indien gewirkt hatten, hatte Hermann Hesse stets eine besondere Beziehung zu Indien. Auf einer Asienreise 1911 kam er zwar nur bis Ceylon, aber in seinen Büchern „Aus Indien“ (1913) und „Siddartha“ (1922) setzt er sich mit den religiösen Traditionen Asiens auseinander.
Über seinen Vater schrieb Hermann Hesse: „Unser Vater ... hat bis zu seinem Tode von den Mundarten, die um ihn herum und auch von seiner Frau und seinen Kindern gesprochen wurden, nichts angenommen, sondern sprach in unser Schwäbisch und Schweizerdeutsch hinein sein reines, gepflegtes, schönes Hochdeutsch. Dieses Hochdeutsch, obwohl es für manche Einheimische unser Haus an Vertraulichkeit und Behagen einbüßen ließ, liebten wir sehr und waren stolz darauf, wir liebten es.“
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hesse-johannes (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hiller, Philipp Friedrich
-
Von: Schnürle, Joachim
Philipp Friedrich Hiller (1699-1769)
-
Philipp Friedrich Hiller (1699-1769)
Wikimedia Commons
Der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller ist mit seinen Werken heute nach wie vor im Evangelischen Gesangbuch präsent. Sein Himmelfahrtslied „Jesus Christus herrscht als König" ist eines der bedeutendsten Lieder der deutschsprechenden Christenheit zu diesem Kirchenfest. Es ist eines von insgesamt über 1000 Liedern aus seiner Feder – 1070 wurden gezählt und als „großer Hiller"(1) auch gesammelt gedruckt.
Geboren wurde Hiller am 6. Januar 1699 als Pfarrerssohn in Mühlhausen an der Enz und starb mit 70 Jahren am 24. April 1769 in Steinheim bei Heidenheim. Bis auf eine kurze Periode 1729 bis 1731 in Nürnberg, hat er Zeit seines Lebens im Schwabenland verbracht. Früh wurde der Junge Halbwaise – als er noch nicht zwei Jahre alt war, starb der Vater. Der Stiefvater ermöglichte ihm den Besuch der Lateinschule in Vaihingen an der Enz und anschließend ab 1713 der Klosterschule Denkendorf.In Denkendorf kam es zur Begegnung mit Johann Albrecht Bengel (1687-1752), der fortan der väterliche Freund und Ratgeber von Philipp Friedrich wurde. Schon dort in der Klosterschule fiel der Pfarrerssohn durch seine musikalische und dichterische Begabung auf. Nach der weiteren Station auf dem Weg zum Theologiestudium in der Klosterschule in Maulbronn 1716, konnte er ab 1719 über das Stift-Stipendium in Tübingen evangelische Theologie studieren.
Nach einer Vikariatszeit in Schwaigern, kam dann das Intermezzo im fränkischen Ausland, als Hauslehrer in Nürnberg von 1729 bis 1731. In dieser Zeit beschäftige sich Hiller mit dem Gebetbuch des Johann Arndt (1555-1621) – daraus entstand das erste gedruckte Werk von Philipp Friedrich: Johann Arndts Paradiesgärtlein geistreicher Gebeter und Lieder. Die Gebete Arndts sind in 301 Lieder umgeformt.
Ende 1731 kam Hiller dann als Vikar nach Hessigheim am Neckar. Die dortige Pfarrerstochter wurde im Folgejahr 1732 seine Frau. Hiller war dann als Pfarrer in Neckargröningen, seinem Geburtsort Mühlhausen an der Enz und seit 1748 in Steinheim bei Heidenheim. In diesen Jahren kam es nur zu einer weiteren Veröffentlichung: Gott=geheiligte Morgen=Stunden zur poetischen Betrachtung des Thaues, nach etlichen Sprüchen heiliger Schrift angewendet, Tübingen, Löffler, 1748 – mehr Zeit blieb wahrscheinlich nicht, was im Zusammenhang mit seinen pastoralen Aufgaben als Gemeindepfarrer und der Gründung einer Familie zu sehen ist.
Persönliche Leiderfahrungen
Manche familiäre Not begegnete dem Dichterpfarrer. Seine Frau, die Mutter von sieben Kindern war, wurde mehrmals so schwer krank, dass man nicht mit ihrem Überleben rechnen konnte. Hiller selbst traf 1751 ein schwerer Schlag: Infolge eines Halsleidens verlor er innerhalb kurzer Zeit trotz aller ärztlichen Bemühungen seine Stimme. Er konnte nicht mehr predigen, was ihm eine große innere Not bereitete. Eine leichte Besserung führte dazu, dass er im Folgejahr wieder aus der Nähe verstanden werden konnte. Zur Predigt jedoch blieb er untüchtig.(2) Die Pfarrstelle konnte er nur dadurch weiter behalten, weil ihm ein Vikar zu Seite gestellt war, der für ihn die Predigttätigkeit übernahm. Seelsorgerliche Kontakte besorgte Hiller weiterhin selbst. Zudem nutzte er die Zeit zu vertieftem Bibelstudium und zu seinem dichterischen Arbeiten.
In den nächsten Jahren hat er mehrere theologische Ausarbeitungen drucken lassen, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem Alten Testament bekunden: Das Leben Jesu Christi, des Sohnes Gottes, unsers Herrn, in gebundener Schreibart nach den einstimmigen Schriften der heiligen Evangelisten verfasset (1752), und Neues System aller Vorbilder Jesu Christi durch das ganze Alte Testament: in ihrer vollständigen Schriftordnung und verwunderlichen Zusamenhang nach den beeden Oekonomiezeiten, zur Verehrung der göttlichen Weisheit; aufgestellt in sechs Schattenstücken samt einem Anhang und Beleuchtung (1758).
-
Liederkästlein. Ausgabe von 1831
Landeskirchliches Archiv. Museale Sammlung. Inv.-Nr. 93.937
Das Geistliche Liederkästlein
Das Geistliche Liederkästlein, die bekannteste Schrift von Philipp Friedrich Hiller ist in seiner „sprachlosen" Zeit entstanden. Der theologische Inhalt ist sicher im Hinblick auf das körperliche Gebrechen, das mit der Behinderung bzw. Verhinderung der Sprache das wesentliche Organ der Berufsausübung des Pfarrers betraf, zu sehen. Die geistliche Dichtung Hillers in dieser letzten Lebensphase kann auch verstanden werden als eine Therapie an der eigenen Seele. Sie kann vom Glauben her verstanden werden als Seelsorge Gottes an der Seele dieses Pfarrers, dessen Wirken trotz allen Leidens in Freude, Lob Gottes und Anbetung mündet. Es kann eine Parallelität zu den Leidenspsalmen Davids gesehen werden, der in der Anrufung Gottes und im Klagen durchdringt zu Lob und Anbetung. Auch bei Hiller ist eine weitere Bestimmung des Anteils der eigenen „Leidensarbeit" und dem göttlichen Wirken als Antwort auf die Anrufung Gottes an der gewonnen Zuversicht schwer möglich. Im ersten Teil des Liederkästleins, der 1762 erschienen ist, schreibt der Dichter in der Vorrede: „Mir ist‘s eine Freude, an dem Wort Gottes auf besondere Weise zu dienen, da ich es öffentlich nun nicht mehr tun kann. - Ich vermeinte, dass wir an solchen Liedern, die eigentlich vom Lob Gottes handeln, in Gesangbüchern und sonst keinen Überfluss haben."(3)
Je einem Bibelvers folgt ein kurzer Gedanke dem ein Lied meist mit zwei bis sieben Strophen folgt, die hauptsächlich auf die Anbetung Gottes, auf das Lob seiner Eigenschaften sowie seine Worte und Wohltaten gerichtet sind. Der zweite Teil erschien 1767, also zwei Jahre vor dem Tod des damals 68-jährigen. Der Hauptinhalt ist das Erwarten der Zukunft des Heilandes Jesus Christus. Wiederum ist er aufgebaut aus einem Bibelvers mit kurzer Bemerkung und einem Lied. Fern ist dieser Teil jedoch von einem lebensmüden Jenseitshoffen, einer depressiven Sehnsucht nach dem Tod. Vielmehr wird der Blick auf das Wiederkommen des Herrn gerichtet, was das Heil vollkommen macht, und auch dem körperlich Angefochtenen, den Blick auf die Endlichkeit von Krankheit und Leid verdeutlicht. Darin sind Hauptthemen der biblischen Botschaft und des biblischen Trostes aufgenommen, die auch heute noch Aktualität haben. Am Ende enthält das Liederkästlein je ein Morgen- und Abendgebet nach den sieben Bitten des Vaterunsers für jeden Wochentag.
-
Liederkästlein. Ausgabe von 1904
Landeskirchliche Zentralbibliothek. Sign.: A 13, 751
Verbreitung des Geistlichen Liederkästleins
In der letzten Ausgabe von Hillers Geistliches Liederkästlein aus dem Jahre 2009 wird diese als 17. Auflage ausgegeben. Doch schon bei der orientierenden Durchsicht der Bibliographie von Gottfried Mälzer zu Drucken der württembergischen Pietisten finden sich bereits 40 Ausgaben des Geistlichen Liederkästleins - und diese hat nicht alle Drucke erfasst.(4) Neben den Stuttgarter Ausgaben des 18. Jahrhunderts lassen sich dann im 19. Jahrhundert mehrere Druckorte eruieren. So wurden weiterhin in Stuttgart bei dem Verlag Macklot und später bei der Evangelischen Bücherstiftung sowie bei Ernst Rupfer Ausgaben des Liederkästleins gedruckt, aber auch in Reutlingen, der Hochburg des Nachdrucks im 19. Jahrhundert finden sich Drucke von den Verlagen Christoph Jakob Friedrich Kalbfell, Lorenz, Carl Fischer Jun., B. G. Kurz, Rupp & Baur und schließlich Enßlin & Laiblin. Letztere hatten keine Auflagen oder Druckjahre angegeben, so dass man bis 1924 nur eine Mindestzahl der Auflagen schätzen kann, die in Reutlingen alleine 25 Auflagen betrug, wahrscheinlich aber eher um 30 Auflagen liegen müsste bei fehlender Kennzeichnung durch Enßlin & Laiblin. In Stuttgart wurden im 18. und 19. Jahrhundert mindestens 22 Auflagen gedruckt, wobei vom Verlag Rupfer ebenfalls keine Druckjahre oder Auflagen angegeben wurden und von einer höheren Auflagenzahl auszugehen ist.
Nach dem 2. Weltkrieg finden sich erneut Drucke in Reutlingen, von der Philadelphiabuchhandlung August Fuhr in den Jahren 1950, 1958, 1965, die dann abgelöst wurden vom Verlag Ernst Franz in Metzingen in den Jahren 1976, 1982, 1986 und 1994 und der aktuellen Auflage in Bad Wildbad von 2009. Insgesamt sind somit mindestens 55 Auflagen gedruckt worden, wahrscheinlich aber eher über 60 Auflagen.
Das Geistliche Liederkästlein gewann seit seiner Entstehung im 18. Jahrhundert anhaltende Bedeutung, indem seine Texte Eingang in die Erbauungsstunden der Gemeinschaften des schwäbischen Pietismus fanden. Die Pregizer Gemeinschaft machte es zu ihrem Gesangbuch und bei vielen frommen Auswanderern war es neben der Bibel eines der wenigen Bücher im Gepäck, das sie auf die Reise nach Amerika, Russland Bessarabien, Georgien, Ungarn oder Israel mitnahmen. So wurde das Geistliche Liederkästlein zum Trostbuch für viele Menschen in aller Welt. Ins offizielle Kirchengesangbuch wurden Hillers Lieder erst 1842 auf Initiative von Pfarrer Albert Knapp (1798-1864) aufgenommen. Heute enthält das Evangelische Gesangbuch vier Lieder mit Texten von Hiller.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Martin Brecht (Herausgeber): Gott ist mein Lobgesang. Philipp Friedrich Hiller (1699–1769) der Liederdichter des württembergischen Pietismus. Metzingen (Württ.): Ernst Franz Verlag 1999
Johannes Fischer: Philipp Friedrich Hiller und die Pregizer Gemeinschaft. In Gott ist mein Lobgesang, 1999, S. 172-94.
Hans-Dieter Frauer, Christian Gottlob Pregizer (1751-1824), Ungewollt eine Gemeinschaft gegründet. In: Unvergessen – Gedenktage 1999, herausgegeben von Kurt Rommel, 1998, S. 120-24.
Joachim Schnürle: Man duldet Gott zu Lobe und rühmt sich seiner Huld! 250 Jahre Hillers Liederkästlein. Deutsches Pfarrerblatt 112 (11), 2012: 649-651.
Joachim Schnürle: „Daher machte ich über so viele Sprüche, als Tage im Jahr sind, eine kleine Ode…“, Philipp Friedrich Hillers Geistliches Liederkästlein –Was ist das Erfolgsrezept? Jahrbuch für Evangelikale Theologie 27, 2013: 167-186.
Bildnachweise
-

- Philipp Friedrich Hiller (1699-1769)
Philipp Friedrich Hiller (1699-1769)
Wikimedia Commons
-

- Liederkästlein. ausgabe von 1831
Liederkästlein. Ausgabe von 1831
Landeskirchliches Archiv. Museale Sammlung. Inv.-Nr. 93.937
-

- Liederkästlein. Ausgabevon 1904
Liederkästlein. Ausgabe von 1904
Landeskirchliche Zentralbibliothek. Sign.: A 13, 751
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hiller-philipp-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hinderer, David
-
Von: Quack, Jürgen
Inhaltsverzeichnis
David Hinderer (1819-1890)
-
David Hinderer (1819-1890)
Archiv der Basler Mission und hat die Signatur QS-30.001.0195.01
Die anglikanische St. David’s Cathedral in Ibadan (Nigeria) trägt ihren Namen als Erinnerung an den Missionar David Hinderer, geb. am 29. Oktober 1819 in Berglen-Birkenweißbuch bei Schorndorf. Er war der erste Bote des Evangeliums in dieser Stadt mit heute 3 Millionen Einwohnern im Süden von Nigeria.
1: Ausbildung
David Hinderer lernte den Beruf des Leinewebers und kam als Jugendlicher in pietistische Kreise, wo er Berichte aus der Mission hörte. Seine erste Bewerbung für die Aufnahme in das Basler Seminar schrieb er 1837 mit 18 Jahren. In einem Begleitbrief riet der Stuttgarter Pfarrer Wilhelm Hofacker, ihn noch nicht aufzunehmen, weil er noch sehr in der Entwicklung sei, ihn aber im Auge zu behalten. Zwei Jahre später bewarb er sich erneut und wurde aufgenommen. Aber zunächst musste er seine Musterung zum Militärdienst abwarten. Da er nicht eingezogen wurde – wahrscheinlich weil er nicht die erforderliche Körpergröße hatte – konnte er 1841 nach Basel gehen.
Nach Abschluss der Ausbildung wurde er 1846 der englischen Church Missionary Society (CMS) zur Verfügung gestellt. Nach einer weiteren Ausbildung in deren Seminar in Islington wurde er zum anglikanischen Priester geweiht und im Januar 1849 nach Westafrika ausgesandt, wo auch viele andere Basler Missionare im Dienst der CMS tätig waren.
2: Entsendung nach Nigeria
Er nahm aus London eine große Menge Neuer Testamente in der Hausa-Sprache mit, da er den Auftrag bekam, in das Gebiet der Hausa im Landesinneren des heutigen Nigeria vorzudringen. Er hatte die Vision, dass von dort aus eine Kette von Missionsstationen am Südrand der Sahara bis nach Ostafrika errichtet würde, wo die CMS schon in Äthiopien wirkte.
Jedoch zeigte es sich, dass der Widerstand unter den muslimischen Hausa so groß war, dass sich die Mission zunächst auf die Arbeit unter den in Küstennähe lebenden Yoruba sprechenden Stämme beschränken musste.
Die verschiedenen Gruppen der Yoruba kämpften immer wieder um Einfluss und Hegemonie. Gegenseitige Überfälle und Plünderungen waren häufig. Das wichtigste Handelsgut waren Kriegsgefangene, die als Sklaven auf die Felder geschickt oder verkauft wurden. Der Sklavenhandel nach Amerika war schon lange verboten, aber im Landesinneren noch weit verbreitet. Lohnarbeit war nicht bekannt, das Wirtschaftssystem beruhte auf der Sklavenarbeit.
Die Missionare propagierten ein friedliches Leben und ein Engagement in der Landwirtschaft. Hinderers Kollege Karl Gollmer aus Kirchheim/Teck veranstaltete z.B. eine Landwirtschaftsmesse mit Preisen für die besten Produkte. Die Missionare warben auch für den Export von Baumwolle und Palmöl nach England als „legitimen Handel“ anstatt des Sklavenhandels.
Sie gründeten zahlreiche Schulen, in Abeokuta auch eine Oberschule, wo unter der Leitung des ebenfalls aus Württemberg stammenden Gottlob Bühler künftige einheimische Pfarrer in Latein und Griechisch unterrichtet wurden.
3: Missionarisches Wirken in Ibadan
David Hinderer war zunächst in Abeokuta tätig, zog aber nach der Heirat mit der Engländerin Anna geb. Martin 1853 in die Stadt Ibadan im Landesinneren, ca. 150 km von der Küste entfernt. Die Machthaber in der Stadt befragten allerdings erst ein lokales Orakel, ob sie der Ansiedlung von weißen Menschen zustimmen sollten. Als das Orakel die Frage bejahte, wurden sie willkommen geheißen, konnten Land erwerben und mit dem Bau eines Hauses – des ersten zweistöckigen Hauses in der damals ca. 50.000 Einwohner zählenden Stadt - beginnen. Im Erdgeschoss waren die Vorratsräume, auf der großen Veranda im ersten Stock begannen sie eine Schule. Sie waren viele Jahre die einzigen Europäer in der Stadt. Seine Mitarbeiter holte er vor allem aus Sierra Leone aus den von den Engländern befreiten und dort angesiedelten Sklaven, die zum großen Teil Christen geworden waren. Sie suchten das Gespräch mit den Bewohnern der Stadt und predigten auf den Straßen.
Außerdem gründeten sie eine Schule. Auch in den eigenen Haushalt nahm das Ehepaar, das keine eigenen Kinder hatte, bis zu 30 Kinder auf – teils Waisenkinder, von denen es durch die häufigen Kriegszüge viele gab, teils freigekaufte Sklaven, teils Kinder vornehmer Afrikaner, die eine westliche Bildung für ihre Kinder wollten.
Durch jahrelange Stammeskriege war Ibadan lange Zeit von der Küste und allem Nachschub abgeschnitten. Um zu überleben und um ihre Arbeit weiter betreiben zu können, mussten Hinderers einiges von ihrem Inventar verkaufen. Sie bekamen auch Spenden von reichen Ibadanern, die ihre soziale Arbeit schätzten.
Die entstehende kleine christliche Gemeinde erfuhr aber auch viel Ablehnung, da Hinderer sowohl gegen die im Landesinneren noch weit verbreitete Sklaverei wie gegen die allgemeine Kriegslust und Gewaltverherrlichung predigte. Soweit er es als Fremder und Gast in der Stadt tun konnte, sprach er sich auch gegen die traditionellen Menschenopfer vor den Kriegszügen aus.
4: Letzte Jahre und Erinnerung an ihn in Nigeria
-
St. David‘s Cathedral Ibadan im Jahr 2022
Foto: Folu Oyefeso, Nigeria
Wegen der angegriffenen Gesundheit von Anna Hinderer kehrte das Ehepaar 1869 nach England zurück, wo David eine Pfarrstelle in Martham, Norfolk, übertragen wurde. Nach dem Tod seiner Frau 1870 kehrte er nach Afrika zurück und gründete zwei weitere Missionsstationen. Er setzte sich sehr für die Ausbildung von einheimischen Mitarbeitern ein. 1877 kehrte er endgültig nach Europa zurück und starb am 16.9.1890 in Bornmouth, England.
In Ibadan blieb er vor allem als Mahner zum Frieden und Gegner der Sklaverei in Erinnerung. Als Ibadan später Bischofssitz wurde und eine größere Kirche gebaut wurde, gaben die Ibadaner Christen ihr den Namen St. David – zur Erinnerung an David Hinderer. Auch eine Schule trägt seinen Namen. Ebenso gibt es eine St. Anna-Kirche und eine St. Anna-Schule zur Erinnerung an seine Frau.
Auch wenn er nach der Ausbildung in Basel für die anglikanische Mission und Kirche tätig war, blieb er sein Leben lang mit seiner „lieben Mutter, der Basler Missionsgesellschaft“ verbunden und schickte ihr jedes Jahr einen Beitrag.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Uwe Jens Wandel und Gudrun Emberger, David Hinderer (1819-1890) von Birkenweißbuch nach Ibadan. Von Familie, Jugend und Bekehrung eines württembergischen Missionars. BWKG Jg. 119, 2019, S. 689 - 708
Weiterführende Links
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hinderer-david (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Hoffmann, Christoph
-
Von: Eisler, Jakob
Christoph Hoffmann (1815-1885)
-
Christoph Hoffmann (1815-1885) mit seiner Frau Pauline, geborene Paulus
Archiv der Tempelgesellschaft Stuttgart
Christoph Hoffmann, Sohn des Gründers der Korntaler Brüdergemeinde Gottlieb Wilhelm Hoffmann, wurde am 02. Dezember 1815 in Leonberg geboren. Hoffmann selbst gründete dann später die Tempelgesellschaft, die aus der pietistischen Bewegung Württembergs hervorging. Hoffmanns religiöse Erziehung in Korntal und sein Theologiestudium an der Tübinger Universität prägten nachhaltig seine Vorstellungen von Glauben, Gesellschaft und Kirche(1). Nach Beendigung seines Studiums arbeitete Hoffmann mehrere Jahre als Lehrer im „Salon“ in Ludwigsburg, der Erziehungsanstalt der Gebrüder Paulus.(2). Der „Salon“ sollte die angeblich irreführenden Lehren der evangelischen Kirche bloßlegen und einen reinen und einfachen Glauben im ursprünglichen Sinne Jesu vermitteln. Man glaubte streng an das geschriebene Wort der Bibel und daran, dass das „Volk Gottes“ Jerusalem als Zentrum eines neuen Reiches Gottes aufbauen werde. Um diese Idee gegen die Position der etablierten evangelischen Presse zu verbreiten, gründete man eine eigene Zeitung: „Die Süddeutsche Warte, religiöses und politisches Wochenblatt für das deutsche Volk“(3).
Hoffmann wurde im Jahre 1848 im Oberamt Ludwigsburg als Abgeordneter in die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt am Main gewählt. Nach zehn Monaten legte er, unzufrieden mit den Realitäten des politischen Alltags, sein Mandat in der Pauluskirche nieder.
Hoffmann gewann – nach seinem kurzen Intermezzo als Politiker – bald entscheidenden Einfluss auf das Publikationsorgan „Warte“. Zusammen mit Georg David Hardegg (1812–1879) entwickelte er darin den Gedanken, das „Volk Gottes“ in das Heilige Land zu führen. Hoffmann hatte ähnliche Ideen schon in seinem Buch „Stimmen der Weissagung über Babel und das Volk Gottes“ dargelegt. Hardegg ergänzte Hoffmann optimal, indem er Hoffmanns eher weltfremden Plan energisch auch in die Praxis umsetzen wollte. Bald formierte sich um Hoffmann und Hardegg eine Gruppe namens „Jerusalemsfreunde“(4).
Im Jahre 1852 zogen sich die Gebrüder Paulus von der Leitung der „Warte“ zurück, da die die Zeitung fortwährenden scharfen Angriffen seitens der evangelischen Kirche ausgesetzt war. Hoffmann wurde daraufhin Alleinherausgeber und die „Warte“ damit gleichzeitig das Organ der Jerusalemsfreunde(5). Hier entwickelte er seine Idee, seine Anhänger könnten durch beispielhafte Frömmigkeit, Bescheidenheit und Demut zum auserwählten „Volk Gottes“ avancieren. Mit diesen Auserwählten wollte er nach Jerusalem ziehen und dort einen geistigen Tempel gründen – daher der spätere Name Templer(6).
Die schwere wirtschaftliche Krise in Württemberg Anfang der 1850er Jahre erleichterte es Hoffmann, mit seinen Ideen großen Widerhall in der Bevölkerung zu finden. Von einer Auswanderung ins Gelobte Land erhoffte man sich Besserung der materiellen Lebensverhältnisse.
Um Unterstützung für die Realisierung seiner Auswanderungspläne zu gewinnen, nahm Christoph Hoffmann mit Christian Friedrich Spittler, dem einflussreichen Vorsitzenden der Basler Pilgermission St. Chrischona, Kontakt auf. Hoffmanns Engagement ging so weit, dass er sich 1853 als Inspektor der Pilgermission anstellen ließ, um einen Fuß in die etablierte (und finanziell besser abgesicherte) Missionsarbeit in Palästina zu bekommen. Aber nach zweijähriger Arbeit in Basel musste er einsehen, dass die Pilgermission ihm kaum behilflich sein konnte(7). Daraufhin gründete er in Württemberg 1856 eine Knaben- und Mädchenschule im Kirschenhardthof (einem Gehöft bei Marbach), wo er die Jugend im Geiste des „Tempels“ erziehen wollte. Aus ihrem Kreis sollten künftig Sendlinge für das Heilige Land rekrutiert werden(8).
Im Jahre 1857 beschlossen die Templer, mit Hilfe gesammelter Gelder eine Erkundungsgruppe nach Palästina zu entsenden. Im Januar 1858 reisten Hoffmann und Hardegg als Vorsteher der Gemeinde sowie Joseph Bubeck (ein diplomierter Winzer) nach Palästina. Der idealistische Hoffmann interessierte sich dort eher für heilige Stätten, während der realistische Hardegg alle praktischen Details gründlich erforschte. Die unfreundliche Haltung der Bevölkerung und der türkischen Regierung bewog sie allerdings, ihren Anhängern eine vorläufige Aufschiebung der Siedlungspläne zu empfehlen(9).
Erst 1868 sollten die Templer ins Heilige Land aussiedeln. Zu dieser Entscheidung trugen die Entwicklungen in Württemberg entscheidend bei. Auf dem Kirschenhardthof hatte Hoffmann 1859 eine Gruppe von Jugendlichen eigenmächtig konfirmiert, obwohl die Landeskirche es ihm verboten hatte. Daraufhin wurde Hoffmann aus der württembergischen Landeskirche ausgeschlossen. Aus Protest traten im Jahre 1861 alle Mitglieder der Templergemeinde aus der Landeskirche aus. So wurde der „Deutsche Tempel“ zu einer selbständigen religiösen Bewegung mit Hoffmann als „Bischof“ und Hardegg als Vorsitzendem(10). Die evangelische Kirche versuchte in den folgenden Jahren mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, die Anhänger der Templer zu bekämpfen, aber ohne Erfolg(11).
Hoffmann und Hardegg reisten mit ihren Familien 1868 nach Palästina, wo an ihrem Ankunftsort Haifa die erste Ansiedlung entstand; Im Jahre 1869 folgte Jaffa, 1871 Sarona und 1873 die Kolonie in der Rephaim-Ebene vor den Stadttoren Jerusalems. Landwirtschaftliche Siedlungen in unmittelbarer Nachbarschaft von Städten und gute Schulen bildeten die Grundlage. Die eschatologischen Hoffnungen wichen bald nüchterneren Erkenntnissen. Der ursprüngliche Gedanke die Welt zu erneuern, wurde von vorbildlicher christlich-sozialer Siedlungsarbeit verdrängt. Hoffmann zog 1869 nach zunächst nach Jaffa und erst 1877 „wagte er den Schritt nach Jerusalem zu gehen“. Dort wurde das Tempelstift gegründet, das Hoffmann bis zu seinem Tod am 8. Dezember 1885 leitete. Sein Grab findet sich noch heute auf dem Templerfriedhof in Jerusalem.
Zwar konnte Hoffmann seine Ideen innerhalb der christlichen Kirche nicht umsetzen, das Siedlungswerk der Templerkolonien jedoch hatte großen Impact auf die spätere Entwicklung des Heiligen Landes und aller seiner Bewohner.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/hoffmann-christoph (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Huppenbauer, David
-
Von: Quack, Jürgen
David Huppenbauer (1855-1926)
-
Das Ehepaar Huppenbauer
Archiv der Basler Mission, QS-30.141.0003
1879 reiste David Huppenbauer (1855-1926) an die Goldküste, dem späteren Ghana, aus. Geboren wurde er in Untertürkheim, aufgewachsen ist er in Schorndorf. Die Familie war der Basler Mission eng verbunden: Ein Onkel wirkte im Kaukasus, zwei jüngere Geschwister folgten David Huppenbauer nach Westafrika. 1881 heiratete er die Schweizerin Lydia Plüss. An den Folgen der Geburt des ersten Kindes erkrankte sie so sehr, dass die Familie 1884 nach Europa zurückkehren musste.
David Huppenbauer wurde Heimatmissionar in der Schweiz. Dabei lernte er den Stuttgarter Fabrikanten Paul Lechler kennen, der in Freudenstadt ein christliches Erholungsheim errichten wollte. Ein Grundstück hatte er schon gekauft, nun suchte er einen Heimleiter. Das wurde David Huppenbauer von 1994 bis 1926.
-
Das Kurhaus Palmenwald
Foto: Kalmbach/BMDZ
Über 30 Jahre lang hat er in täglichen Andachten und sonntäglichen Gottesdiensten – für die neben dem Hotel eine große Kapelle gebaut wurde – Gottes Wort ausgelegt. Er wurde Gesprächspartner und Seelsorger für unzählige Gäste – darunter auch Professoren, Minister und sogar König Wilhelm II. von Württemberg. Gut besucht waren auch die Haushaltskurse zur Ausbildung junger Frauen.
Der Kontakt zur Basler Mission blieb eng. Seine beiden Söhne gingen beide an die Goldküste zurück – der eine als Arzt, der andere als Missionar. Und später auch ein Enkel.
Das Haus von Paul Lechler bekam den Namen „Palmenwald“ nach den Stechpalmen im benachbarten Stadtwald, aber oft genug entführte auch der Missionar Huppenbauer seine Gäste in seinen Andachten unter die Palmen Afrikas. Er tat das nach seinem Motto „Lachen dürfen die Menschen in der Kirche, nur nicht schlafen“.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/huppenbauer-david (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Leiningen, Amalia Hedwig von
-
Von: Fritz, Eberhard
Anna Hedwig von Leiningen (1684-1756)
Amalia Hedwig von Donop wurde am 12. Januar 1684 auf Gut Donop in Westfalen, dem Stammsitz der Familie, geboren. Ihr Vater Levin Moritz von Donop zu Wöbbel und Borkhausen (1636-1695) bekleidete als Geheimer Rat, Landdrost und Kammerpräsident eine hohe Stellung in der Grafschaft Lippe. In zweiter Ehe heiratete er die Tochter eines hohen württembergischen Hofbeamten, Maria Juliane Bouwinghausen von Wallmerode (1663-1707). Deren Vater Heinrich Achilles Bouwinghausen von Wallmerode zu Macholach (1615-1685) gehörte dem reichsritterschaftlichen Adel an und besaß im Herzogtum Württemberg mehrere Güter. Er hatte 1649 den Ihinger Hof bei Renningen gekauft, ein abgelegenes Gut. Nach seinem Tod erbte die Enkelin Amalia Hedwig einige dieser Güter, darunter den Ihinger Hof und das Gut Ramstein. Sie heiratete 1702 den in Diensten des Herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg stehenden Georg Siegfried von Leiningen zu Sorgendorf, Ihingen und Mötzingen, der ebenfalls der Reichsritterschaft angehörte und den Rang eines württembergischen Kammerjunkers bekleidete. Der Ehemann war Obervogt des Amts Herrenberg und stand damit als höchster herrschaftlicher Beamter an der Spitze eines württembergischen Amtsbezirks.
Amalia Hedwig von Leiningen begeisterte sich für radikalpietistischen Ideen. Dabei kam ihr zugute, dass die reichsritterschaftlichen Familien im Herzogtum Württemberg eine Sonderstellung einnahmen. Seit dem Tübinger Vertrag von 1514 war der niedere Adel zugunsten der ehrbaren Familien von der politischen Mitwirkung an der Regierung ausgeschlossen. So blieben nur Funktionen im Hofdienst oder Positionen als Obervogt oder Forstmeister in den württembergischen Ämtern. Diese subalterne Stellung im Dienste des Herzogs von Württemberg beinhaltete eine gewisse Verletzung des adligen Selbstgefühls. Denn in seinem Verständnis war der Adel für das Herrschen bestimmt und nicht für das Dienen, sei es auch bei noch so hoch gestellten Herrschaften. In diesem Dilemma fanden einige Adelsfamilien die Lösung, einerseits dem Herzog willig zu dienen, andererseits aber auf ihren Gütern ihre herrschaftlichen Rechte offensiv wahrzunehmen. Dafür bot sich vor allem der kirchliche Bereich an, in dem die Adelsfamilien, welche Patronatsrechte besaßen, nicht der württembergischen Landeskirche unterworfen waren. Deshalb konnten sie auch Pfarrer anstellen, die in Württemberg keine Chance gehabt hätten. Gleichzeitig waren sie als Adlige vor gravierenden Übergriffen der württembergischen Behörden weitgehend geschützt.
Nach der Ernennung Georg Siegfrieds von Leiningen zum Obervogt in Herrenberg entstand dort durch Zusammenarbeit der im Pfarrdienst stehenden Brüder Sigmund Christian und Wilhelm Christian Gmelin mit Amalia Hedwig von Leiningen eine etwa 20 Personen starke separatistische Gruppe. Kontakte zu Radikalpietisten in der Residenzstadt Stuttgart, beispielsweise Elisabeth Schneider, sind belegt. Zusammen mit dem Magister Barthold, Hauslehrer ihres Sohnes Moritz Siegfried, hatte sich Frau von Leiningen 1711 separiert. Nachdem Sigmund Christian Gmelin 1706 wegen seiner pietistischen Umtriebe aus dem Pfarrdienst entlassen worden war, setzte sein jüngerer Bruder dessen Arbeit fort. Wilhelm Christian Gmelin und Amalia Hedwig von Leiningen ließen schließlich 1712 in Idstein im Fürstentum Nassau zwei Bücher – „Das Geheimnis der Bosheit und Gottseligkeit“ und „Das große Geheimnis der Offenbarung Jesu Christi in uns“ - drucken. Zwar wurden auf Befehl der Obrigkeit sämtliche Bücher, derer man habhaft werden konnte, beschlagnahmt, und die Baronin musste sich vor einer herzoglichen Kommission von Theologen und Hofpredigern verantworten, wobei sie sich unumwunden zu ihren radikalpietistischen Ansichten bekannte. Aber ihr adeliger Rang schützte die Baronin vor Sanktionen, und es erwies sich als unmöglich, strafrechtliche Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. Die Herrenberger Separatisten hielten im kleinen Kreis das Abendmahl auf eine Weise, die stark an die Abendmahlsfeiern der Täufer erinnert. Die Feier sollte allein die gegenseitige brüderliche und schwesterliche Liebe in ritueller Form bestätigen; deshalb verzichtete man auf die biblischen Einsetzungsworte.
Im Jahr 1715 erwarb die Familie von Leiningen das Schloss im nahe gelegenen Mötzingen, und die die Baronin förderte auch dort radikalpietistische Strömungen. Aus der Familie Sattler, die seit Generationen das Schlossgut Mötzingen gepachtet hatte, separierten sich einige Mitglieder von der Kirche. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich schließlich eine größere, sehr entschiedene Separatistengruppe gebildet.
Auf dem Ihinger Hof konnte Amalia Hedwig von Leiningen den Radikalpietisten aus ganz Südwestdeutschland einen besonderen geschützten Bereich bieten. Von ihrer Mutter, die aus dem Geschlecht von Bouwinghausen-Wallmerode stammte, hatte sie den Ihinger Hof bei Renningen geerbt – heute ein Versuchsgut der Universität Hohenheim. Dieser Hof war keiner Pfarrei zugeordnet, kirchlich also ein rechtsfreier Raum. Außerdem lag er recht abgelegen und war damit der herrschaftlichen Kontrolle weitgehend entzogen. Schließlich befand er sich im Zentrum des Herzogtums, von allen Richtungen her relativ gut erreichbar. Auf diesem Hof duldete die adlige Frau separatistische Versammlungen. Bald hatte sich die Kunde davon so weit verbreitet, dass sogar aus der Schweiz radikalpietistisch Gesinnte auf den Ihinger Hof kamen. Da sich vieles im Geheimen abspielte, ist die urkundliche Überlieferung äußerst lückenhaft und spärlich. Amalia Hedwig von Leiningen starb am 6. Januar 1756, und ihr Grabstein blieb bis heute erhalten. Der Ihinger Hof ging an ihren unverheirateten Sohn Siegfried Moritz von Leiningen (1703-1782) über. Dieser duldete weiterhin separatistisch gesinnte Personen auf dem Gut. Hier erhielten prominente Pietisten Impulse, so beispielsweise der Theosoph Michael Hahn aus Altdorf bei Herrenberg (1758 - 1819) und der Separatistenführer und Leinenweber Johann Georg Rapp aus Iptingen (1757-1847) einige Jahrzehnte lang, bis in die 1780er Jahre hinein, bildete der Ihinger Hof das wichtigste Zentrum des württembergischen Separatismus.
Amalia Hedwig von Leiningen gehört zu einem adligen Familienverband, von dem mehrere Mitglieder als Radikalpietisten in Erscheinung traten. Dazu zählte die Hofdame Johanna Katharina von Gaisberg und eine Frau von Stein, die mit ihrem Gemahl in Jebenhausen residierte und enge Verbindungen zu den Separatisten in Göppingen unterhielt. Soweit die Quellen erkennen lassen, traten diese Frauen selbständig auf, auch wenn sie verheiratet waren. Bei den genannten Protagonistinnen standen die Ehemänner im Schatten, während die Frauen als überzeugte und wirkungsmächtige Radikalpietistinnen erscheinen. Von Anfang an waren die Radikalpietisten bereit, Frauen als religiöse Autoritäten zu akzeptieren. Wieweit die Zugehörigkeit zur Oberschicht, repräsentiert durch Persönlichkeiten wie Amalia Hedwig von Leiningen, dabei ausschlaggebend war, wäre durch weitere Forschungen zu klären.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Gisela Schlientz: Die Visionärin Amalia Hedwig von Leiningen (1684-1756). In: Weib und Seele. Frömmigkeit und Spiritualität evangelischer Frauen in Württemberg. Ausstellungskatalog des Landeskirchlichen Museums Ludwigsburg 1998. S. 81–87.
Eberhard Fritz: „Viele fromme Seelen und Querköpfe“. Der Ihinger Hof im Besitz der Familie von Leiningen als Ort der Kommunikation zwischen Pietisten und Separatisten im 18. Jahrhundert. In: BWKG 111 (2011), S. 161–191.
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/leiningen-amalia-hedwig-von (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Kissling, Georg Adam
-
Von: Quack, Jürgen
Inhaltsverzeichnis
1: Georg Adam Kissling (1805-1865)
Georg Adam Kissling wurde am 2. April 1805 in Murr (Oberamt Marbach) geboren. Da seine Eltern früh starben, wuchs er bei Verwandten in Ludwigsburg und Korntal auf. Dort erlernte er den Beruf des Bäckers und wurde für die Mission gewonnen. Da er aufgrund seiner geringen Körpergröße nicht zum Militärdienst eingezogen wurde, ging er im November 1823 mit einer Empfehlung von Johann Jakob Häring vom Stuttgarter Hilfsverein der Basler Mission aufs Missionsseminar in Basel.
2: Basler Mission
-
Georg Adam Kissling
Archiv der Basler Mission,QS-30.001.0059.01
Damals bildete die Basler Mission vor allem Missionare für die englische Church Missionary Society (CMS) und andere englische sowie niederländische Missionsgesellschaften aus. Doch schon früh erwuchs in ihr der Wunsch nach einem eigenen Missionsgebiet. So wurden 1822 die ersten Missionare in den Süden Russlands ausgesandt. Sie eröffneten 1824 in Schuscha (im heutigen Aserbaidschan) eine Missionsstation. Inspektor Blumhardt hatte die Vision, von hier aus Missionare in Richtung Türkei, Persien und Indien zu senden.
Das Komitee hätte aber auch gerne in Afrika eine Arbeit in eigener Verantwortung begonnen. Da kam im Jahr 1825 die Einladung zu einer Arbeit in Liberia in Westafrika. Amerikanische Christen hatten 1817 eine „Afrikanische Kolonisierungsgesellschaft“ gegründet und fünf Jahre später einen Landstrich südlich von Sierra Leone gekauft, um dort in Liberia – dem „Land der Freiheit“ – entlassene Sklaven anzusiedeln. Die Leitung übernahm der Amerikaner Jehudi Ashmun.
Dieser schickte 1825 eine Einladung an die Basler Mission. Er schrieb, dass die freigelassenen amerikanischen Sklaven fast alle Christen seien und die Basler sie gerne als Seelsorger empfangen und bei der Mission unter den Heiden kräftig unterstützen würden. 1827 wurden die ersten fünf Mitarbeiter von Basel nach Liberia geschickt, darunter Georg Adam Kissling. Sie eröffneten dort das zweite eigene Arbeitsgebiet der Basler Mission.
In der „Instruktion“ für ihre Arbeit erinnert Blumhardt an die Gräuel der Sklaverei. Mission ist für ihn Wiedergutmachung begangenen Unrechts: „Vergesst nicht, welche Wunden die ‚schmutzigste Habsucht und die grausamste Arglist der Europäer‘ den Afrikanern geschlagen haben.“ Verkündet ihnen in Liebe und Demut das Evangelium und lehrt sie Lesen und Schreiben sowie Handwerk und Landwirtschaft.
Die Arbeit erwies sich jedoch als äußerst schwierig. Die ehemaligen Sklaven aus Amerika waren Baptisten und Methodisten. Die Baptisten schlossen die Basler als „Ungetaufte“ von ihrem Abendmahl aus, während die Methodisten den Eintritt in ihre Kirche verlangten, da sie die Mission sonst nicht unterstützen würden. Hinzu kamen schlimme Krankheiten, die entweder zum Tode führten oder zur Heimreise zwangen. Nach einem Jahr war nur noch Kissling an der Arbeit. Er hatte die Sprache Bassa gelernt und eine Schule mit 50 Kindern eröffnet.
Im Jahr 1829 kamen vier weitere Basler Brüder. Doch es tauchten neue Hindernisse auf: Die Fehden und Kriege der verschiedenen Ethnien im Land machten Reisen und eine geordnete Tätigkeit unmöglich. Noch schlimmer war jedoch ein Streit unter den Brüdern über die Art der Arbeit. Die einen waren der Meinung, dass Afrikaner durch Afrikaner gewonnen werden müssten, weshalb die Gründung von Schulen am dringendsten sei. Die anderen wollten hingegen selber predigen und Gemeinden gründen. Dann wurde auch noch die blühende Schularbeit von der Regierung torpediert. So beschloss das Komitee in Basel im Jahr 1831, die Arbeit in Liberia abzubrechen. Kissling kehrte nach Deutschland zurück und heiratete Karolina Augusta Tanner aus Ludwigsburg.
3: Church Missionary Society
-
Bischof Samuel Crowther
Illustration aus Jesse Page: Samuel Crowther. The Slave boy who became Bishop. New York 1888
1833 erhielt er von der Church Missionary Society (CMS) das Angebot, als Rektor des Fourah Bay College in Sierra Leone wieder nach Afrika zurückzukehren. In dieser Einrichtung wurde die erste ostafrikanische Führungsschicht ausgebildet. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Samuel Ajayi Crowther, der später der erste schwarze Bischof in Afrika wurde (worüber er sehr stolz war).
Da seine Frau bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben war, heiratete er 1837 während eines Besuchs in England Margaret Moxon aus Hull. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit kehrte er 1841 nach England zurück.
Nach einem Jahr hatte er sich soweit erholt, dass die CMS ihn erneut aussenden konnte – allerdings nicht wieder in das heiße Afrika, sondern zu den Maori in Neuseeland. Dort widmete er sich als Missionar vor allem der Schularbeit und wird in Neuseeland deswegen in guter Erinnerung als der „Mann, der 7000 Maori das Lesen und Schreiben lehrte”, behalten. Er wurde zum Archidiakon von Waitemata ernannt und starb am 10. November 1865 in Auckland.
Kissling war einer von über 80 Missionaren, die im Zeitraum 1818–1848 über die anglikanische Church Missionary Society (CMS) ausgesandt wurden, da diese zu wenig eigene Mitarbeiter hatte. Zu den bekanntesten „Baslern” im Dienste der CMS gehörten Krapf und Rebmann in Ostafrika.
Aktualisiert am: 28.08.2025
Literatur
Wilhelm Schlatter, Geschichte der Basler Mission, Bd. 3, 1916, S. 9-18.
Personalfaszikel Georg Adam Kissling BV 69, Archiv der Basler Mission
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/kissling-georg-adam (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Kittel, Ferdinand
-
Von: Quack, Jürgen
GEORG FERDINAND KITTEL (1832-1903)
-
Denkmal Ferdinand Kittel in Bangalore/Indien
Foto: Bernhard Dinkelaker
Groß steht sein Denkmal an der „Mahatma Gandhi Road“ in Bangalore in Indien: Ferdinand Kittel, geboren am 7.4.1832 in Ostfriesland. Mit 18 Jahren ging er zur Ausbildung nach Basel – und lernte dort auch Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Englisch und Französisch. 1853 wurde er mit 21 Jahren von der Basler Mission nach Indien ausgesandt, wo er – unterbrochen durch zwei lange Heimataufenthalte – bis 1892 wirkte.
Warum wurde ihm dort ein Denkmal errichtet? Auf welchem Buch ruht seine Hand? Und warum trägt die Statue eine Fahne in der Hand?
Ferdinand Kittel tauchte wie kaum ein anderer Missionar in die Kultur Indiens ein. Wie Paulus „den Griechen ein Grieche“ (1. Kor. 9,20), so wollte er „den Indern ein Inder“ werden. Besonders widmete er sich der Kannada-Sprache, damals „Kanaresisch“ genannt. Das war nicht einfach, denn es gab mehrere Dialekte, dazu viele Fremdworte und Einflüsse aus anderen indischen Sprachen – und auch die kanaresische Schrift wurde in vielen Varianten geschrieben. Er gab eine Anthologie der kanaresischen Literatur heraus und veröffentlichte eine Sammlung indischer Fabeln für die Schule. Das Leben Jesu schilderte er im Versepos „Kathamale“ in traditionellen indischen Versen und schrieb eigene Gedichte in Kannada.
Ihn begeisterten die bunten indischen Feste. Er schrieb der Missionsleitung: „Wir Evangelischen bieten den Sinnen der Heiden sehr wenig. Wir haben keine Processionen, keine eigentlichen religiösen Volksfeste, kein Gepränge in den Kirchen. Es dürften sich doch noch Ceremonien finden, die wir benutzen könnten – unschuldige volksthümliche Weisen“. Er schlug vor, christliche Lieder nach lokalen Melodien zu singen und mit traditionellen Instrumenten zu begleiten – aber die Missionsleitung war dagegen.
Sie befahl ihm auch, aus dem Dorf, wohin er gezogen war, wieder in die sichere Missionsstation umzuziehen, wo Hygiene und Gesundheit besser geschützt waren.
-
Georg Ferdinand Kittel vor der Aussendung 1853 (mit 21 Jahren)
QS-30.001.0262.01
Nach zwanzigjähriger Arbeit veröffentlichte er 1894 ein Kannada-Englisch Wörterbuch mit 30.000 Einträgen auf 1758 Seiten – finanziell unterstützt vom Maharadscha von Mysore. Es ist nicht nur eine Übersetzungshilfe, sondern enthält viele Belege aus der einheimischen Literatur. 1903 folgte eine Grammatik. Damit schuf er den Standard dieser Sprache, die heute von ca. 44 Millionen Menschen gesprochen wird und in einer eigenen Schrift geschrieben wird. Es ist die wichtigste Sprache des indischen Bundesstaates Karnataka.
Durch sein „Beffchen“ ist er in der Statue als Pfarrer erkennbar – aber das Buch, auf das er seine Hand legt, ist nicht die Bibel, sondern eben dieses für die Inder so wichtige Wörterbuch. Und es ist die rot-gelbe Fahne dieses Landes, die seine Statue in der Hand hält. So ehrt ihn dieses Land. Auch eine Stadt und ein College sind nach ihm benannt.
Als er 1860 die Basler Mission bat, wie es das damals üblich war, ihm eine Frau schicken, wurde ihm Pauline Eyth aus Tübingen vermittelt. Sie starb schon nach vier Jahren Aufenthalt in Indien. Darauf heiratete er in einem Heimaturlaub 1867 deren jüngere Schwester Wilhelmine Julie Eyth. Aus erster Ehe hatte er zwei Söhne, in zweiter Ehe wurden zwei Töchter und zwei Söhne geboren; ein Sohn wurde auch Missionar und setzte Ferdinand Kittels Arbeit in Indien fort.
1892 kehrte er endgültig nach Deutschland zurück und zog nach Tübingen. Die dortige Universität verlieh ihm für seine sprachwissenschaftliche Arbeit 1896 die Ehrendoktorwürde. Dort starb er am 18.12.1903. In Indien ist er noch sehr bekannt; immer wieder besuchen Inder – Christen wie Hindus – sein Grab auf dem Tübinger Friedhof.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/kittel-ferdinand (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Krapf, Johann Ludwig
-
Von: Quack, Jürgen
Johann Ludwig Krapf (1810 – 1881)
-
Johann Ludwig Krapf
Archiv der Basler Mission, QS-30.001.0132.01
Der aus Derendingen stammende Johann Krapf war Missionar, Sprachforscher und Entdecker. Nach der Ausbildung im Missionsinstitut in Basel und Studium in Tübingen und Vikariat in Altburg und Wolfenhausen war er zunächst in Äthiopien tätig und dann viele Jahre im heutigen Kenia.
Als Sprachforscher erhielt er einen Ehrendoktor von der Universität Tübingen, weil er alte semitische Manuskripte aus Äthiopien sammelte und der Universität übergab. Er brachte die Kisuahelisprache in Schriftform und übersetzte Teil der Bibel ins Tigrinya, Oromo und Amharische. Als Entdecker sah er 1849 als erster Europäer den mit ewigem Schnee bedeckten höchsten Berg des Landes. Er fragte die Einheimischen, wie der Berg heiße und schrieb als Namen auf: Kenia. Nach dieser Form des Namens bekam später das ganze Land seinen Namen. Sein Freund Rebmann sah als erster Europäer den ebenfalls mit ewigem Schnee bedeckten Kilimandscharo im heutigen Tanzania. Es dauerte lange, bis ihre Berichte darüber in Europa geglaubt wurden.
-
Glasfenster aus der Allerheiligen-Kathedrale in Nairobi
Foto: Quack
Als Missionar hat Krapf in den von ihm erforschten Sprachen unermüdlich gepredigt und viele Gespräche geführt, hat Sklaven freigekauft und einen Plan für die Gründung von weiteren Stationen quer durch den Kontinent entworfen, um die Missionsarbeit in Ost- und Westafrika miteinander zu verbinden. Er hat keinen einzigen Afrikaner getauft, aber er hat der Mission in Ostafrika den Weg bereitet.
Neben seinem noch erhaltenen Haus in Rabai steht heute das „Krapf Memorial Museum“. Darin wird deutlich, wie hart damals für Europäer die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Afrika waren: er wurde überfallen und ausgeraubt, er war todkrank, er hat seine Frau Rosine und ihr Kind begraben müssen. Aber er ist nicht vergessen, weder in Kenia noch in Derendingen. In der Hauptstadt Nairobi ist sein Bild – neben dem seines Kollegen Johannes Rebmann aus Gerlingen – in einem großen Glasfenster der anglikanischen Kathedrale zu sehen, gleich neben den zwölf Jüngern Jesu. Denn Krapf und Rebmann gelten als die Gründer der christlichen Kirche in Ostafrika.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/krapf-johann-ludwig (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Mader, Friedrich Wilhelm
-
Von: Lächele, Rainer
Inhaltsverzeichnis
Friedrich Wilhelm Mader (1866-1945)
1: Familienverhältnisse
V Philipp Friedrich Mader (*24.4.1832 + 3.6.1917), Pfarrer in Nizza
M Mathilde Luise Mader, geb. Moser
G 4
∞ 1894 Martha Fischer (22.6.1874-12.7.1945), Tochter des Pfarrers Karl Fischer in Eberstadt
K 6 (Else 1895-1913, Karl *1897, Friedrich *1900, Hedwig *1906, Marie Theres *1910, Elisabeth *1916)
2: Biografische Würdigung
-
Friedrich Wilhelm Mader (1866-1945)
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 3637. Fotograf: W. Hornung, Tübingen
Der am 8. September 1866 in Nizza in Südfrankreich in eine Pfarrerfamilie hineingeborene Mader war von Kind auf „schüchtern und unbeholfen im Umgang mit Menschen und litt zeitlebens an einem Mangel an Selbstvertrauen“. Er wuchs heran in einem national geprägten Elternhaus, umso mehr, als das Umfeld nicht eben deutschfreundlich gesinnt war. Die schwache gesundheitliche Konstitution bringt Mader früh schon zum Lesen: als Achtjähriger schrieb er seine ersten Märchen. Später entdeckte er seinen Hang zur Dichtung. Eine Fülle seiner Gedichte wurde für die Jugendbewegung vertont. Erste Prosastücke entstanden in der Tübinger Studienzeit. In Tübingen war er auch Mitarbeiter der „Fliegenden Blätter“ München und der „Moggendorfer Blätter“. Dem 1. theologischen Examen folgten Lehr- und im wörtlichsten Sinne Wanderjahre: für ein kurzes Vikariat beim Vater in Nizza wanderte er in sechs Wochen von Balingen in die südfranzösische Stadt.
Nach den üblichen Jahren im unständigen Pfarrdienst wurde er 1897 zum Pfarrer von Eschelbach ernannt. Im dortigen Pfarramt begann das Wirken des Jugendschriftstellers Mader, der ausschließlich für Jungen schrieb. Darüber hinaus verfasste er mehrere Dramen und Schwänke in schwäbischem Dialekt. Maders Verlag, der Unionverlag wurde mit ihm zum erfolgreichsten Jugendbuchverlag zwischen 1890 und 1930.
Die Erzählungen Maders orientieren sich stark an Jules Verne und Karl May und sind geprägt von geographischen Schilderungen, die Mader mühsam erarbeitete. Titel wie „Nach den Mondbergen. Eine abenteuerliche Reise nach den rätselhaften Quellen des Nils“ (1920) oder „Am Kilimandscharo. Abenteuer und Kämpfe in Deutsch-Ostafrika“ (1941) sprechen für sich. Der Burenkrieg stellte ein wichtiges Thema dar, das er in mehreren Romanen beleuchtete.
Ein anderer Schwerpunkt seiner Arbeiten lag auf pädagogischen Fragen. 1902 schlug er in einem Zeitungsartikel vor, die geistliche Schulaufsicht aufzuheben, was ihm einen Tadel des Stuttgarter Konsistoriums einbrachte. Ein Jahr später beschäftigte er sich mit „Züchtigungspflicht und Züchtigungsrecht“ und griff 1914 mit der Schrift „Die Prügelstrafe in der Schule“ (1914) die prügelnden Volksschullehrer seiner Zeit an. Mader schilderte in diesem Buch seine Erfahrungen in Frankreich, wo die Prügelstrafe in der Schule verboten war. Zudem gelte der Deutsche in Frankreich aufgrund seiner „Prügelwut“ als Halbbarbar.
Aufsehen erregte Mader auch 1911 mit seinem Science-fiction-Roman „Wunderwelten“. Dieser Roman wurde 1987 als einzige unveränderte Neuauflage von Maders Werken nach 1945 wieder veröffentlicht.
Weniger nationalistisch als vielmehr seelsorgerlich fielen Maders „Geistlichen Kriegslieder“ aus, die 1915 erschienen und eine Verbreitung von über 30.000 Exemplaren fanden. Auf Dauer ging das Nebeneinander von Pfarramt und Schriftstellerei nicht gut. Daher ließ sich Mader 1917 in den Ruhestand versetzen und zog nach Stuttgart.
Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg waren für Mader schwierige Jahre. Sein eigener Verlag kostete mehr Arbeit, als er einbrachte. So war es keine Frage, ab 1922 mit der „Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart“ zusammen zu arbeiten. Langsam, aber sicher wuchs der Erfolg von Maders Schriften. Zugleich rief er mit etlichen seiner Schriften Kopfschütteln und scharfen Widerspruch hervor. So auch, als er 1924 das Buch „Die Gefahren der Enthaltsamkeit“ veröffentlichte. Hier rechnete er mit „fanatischen Alkoholfeinden“ „vom biblisch-christlichen Standpunkte“ ab.
Seit Mitte der 30er Jahre kamen Maders Schriften aus der Mode. Trotz größter Bemühungen wurden seine Arbeiten kaum noch gedruckt. Offenbar hatte sich der Geschmack der Jugend verändert. Die letzten Jahre seines Lebens waren von dauernden finanziellen Problemen bestimmt. Kurz vor dem Einmarsch der französischen Truppen starb Mader am Karfreitag, 20.April 1945.
Nach 1945 wurden nur noch einzelne Erzählungen Maders gekürzt und um anstößige nationalistische Anklänge bereinigt wieder aufgelegt wie etwa „Die Flucht aus dem Sudan“ von 1952. Vielfach wurden alle belehrenden und religiösen Aspekte beseitigt. In den 50er Jahren kam es nochmals zu einer kleinen Mader-Renaissance. In den 80er Jahren erschien im Heyne Verlag München nochmals sein Science-fiction-Roman „Wunderwelten“, einst der bemerkenswerteste Roman dieses Genres im Kaiserreich. Der englische Gelehrte und Astronom Lord Charles Flitmore reist in einem Raumschiff zum Mars, Jupiter und Saturn, entdeckt in einem anderen Sonnensystem einen erdähnlichen Planeten und kehrt dann zur Erde zurück.
Mader verstarb am 30. März 1945 in Bönnigheim.
Erstabdruck in: Württembergergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band I. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2006. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/mader-friedrich-wilhelm (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Mader, Johann Adam
-
Von: Quack, Jürgen
Johann Adam Mader (1826-1882)
-
Johann Adam Mader im Jahr 1851
Archiv der Basler Mission QS-30.001.0245.01
Johann Adam Mader wollte lieber auf dem weltweiten Acker Gottes als Missionar arbeiten als sein Leben auf einem steinigen Äckerle auf der Schwäbischen als Bauer zu verbringen. Johann Adam Mader wurde am 18. Januar 1826 in Mägerkingen geboren. Seine Eltern waren der Bauer, Hirschwirt und Schultheiß Philipp Mader und Helene geb. Hipp. Sie hatten dreizehn Kinder, von denen fünf früh starben. Mägerkingen war zusammen mit dem Nachbarort Hausen an der Lauchert eine evangelische Enklave auf der Mittleren Alb. Die pietistische Gemeinschaft und die monatliche Missionsstunde waren gut besucht.(1) Das pietistische Umfeld hat Johann Adam Mader stark geprägt. Sein Onkel war der „Hansmartin von Mägerkingen“, ein für die pietistischen Gemeinschaften der Mittleren Alb bedeutender und bekannter Stundenhalter, der enge Kontakte zu Johannes Kullen pflegte und regelmäßig an dessen Brüderkonferenzen in Hülben teilnahm. Auch beherbergte er in seinem Haus die Kindergruppen, die auf dem Weg zwischen den Rettungsanstalten Korntal und Wilhelmsdorf in Mägerkingen Halt machten.(2)
So war es nicht verwunderlich, dass der junge Johann Adam Mader von früh an Interesse an der Mission entwickelte. Schon mit 17 Jahren schrieb er mit Hilfe des Mägerkinger Pfarrverwesers Roller einen Brief nach Basel und bat um die Aufnahme in das Missionsseminar. Die Bitte wurde abgelehnt: er sein noch zu jung. Doch er gab nicht auf. Zwei Jahre später schrieb er einen neuen Antrag und fügte Empfehlungen seines Lehrers Klump und des Gemeindepfarrers Georg David Grauer an. Beide bescheinigten ihm einen untadeligen Lebenswandel und tiefe Frömmigkeit. Sie wiesen auch darauf hin, dass sich der junge Mader nach seiner ersten Ablehnung durch Basel bemüht habe, sich für einen neuen Antrag gut vorzubereiten: vom Schulmeister Klumpp bekam er im Winter – im Sommer ging es wegen seiner Arbeit in der Landwirtschaft nicht – Unterricht in Geographie, bei Pfarrer Grauer nahm er Unterricht in Latein.(3) Schulmeister Klumpp betont in seiner Empfehlung auch Maders physische Eignung: Er ist „von großem, starken Körperbau, erfreut sich einer festen Gesundheit und ist frei von allen körperlichen Gebrechen.“(4)
Im Januar 1846 wurde er ins Missionsseminar aufgenommen. Nach 4-jähriger Ausbildung erfolgte im Dezember 1850 in Herrenberg die Ordination für den Missionsdienst durch Dekan Sixt Karl Kapff. Nach der Einsegnung in Basel im Februar 1851 erfolgte die Aussendung als Missionar an die westafrikanische Goldküste (heute Ghana), wo die Basler Mission seit 1828 tätig war. Am 25. Mai 1851 traf er in Ussu ein. Ussu (heute: Osu) war das afrikanische Dorf um die Festung Christiansborg, die 1850 von den Dänen an die Engländer verkauft worden war. Heute ist es ein Stadtteil der ghanäischen Hauptstadt Akkra. Mader war vor allem im Schuldienst tätig, zunächst in Ussu an der Küste, dann in Akropong im höher gelegenen Inland.
Am 31. Januar 1856 heiratete er Ernestine Binder aus Korntal(5). Die Heirat war vermutlich arrangiert durch Ernestines ältere Schwester Rosina, die schon 1846 durch den Korntaler Pfarrer Heinrich Staudt als Braut für Missionar Georg Widmann nach Afrika vermittelt worden war. Als erstes Kind wurde Lydia Victoria am 29. November 1856 in Akropong geboren. Das zweite Kind starb kurz nach der Geburt. Danach kamen zweimal hintereinander Zwillinge tot zur Welt.(6) Die Kindersterblichkeit war damals allgemein hoch, doch die klimatischen Bedingungen kamen für die Frauen in der Mission noch einmal erschwerend hinzu. So war es eine Erleichterung, dass sich die Familie von 1860 bis 1862 auf Heimaturlaub begeben konnte. Während dieser Zeit, am 26. September, wurde die Tochter Eunike Theodora geboren.
1862 kehrten sie zurück an die Goldküste wo Mader nun Leiter des Predigerseminars in Akropong wurde. Dort waren die beiden Katechistenschulen von Ussu (Ga-Sprache) und Akropong (Twi-Sprache) zu einem höheren Seminar vereinigt worden. Es war eine anspruchsvolle fünfjährige Ausbildung für die einheimischen Evangelisten. Alle mussten Griechisch lernen, um das Neue Testament aus der Ursprache auslegen zu können. Für die begabten Jünglinge wurde auch Hebräisch angeboten.
Neben seiner Lehrtätigkeit bekam Mader von der Basler Mission weitere Aufgaben anvertraut: er war Mitglied der Kommission zur „Sklavenemanzipation“. Dabei ging es nicht um den Sklavenhandel nach Amerika – der war längst verboten – sondern um die Freilassung der einheimischen Haussklaven, die vor allem durch wirtschaftliche Verschuldung ihre Freiheit verloren hatten. Das war eine schwierige Aufgabe, da diese Tradition tief in der einheimischen Kultur verankert war. Als 1869 die Missionare Ramseyer und Kühne von den kriegerischen Asante entführt wurden, leitete Mader die Verhandlungen zu ihrer Freigabe, die erst nach drei Jahren erfolgte. Anschließend daran bereitete er die Eröffnung der Mission unter den Asante vor.(7)
Maders Frau Ernestine war in dieser Zeit zusätzlichen Strapazen ausgesetzt: neben der Unterstützung ihres Mannes in der Mission bekam sie weitere vier Kinder, von denen zwei nach wenigen Tagen starben.(8) Schließlich starb sie selbst, erschöpft und ausgezehrt, am 19.2.1873 in Akropong.
Nur wenige Monate nach dem Tod seiner Frau beantragte J.A. Mader bei der Missionsleitung die Erlaubnis zur Wiederverheiratung.(9) Er begründete seinen Wunsch damit, dass es für den Schulbetrieb notwendig sei, wenn die Mädchen von einer Frau unterrichtet werden. Er bat das Komitee auch um die Vermittlung einer passenden Frau. Allerdings machte er auch einige Vorschläge, wen die Mission anfragen könnte. - Das Vorhaben erwies sich als nicht so einfach: in acht Sitzungen musste sich das Komitee mit der Angelegenheit befassen.(10)
Die erste von Mader genannte Frau lehnte die Anfrage des Komitees ab. Die eingeholten Informationen über die zweite von ihm genannte Frau - Lydia Schüle aus Korntal, eine Kusine seiner verstorbenen Frau - zählten zwar viele ihrer Vorzüge wie „gewandt, kräftig, gebildet und aufrichtig“(11) auf, aber „eine bekehrte Person könne sie nicht genannt werden“.(12) Damit war sie für das Komitee nicht akzeptabel.
Erst die dritte der von Mader vorgeschlagenen Frauen – die er selbst alle nicht kontaktiert hatte – fand Gnade vor den Augen des Komitees: Ottilie Viktoria Lechler, eines von 17 Kindern des Nürtinger Oberamtsarztes Dr. Karl Maximilian Lechler.(13) Ottilie war am 26. Januar 1834 als zwölftes Kind in Giengen geboren worden. Als junge Frau trat sie der Stuttgarter Diakonissenanstalt bei, hatte die Gemeinschaft aber aus Gesundheitsgründen wieder verlassen. So wies sie auch bei ihrer positiven Antwort auf die Anfrage von Inspektor Josenhans darauf hin, dass sie hin und wieder Probleme mit einem „Lungenhusten“ habe. Aber das Komitee meinte, dass in dieser Hinsicht das tropische Klima vielleicht sogar heilsam sein könnte. Auch die Tatsache, dass Ottilie schon 39 Jahre alt war – eine Frau in diesem Alter war noch nie ausgesandt worden – war kein Hindernis, dass die Missionsleitung ihre Zustimmung zur Heirat gab.(14) Die Ausreise erfolgte wenige Wochen später. Die Trauung in Akropong vollzog Missionar Widmann. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor.(15)
1877 kehrte das Ehepaar wegen Maders geschwächter Gesundheit zu einem zweiten Heimaturlaub nach Deutschland zurück. Nach seiner Abreise aus Akropong wandte sich sein Nachfolger, Missionar Karl Buck, mit einer Beschwerde an das Komitee in Basel: Bruder Mader hätte kein detailliertes Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben des Predigerseminars hinterlassen. Und auch das Kopierbuch seiner Briefe an die Missionsleitung habe er mitgenommen, anstatt es nach Vorschrift am Arbeitsort zu lassen. Missionsinspektor Josenhans schrieb daraufhin an Mader und bat um eine Stellungnahme. Mader antwortete, er habe die Details der Finanzen in sein Notizbuch geschrieben und nur die Jahresabrechnung in das Kassenbuch der Missionsstation eingetragen. Und das Kopierbuch habe er mitgenommen, weil er gelegentlich Äußerungen über seine Kollegen an das Komitee geschrieben habe – und die sollten denen nicht zu Gesicht kommen.
Wegen dieser eindeutigen Pflichtverletzungen sprach ihm das Komitee einen Tadel aus. Da es ihm jedoch keine Probleme bei der Rückkehr nach Afrika machen wollte, forderte das Komitee das Kopierbuch zur Einsicht an, sicherte ihm aber zu, es nicht nach Afrika zu schicken.(16) Mader kam der Anordnung nach und überließ es der Missionsleitung, wie sie damit verfahren wollte.(17)
War es dieser Zwischenfall, der sicherlich sowohl sein Verhältnis zur Missionsleitung wie zu seinen Kollegen in Afrika belastete, oder war es seine Gesundheit, jedenfalls beschloss Mader, nicht wieder nach Afrika zurückzukehren. Er beantragte bei der württembergischen Kirchenleitung, in deren Pfarrdienst zu wechseln. 1878 schied er mit 51 Jahren aus dem Dienst der Mission aus und wechselte in den württembergischen Kirchendienst. Er wurde 1878 Pfarrverweser in Frickenhausen im Dekanat Nürtingen.1979 wechselte er in die Gemeinde Kohlstetten im Dekanat Münsingen. 1980 holte er die Kirchliche Dienstprüfung nach und war 1881 bis zu seinem Tod 1882 ordentlicher Pfarrer am Ort.(18) Seine Witwe blieb im Ort und starb dort 1887.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/mader-johann-adam (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Mader, Philipp Friedrich
-
Von: Quack, Jürgen
Philipp Friedrich Mader (1832-1917)
-
Philipp Friedrich Mader (1832-1917)
Privatbesitz
Philipp Friedrich Mader wurde 1832 als sechstes von 13 Kindern des Hirschwirts und Schulheißen Philipp Mader und dessen Ehefrau Helene, geborene Hipp in Mägerkingen auf der Schwäbischen Alb geboren. Aus dem schwäbisch pietistischen Milieu stammend, wollte Philipp wie sein älterer Bruder Adam Missionar werden. 1851 ging er zur Ausbildung nach Basel ans Missionsseminar. Kurz vor seiner geplanten Aussendung wurde er durch eine Cholerainfektion so geschwächt, dass eine Tätigkeit in den Tropen nicht in Frage kam.
Gerade zu dieser Zeit kam eine Anfrage des aus Basel stammenden Hoteliers Eduard Hug aus Nizza, das damals zum Königreich Piemont-Sardinien gehörte. Der Hotelier schrieb, unter seinen zahlreichen Gästen seien viele Deutsche. Er bitte die Basler Mission um einen Prediger und Seelsorger deutscher Sprache. Als das Komitee Mader fragte, ob er zu diesem Dienst bereit sei, erschrak er zunächst. Was sollte er in dieser mondänen Stadt an der Riviera, wo die europäische Aristokratie des 19. Jahrhunderts ihre Winter verbrachte? Nach einiger Überlegung sah er in dieser Anfrage jedoch Gottes Auftrag und willigte ein. Und so schickte die Basler Mission ihn nicht wie seinen Bruder Adam an die afrikanische Goldküste, sondern ins damals noch italienische Nizza. Da er dort auch Taufen und Abendmahlsgottesdienste feiern sollte, erhielt er eine „Ordination für den Missionsdienst“ durch den Heilbronner Dekan Koch.
In Nizza sammelte Mader eine Gemeinde, die in angemieteten Räumen zusammenkam. 1856 hielt er den ersten deutschsprachigen Gottesdienst. Zunächst bestand die Gemeinde vor allem aus Dienstboten und Hausmädchen. Nachdem jedoch im Winter 1858/59 der württembergische König Wilhelm I. längere Zeit in Nizza gewesen war und jeden Sontag Maders Gottesdienst besucht hatte, schlossen sich auch wohlhabende Personen aus Adel und Bürgertum an. Mit deren Unterstützung wurde es 1866 schließlich möglich, eine eigene „Deutsche Kirche“ zu bauen.
Da die dort ansässigen protestantischen Kirchen (Reformierte und Waldenser) die Lutheraner nicht als gleichberechtigte Kirche akzeptierten, wandte Mader sich an Wilhelm Hoffmann, den früheren Inspektor der Basler Mission, der jetzt Oberhofprediger in Berlin war, und bat ihn um Unterstützung durch die preußische Kirche. Doch diese wollte ihre guten Beziehungen zu den Waldensern nicht aufs Spiel setzen und lehnte ab. Darauf bat Mader um den Anschluss seiner Gemeinde an die württembergische Landeskirche. Auch das wurde abgelehnt. Jedoch erklärte sich der 1843 gegründete Stuttgarter Gustav-Adolf-Verein bereit, die Gemeinde finanziell zu unterstützen. Dadurch wurde es möglich, dass Mader ein Gehalt gezahlt werden konnte. Bisher hatte er seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer verdient. Von der Basler Missionsgesellschaft hatte er kein Geld annehmen wollen, weil dieses doch für die „Heidenmission“ bestimmt sei.
Nachdem Nizza 1859 an Frankreich gefallen war, schloss sich die Gemeinde der kleinen Lutherischen Kirche Frankreichs an. Daher wurde ein Teil seines Gehalts nun vom französischen Staat gezahlt. Dennoch ging es unruhig weiter: Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 hatte Mader öfter unter deutsch-feindlichen Verleumdungen zu leiden. Nach der Trennung zwischen Kirche und Staat 1905 wurde die finanzielle Lage der Gemeinde schwierig. Daher stellt Mader 1912 nochmals den Antrag an die württembergische Landeskirche, die Gemeinde in Nizza zu übernehmen – doch der wurde wieder abgelehnt. Bei Beginn des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 befand sich die Familie Mader in ihrem Ferienhaus im italienischen Tenda und musste dort bleiben. Fast alle Deutschen verließen Nizza. Erst nach dem Krieg konnte wieder eine Gemeinde entstehen.
58 Jahre lang wirkte Philipp Friedrich Mader in Nizza – und fast genauso lang auch seine Frau Mathilde geb. Moser aus Stuttgart, mit der er neun Kinder hatte. Unter persönlichen Entbehrungen, gegen weltlichen und kirchlichen Widerstand, hatte Mader eine deutsche lutherische Kirche aufgebaut, in der noch heute Gottesdienste in deutscher und französischer Sprache gefeiert werden. Geschätzt als Prediger und Seelsorger „für Dienstboten und Majestäten“ starb er 1917 im italienischen Lucca und wurde dort begraben.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Hans Binder, Philipp Friedrich Mader (1832-1917). Prediger und Seelsorger für Dienstboten und Majestäten in Nizza, LIT-Verlag, Berlin 2006
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/mader-philipp-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Mayer-List, Max
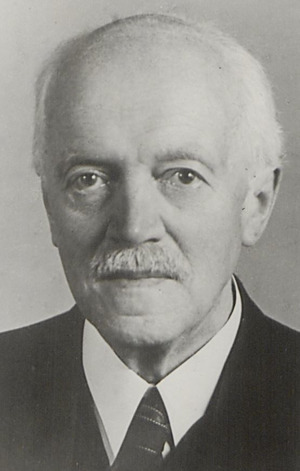
-
Von: Butz, Andreas
Max Mayer-List (1871-1949)
Prälat Mayer-List stand in der Zeit des Kirchenkampfes in Württemberg eng an der Seite des damaligen Landesbischofs Theophil Wurm, dessen Stellvertreter er war. Im Herbst 1934 wurde von Seiten des deutschchristlichen Reichsbischof unter einem Vorwand der Versuch unternommen, die württembergische Kirchenleitung zu entmachten. Der Landesbischof wurde unter Hausarrest gestellt, und auch sein Stellvertreter Mayer-List wurde von der Leitung entfernt, indem er beurlaubt wurde.
Herkunft, Ausbildung und erste Pfarrdienste
Er kam am 28. Januar 1871 unter dem Namen Max Mayer als Sohn einer Stuttgarter Kaufmannfamilie zur Welt. Erst 1921 änderte er seinen Nachnamen in Mayer-List, indem er den Mädchennamen seiner Mutter hinzufügen ließ. Im Vikariat wurde Mayer-List stark von Theodor Traub geprägt, auf dessen Einfluss sein starkes Engagement für die Arbeiterschaft und insbesondere den evangelischen Arbeiterverein zurückging. Von 1907 bis 1911 wirkte er als Vorsitzender dieser Vereinigung. Nach einer Station als 2. Stadtpfarrer an der Göppinger Oberhofenkirche wurde er ab 1905 in der gleichen Funktion an der Stuttgarter Markuskirche tätig, bevor er von 1917 bis 1929 dort die erste Pfarrstelle versah. Ab 1912 war er Mitglied des Landeskirchentags, von 1919 bis 1930 des deutschen Kirchentags. Außerdem hatte er von 1909 bis 1929 die Schriftleitung des wöchentlich erscheinenden Kirchlichen Anzeigers inne.
Stellvertreter des Landesbischofs in bedrängter Zeit
Ende 1929 wurde er als Prälat in den Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart berufen. Dort war er für die Besetzung der Pfarrstellen zuständig. Als Stellvertreter des Landesbischofs für geistliche Angelegenheiten fungierte er ab 1933. Bereits ein Jahr später, 1934, kam es zu dem Versuch, der Württembergischen Landeskirche eine deutschchristliche Leitung aufzunötigen. Während der versuchten Entmachtung des Landesbischofs Wurm durch die Deutschen Christen, wurde dieser am 8. September seines Amtes enthoben, beziehungsweise auf seine geistlichen Aufgaben beschränkt. Dieser Anschlag wurde mit der Untersuchung einer von Wurm angeordneten finanziellen Transaktion begründet, an der in Wirklichkeit aber nichts zu beanstanden war.
Da Mayer-List nach Ansicht des damit beauftragten Rechtswalters der Evangelischen Kirche Deutschlands Wurm „falsch beraten“ habe, wurde auch er kurzerhand beurlaubt, ein Zustand, der vom 14. September bis zum 19. November 1934 andauerte. Wurm selbst wurde zusätzlich unter Hausarrest gestellt.
Dieser Entmachtungsversuch scheiterte aufgrund des starken Rückhalts, den die rechtmäßige Kirchenleitung in den Gemeinden genoss, sowie an der rechtlichen Unhaltbarkeit des Vorgehens. Die NSDAP realisierte bald, dass die Aktion ihrem Ansehen in der Bevölkerung und vor der internationalen Öffentlichkeit schadete.
Bereits 1943 trat Mayer-List aufgrund eines Herzleidens in den Ruhestand ein, den er in Stuttgart verbrachte. Nach 1945 war er als Mitberichterstatter mit der Aufgabe der Entnazifizierung der württembergischen evangelischen Pfarrerschaft betraut. Am 31.12.1949 verstarb er in seiner Geburtsstadt Stuttgart.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/mayer-list-max (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Mögling, Hermann
-
Von: Quack, Jürgen
Hermann Mögling (1811-1881)
-
Herrmann Mögling 1836
Archiv der Basler Mission, QS-30.001.0131.01
Als 1922 die Peter und Paul Kirche in Mössingen renoviert wurde, wurden zwei neue Glasfenster eingebaut: Ein Auswandererfenster und ein Missionsfenster, das die Verbindung der Gemeinde zur Basler Mission ins Bild setzt. Zweimal ist in diesem Fenster Herrmann Mögling (geboren 1811 in Brackenheim, gestorben 1881 in Esslingen) zu sehen, als junger Vikar 1834/35 seines Vaters Friedrich Mögling, (links unten) in Mössingen-Belsen, der sich 1835 in Basel bewarb und Anfang 1836 nach Indien ausreiste. Die zweite Abbildung zeigt ihn in Indien, zusammen mit seiner Frau Pauline geborene Bachmeister. Beide waren besonders in der Schularbeit und in der Erforschung der kanaresischen Sprache und Kultur tätig, zwei für die Missionsarbeit wichtige Grundlagen. Die indischen Mädchen im Bild stehen für die Schule, die Bücher in den Händen von Herrmann und Pauline Mögling für ihre wissenschaftliche Arbeit. Im Heimaturlaub 1858 bekam er von der Universität Tübingen dafür die Ehrendoktorwürde.
-
Das Missionsfenster der Peter und Paul Kirche in Mössingen
Foto: Albrecht Ebertshäuser
Unter Herrmann Möglings Portrait ist die Kirche in Anandapur zu sehen, einer Gemeinde, wo er zusammen mit seinem indischen Freund Herrmann Kaundinya tätig war. Es war eine neue Siedlung für indische Christen, die mit der Taufe von der traditionellen Dorfgemeinschaft abgelehnt wurden und kein Land mehr zugeteilt bekamen. Kaundinya ist auf dem linken Bild zu sehen. Er war der erste Inder, der 1846-1852 in Basel für die Missionsarbeit ausgebildet wurde. Neben ihm seine Frau Marie geb. Reinhardt (geboren 1837 in Schömberg, gestorben 1919 in Esslingen).
Das Glasfenster erinnert nicht nur an einen Missionar, der von Mössingen aus in die Welt gezogen ist, sondern auch daran, dass die weißen Missionare auf die Mitarbeit und Hilfe von Einheimischen angewiesen waren.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/mogling-hermann (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Oetinger, Friedrich Christoph
-
Von: Ising, Dieter
Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782)
-
Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782), Kupferstich
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 2425
Evangelischer Theologe, württembergischer Pfarrer und Prälat, geboren in Göppingen 2.(oder 6.)Mai 1702, gestorben in Murrhardt 10. Februar 1782. 1722–1727 Studium im Tübinger Stift, 1729–1730, 1733–1735 und 1735–1737 ausgedehnte Reisen u.a. nach Halle und Herrnhut, 1731–1733 und 1737–1738 Repetent, 1738 Pfarrer in Hirsau, 1743 in Schnaitheim, 1746 in Walddorf, 1752 Dekan in Weinsberg, 1759 Dekan in Herrenberg, 1766 Prälat in Murrhardt.
Ein junger Mann, Klosterschüler in Bebenhausen und kurz vor dem Übergang ins Tübinger Stift, steht vor einer bedeutsamen Weichenstellung. Er, der hochbegabte Friedrich Christoph Oetinger, eine strahlende Erscheinung, hat sich zu entscheiden zwischen der Laufbahn eines Juristen, die ihm den Weg in hohe politische Ämter verspricht, und dem geistlichen Stand. Seine ehrgeizige Mutter liegt ihm in den Ohren, den weltlichen Weg zu gehen; der Vater bedroht ihn dagegen „mit einer Art des Fluchs“, sollte er die Ausbildung zum württembergischen Pfarrer abbrechen. Oetinger ist sich selbst nicht im Klaren. In der Not wendet er sich an seine Lehrer in Bebenhausen und den Onkel Elias Camerer, Professor der Medizin in Tübingen. Auch sie tendieren dazu, er habe „kein geistlich Fleisch“ und solle die geistliche Ausbildung verlassen (Oetinger Genealogie: 46 f.).
Oetinger tut das Richtige. Er hört auf seine innere Stimme und bemerkt in sich „eine viel grössere Neigung zur Gottseeligkeit, als der Aussenschein angibt“. In seiner Kammer fällt er auf die Knie, hält die weltliche Laufbahn und ihr Sozialprestige gegen ein Leben als Diener Gottes. Und da kommt es ihm: „Deo servire Libertas“ – Gott dienen ist Freiheit. „Auff dieses rieff ich Gott von ganzem Herzen an, mir alle Absichten auf die welt aus der Seele zu nehmen, und das geschahe so gleich.“ Von da an ist er ein anderer Mensch. Galante Kleidung bedeutet ihm nichts mehr; den Cicero legt er beiseite und greift zur Bibel (Oetinger Genealogie: 47 f.).
Der Oetinger, der 1722 ins Stift einzieht, hat sich seine Entscheidung erkämpfen müssen. Er hat den befreienden Gott erlebt, nicht einen Gott, der Kadavergehorsam fordert. Und so bleibt er – auf seiner neuen, geistlichen Basis – ein Gottsucher, der seine Lehrer und sich selbst fordert. Den „Grund der theologischen warheiten“ will er wissen. Leidenschaftlich setzt er sich verschiedenen Begegnungen aus, etwa mit den Inspirierten um Friedrich Rock, deren prophetische Aussagen er anhand der biblischen Prophetie prüft und sich schließlich von Rock lossagt. Aber nicht nur das, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat, treibt Oetinger um, sondern auch, wie Schöpfung geschehen ist und geschieht. Georg Bernhard Bilfingers Vorlesungen über die Philosophie von Leibniz und Christian Wolff imponieren ihm. In diese damals neuen Gedankengänge taucht er ein und hängt eine Zeitlang der Leibnizschen Monadenlehre an, wonach Gott als Urmonade Körper und Seele der Menschen schafft, die nur Anhäufungen metaphysischer Punkte sind und nicht aufeinander wirken können, es sei denn als Folge einer von Gott geschaffenen „praestabilierten Harmonie“. Dann wendet sich Oetinger der Philosophie von Nicholas Malebranche zu, die das Wechselspiel von Körper und Seele nur durch wiederholte Eingriffe Gottes erklären kann. Aber auch damit ist er nicht zufrieden und liest ruhelos im Neuen Testament.
Seine bekannte Begegnung mit Johann Caspar Obenberger, dem Betreiber der Tübinger Pulvermühle, findet etwa 1725 statt, fällt also in diese Zeit. Obenberger, ein Anhänger Jacob Böhmes, hat sich einen Schutzraum gegraben, um den für die nahe Zukunft erwarteten Fall Babels (Apk 18) zu überleben. „Babel“ ist für Böhme auch die Kirche seiner Zeit, und so treffen mit dem Stiftler Oetinger, der sich auf den Kirchendienst vorbereitet, und dem Anhänger Böhmes zwei Welten aufeinander. Obenberger redet Klartext: „Ihr Candidaten seyd gezwungene Leute, ihr dürft nicht nach der Freyheit in Christo studieren; ihr müßt studieren, wozu man euch zwingt“ (Oetinger Genealogie: 61). Er zeigt ihm eine Schrift von Jacob Böhme. Oetinger stutzt, leiht sich das Buch aus und ist von dessen dynamischer Schöpfungslehre begeistert. Oetinger verabschiedet sich von der aus Leibniz und Malebranche gezogenen Vorstellung, als ob Schöpfung durch das ewige Wort Gottes eine Matrix erzeugt habe, in welcher wie in einem Mutterleib alle künftig zu gebärenden Menschen „in Speculis monadicis in monadischen Abbildern stille stehen“. Schöpfung, wie sie Böhme versteht, ist dagegen ein göttlicher „actus purissimus“, ein dynamisches Geschehen, welche aus dem Gegenspiel von göttlichem Zorn, Liebe und Geist hervorgeht. Bei aller Faszination legt Oetinger jedoch Wert darauf, „kein Nachäffer“ Böhmes zu sein; dieser habe im Bemühen, unsagbare Worte zu sagen, auch Fehler gemacht (Oetinger, Genealogie, 63 f.). Oetingers Erstlingswerk würdigt Böhmes Entwurf unter dem Titel Aufmunternde Gründe zu Lesung der Schrifften Jacob Boehmens (1731).
Zumindest ist für ihn der Schritt vollzogen weg von einer atomisierenden Schöpfungslehre, die Gott als vollkommenen Intellekt definiert, der an die von ihm geschaffenen Naturgesetze gebunden sei (Christian Wolff). Hier kann die biblische Offenbarung nichts über die Vernunft hinaus lehren. Oetingers Magisterdisputation vom Mai 1725, die er unter dem Vorsitz des Professors für Metaphysik Christian Hagmajer hält, befasst sich mit Wolffs Satz vom hinreichenden Grund der Erkenntnis. Hagmajer hält Wolffs Ansicht für „mangelhaft“ (Oetinger Genealogie: 69), was Oetingers Zweifel bestärkt. In der Folgezeit studiert er die Bibel, die Kirchenväter und auch rabbinische Literatur. Seine Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, hat sich vom Rationalismus gelöst und wird zur Frage nach den „letzten Begriffen“ bei Jesus und den Aposteln. Oetingers Resümee: Jesus hat die Grundbegriffe des Lichts und der Finsternis gebraucht (vgl. Mt 6,23; 10,27 u.ö.), und auch die Apostel haben ihr Erkennen so verstanden: „Gott, der das Licht aus der Finsterniß geruffen, hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben [2 Kor 4,6]: das ist genug für uns.“ Man muss „der heiligen Schrift ihre Gränzen respectiren“ (Oetinger Genealogie: 77 f.).
Dabei will Oetinger die Bedeutung der Vernunft keineswegs herabwürdigen – im Gegenteil, sie ist für ihn ein äußerst effektives Werkzeug. Aber muss man Werkzeuge anbeten, indem man ihre Bedeutung absolut setzt? Was er in der Bibel, bei den Kirchenvätern und Rabbinen findet, sagt ihm übereinstimmend: Allem zugrunde liegt das Handeln Gottes als Schöpfer und Vollender der Welt; beides ist der Vernunft auf direktem Wege nicht zugänglich, sondern nur aufgrund göttlicher Offenbarung. Kein Irrationalist will Oetinger sein, sondern ein Ideologiekritiker der menschlichen Vernunft.
In den folgenden Jahren wird Oetinger hervorheben, dass die Vernunft – unbeschadet ihrer Grenzen – die Spuren göttlichen Handelns in der Schöpfung nachvollziehen könne. Dies geschehe, indem man die Bibel nicht auf rationalistische Weise in „leere und entkräftete Sätze verwandelt“, sagt er in der Lehrtafel der Prinzessin Antonia (1763). Stattdessen habe man Gottes in der Bibel geschilderten Naturwerke, die von ihm geschaffene belebte und unbelebte Welt, zu erforschen – nicht allein mit Verstand und Empirie, sondern auch mit Hilfe eines von Oetinger postulierten allgemeinen Wahrheitsgefühls aller Menschen, das er als sensus communis oder „Weisheit auf der Gasse“ bezeichnet. Dann werde das Lesen im Buch der Natur zur Verstehenshilfe für das Buch der Schrift. Beides gehöre zusammen und führe zu einem Gesamtsystem der Wahrheit, der „Heiligen Philosophie“ (philosophia sacra).
Im Herbst 1727 legt er das theologische Examen ab. Die Stiftszeugnisse bescheinigen ihm gute geistige Anlagen, Fortschritte vor allem im Studium der systematischen und praktischen Theologie sowie eine aus seinem Verhalten hervorleuchtende Frömmigkeit („e moribus elucet pietas“; zitiert nach Ehmann: 57).
Seine unter inneren Kämpfen gewonnene Erkenntnis verteidigt er auch in der Folgezeit mit Nachdruck. Als eine 1728 veröffentlichte Schrift seines früheren Bebenhausener Lehrers Israel Gottlieb Canz versucht, die Leibniz-Wolffsche Philosophie auf die Theologie anzuwenden, stellt er ihn zur Rede: „Ich gieng einmahl zu Prof. Canz und obtestirte beschwor ihn, ob er sich getraute, gewiß zu seyn, daß die Apostel und Jesus Christus eben diese lezte Begriffe gehabt wie er, und ob er nach dem tod sie eben so finden werde, als er es dreiste im Lehren vorgebe. Er sagte: Ja; ich aber sagte: Nein; er werde sie nicht so finden“ (Oetinger Genealogie: 74). In einem Brief vom 19. Januar 1728 an Johann Albrecht Bengel, als dessen Tübinger Korrespondent Oetinger seit 1727 fungiert, macht er seinem Ärger Luft: Das Werk von Canz sei eine „nova a Sacrae conceptibus Scripturae diversio“, eine neue Abweichung von den Gedanken der Heiligen Schrift (Bengel Briefe 1723–1731).
Das Amt dessen, der Bengel über Tübinger Vorkommnisse und neu erschienene theologische Literatur auf dem Laufenden hält, hat Oetinger 1727 vom zwei Jahre älteren Jeremias Friedrich Reuß übernommen, der als Hauslehrer nach Stuttgart geht. Diesem, dem ehemaligen Lieblingsschüler in Denkendorf, vertraut Bengel seine apokalyptischen Berechnungen an, welche die Zahl des in Apk 13 genannten widergöttlichen Tiers als 666 bestimmen: „Inveni numerum bestiae, Domino dante“ (Bengel an Reuß 22.12.1724, in: Bengel Briefe 1723–1731). Diese Eingebung vom 1. Advent 1724 arbeitet Bengel weiter aus und meint, einen Schlüssel gefunden zu haben, um vergangene und künftige Ereignisse in ein endzeitliches Schema einordnen zu können. Von Anfang an erhält Oetinger von Reuß Einsicht in die Bengelschen Briefe. Oetinger betrachtet Bengel als Autorität, wenn es um das rechte Verstehen der Bibel geht. Im April 1733 wird er in dem Bemühen, den Grafen Zinzendorf von Bengels System zu überzeugen, mit diesem einen Besuch in Denkendorf machen. Auch als Oetinger in den folgenden Jahren – wieder unter schweren Kämpfen – Zinzendorfs Bibelverständnis den Abschied gibt, ist ihm die vertraute Beziehung zu Bengel hilfreich.
Als examinierter Stiftler bleibt man, dem damaligen Brauch folgend, im Stift und kehrt nach Vikariaten oder Reisen wieder dorthin zurück, bis man eine feste Anstellung im Kirchendienst gefunden hat. Für Oetinger gilt diese Regel mit Einschränkungen, die von der Stiftsleitung offensichtlich gebilligt werden. Als seine Mutter am 19. Juli 1727 in Göppingen gestorben ist und ihn in einem Abschiedsbrief ermahnt hat, sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern, unterrichtet er nach dem Examen im Herbst 1727 seine drei Brüder in Tübingen, im Haus des herzoglichen Finanzbeamten Georg Gottfried Härlin. Im November 1728 werden Oetinger und seine Brüder krank und müssen sich ins heimatliche Göppingen begeben. Von dort kehrt er erst an Georgii (23. April) 1729 ins Stift zurück, um sich danach auf seine erste wissenschaftliche Reise zu begeben, die ihn nach Frankfurt am Main, Jena, Halle, Herrnhut und Berleburg führt. Seit Ende 1730 wieder in Tübingen, wird er 1731 Repetent am Stift (Oetinger Genealogie: 88–106). Es folgen zwei weitere längere Reisen in den Jahren 1733–1737. Danach unterrichtet Oetinger wieder als Repetent in Tübingen, bis ihm 1738 seine erste Pfarrstelle in Hirsau übertragen wird (Oetinger Genealogie: 108–127).
Hier ist nicht der Ort, die Erlebnisse und Begegnungen auf diesen Reisen zu schildern. Oetinger ist in seiner autobiographischen Genealogie der reellen Gedancken eines Gottes-Gelehrten ausführlich darauf eingegangen, auch auf die weiteren Lebensstationen als Pfarrer in Schnaitheim (1743) und Walddorf (1746), als Dekan in Weinsberg (1752) und Herrenberg (1759) sowie als Prälat in Murrhardt (1766). Darüber hinaus ist die Selbstbiographie eine wichtige Quelle für sein Verhältnis zu Zinzendorf, für Oetingers spätere alchemistischen Versuche, seine ambivalente Würdigung des Geistersehers Swedenborg und die Auseinandersetzungen mit dem Konsistorium. Ergänzendes Quellenmaterial bietet Oetingers Briefwechsel mit Bengel, Friedrich Christoph Steinhofer, Ludwig Friedrich Graf zu Castell-Remlingen und anderen (Auszüge in Ehmann: 429–836; vgl. Bengel Briefe 1723–1731).
Oetinger war mehr als ein aufmüpfiger Stiftler. Er hat sich dem zeitgenössischen rationalistischen Trend entgegengestellt, ohne die Bedeutung der Vernunft zu leugnen. Aus einem immensen theologischen und naturwissenschaftlichen Wissen schöpfend, hat er auf der Höhe seiner Zeit und in den Grenzen seiner Zeit einen Gegenentwurf formuliert, mutig und angesichts zahlreicher Kritiker, die ihm das Leben schwer machten. Wir haben Oetinger nicht zu kopieren, aber seinen Versuch einer Ideologiekritik der menschlichen Vernunft zu achten.
Zuerst veröffentlicht in: Volker Henning Drecoll, Juliane Baur, Wolfgang Schöllkopf (Hgg.), Stiftsköpfe. Tübingen: Mohr Siebeck 2012, S. 76–82. Mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Werkausgaben:
Weiterführende Links
OETINGER, Friedrich Christoph: Aufmunternde Gründe zu[!] Lesung der Schrifften Jacob Boehmens …, Frankfurt und Leipzig 1731.
OETINGER, Friedrich Christoph: Biblisches und Emblematisches Wörterbuch, dem Tellerischen Wörterbuch und Anderer falschen Schrifterklärungen ent-gegen gesezt, (Heilbronn am Neckar) 1776.Historisch-kritische Ausgabe: Biblisches und Emblematisches Wörterbuch, hg. von Gerhard Schäfer in Verbindung mit Otto Betz und anderen. Teil 1: Text; Teil 2: Anmerkungen (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. VII, III,1.2), Berlin/New York 1999.
OETINGER, Friedrich Christoph: Genealogie der reellen Gedancken eines Got-tes-Gelehrten. Eine Selbstbiographie, hg. von Dieter Ising, Leipzig 2010.
OETINGER, Friedrich Christoph: Offentliches Denckmahl der Lehr-Tafel einer weyl[and] Würtembergischen Princeßin Antonia …, Tübingen 1763. Historisch-kritische Ausgabe: Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia, hg. von Reinhard Breymayer und Friedrich Häussermann. Teil 1: Text; Teil 2: Anmer-kungen (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. VII, I,1.2), Berlin/New York 1977.
BENGEL, Johann Albrecht: Briefwechsel, Bd. 2: Briefe 1723–1731, hg. von Dieter Ising (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. VI, 2), Göttingen 2012. Die Bände 3 ff. sind in Vorbereitung.
Literatur:
BETZ, Otto: Licht vom unerschaffnen Lichte. Die kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia in Bad Teinach, Metzingen 1996.
BRECHT, Martin: Der württembergische Pietismus, in: Brecht, Martin/ Dep-permann, Klaus (Hgg.): Geschichte des Pietismus, Bd. 2: Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1995, 225–295 (zu Oetinger: 269–288).
EHMANN, Karl Christian Eberhard (Hg.): Friedrich Christoph Oetinger’s Leben und Briefe, als urkundlicher Kommentar zu dessen Schriften herausgegeben …, Stuttgart 1859.
GUTEKUNST, EBERHARD/ZWINK, EBERHARD: Zum Himmelreich gelehrt. Fried-rich Christoph Oetinger 1702–1782, württembergischer Prälat, Theosoph und Naturforscher, Stuttgart 1982.
KUMMER, Ulrike: Autobiographie und Pietismus. Friedrich Christoph Oetin-gers Genealogie der reellen Gedancken eines Gottes-Gelehrten. Untersuchun-gen und Edition, Frankfurt am Main etc. 2010.
SPINDLER, Guntram (Hg.): Glauben und Erkennen. Die Heilige Philosophie von Friedrich Christoph Oetinger. Studien zum 300. Geburtstag. Mit einem Geleitwort von Gerhard Schäfer, Metzingen 2002.
WEYER-MENKHOFF, Martin: Christus, das Heil der Natur. Entstehung und Sys-tematik der Theologie Friedrich Christoph Oetingers (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 27), Göttingen 1990.
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/24 (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Osiander, Lucas
Lucas Osiander der Jüngere (1571-1638)
-
Lucas Osiander d.J.
gemeinfrei (Quelle: Professorengalerie der Universität Tübingen)
Fast wäre sein Leben schon zwei Jahre zuvor zu Ende gegangen, denn da wurde der Kanzler der Universität Tübingen auf der Kanzel der Stiftskirche mit einem Messer angegriffen. Wie konnte es soweit kommen?
Als Lukas Osiander der Jüngere am 6. Mai 1571 in Stuttgart geboren wurde, war der württembergische Reformator Johannes Brenz im Jahr zuvor gestorben und die Erben der Reformation stritten um die richtige Fassung der lutherischen Lehre. Der Aufbruch aus der Freiheit des Evangeliums drohte in Rechthabereien zu ersticken. Jacob Andreae wollte im Konkordienbuch die Eintracht (concordia) wieder herstellen. Osiander selbst sollte einen wesentlichen Beitrag zur polemischen Zuspitzung der konfessionellen Auseinandersetzungen leisten, die schließlich die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges mit heraufbeschworen.
Kanzel- und Kathederkarriere
Lukas Osiander stammte aus einer großen Theologenfamilie. Schon sein Vater gleichen Namens, der Herausgeber des ersten württembergischen Gesangbuchs, war Mitglied der Kirchenleitung. Sein älterer Bruder Andreas war bereits 1605 ebenfalls Kanzler der Tübinger Universität, die damals zum "lutherischen Spanien" wurde. Lukas Osiander wurde nach seinem Studium Stiftsrepetent, dann Pfarrer in Göppingen, Dekan in Leonberg sowie Prälat von Bebenhausen und Maulbronn. Ab 1618 lehrte er als Professor in Tübingen mit dem Schwerpunkt Kontroverstheologie und Polemik. In diesen Fächern ging es darum, das überlegene Luthertum gegen die anderen Konfessionen scharf abzugrenzen. Viel Schweiß der Edlen wurde für diese polemischen Auseinandersetzungen vergossen, dazu zuerst Tinte, dann auch Blut. Aus theologischen Entdeckungen drohten Richtigkeiten zu werden. Der scharfsinnige Theologe stritt gegen Calvinisten, Schwenkfelder, Wiedertäufer und Jesuiten. Auch am Streit mit den Gießener Theologen über die Person Christi wirkte er mit.
"Anti-Arndt"
Schließlich überspannte er fast den Bogen seiner Streitereien, als er vor den, gerade in Württemberg mit Interesse aufgenommenen Büchern Johann Arndt's "Vom wahren Christenthum" (1610) warnte. Er warf ihm eine mystische Position vor, die das innere dem äußeren Wort vorzog. Wieder waren seine Beobachtungen durchaus zutreffend, seine Abgrenzungen aber überzogen. Manche sagten gar, bei ihm sei der Heilige Geist ein Rabe und keine Taube!
Angriffe
Wer Wind sät, wird Sturm ernten (nach Hosea 8, 7). Die zunehmenden polemischen Abgrenzungen führten zu Aggressionen, die schließlich nicht nur den grausamen Konfessionskrieg beförderten, sondern auch auf Osiander persönlich zurückschlugen, als eines Sonntags der Spiritualist und selbsternannte Prophet Ludwig Friedrich Gifftheil aus Böhringen die Kanzel der Tübinger Stiftskirche erstürmte und den Kanzler erstechen wollte. Dieser aber überlebte auch diesen Angriff und starb eines natürlichen Todes am 10. August 1638 in Tübingen. Aber kann es scharfsinnige theologische Erkenntnis nicht auch ohne aggressive Abgrenzungen geben, oder, wie es der Straßburger Reformator Martin Bucer sagte, ohne Feindbild und Schmähung der anderen? Eine noch immer aktuelle Frage!
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/osiander-lucas (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Pfisterer, Rudolf
-
Von: Löblein, Friedrich
Rudolf Pfisterer (1914-2005)
Rudolf Pfisterer wurde am 28. März 1914 in Weinsberg als Sohn des späteren Marbacher Dekans Heinrich Pfisterer (* 1877 Basel † 1947 Marbach am Neckar) geboren.
Ausbildung und Beruf
-
Rudolf Pfisterer (1914-2005)
Foto: Elisabeth Pfisterer
Rudolf Pfisterer war Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Nach dem Theologiestudium in Tübingen (Tübinger Stift), Bonn und Königsberg/Ostpreußen begann er 1941 seinen Pfarrdienst in Gelbingen, Dek. Schwäbisch Hall. Wehr- und Kriegsdienst leistete er als Funker in Jugoslawien, in Stalingrad und in der Normandie. 1948 ging er freiwillig in französische Kriegsgefangenschaft, um in Montélimar einen Kollegen als Seelsorger für gefangene Soldaten abzulösen. Die dortigen Begegnungen mit französischen Christen und Juden ließen ihn zu einem frühen Begleiter der deutsch-französischen Partnerschaft werden, wobei er sich vor allem dem christlich-jüdischen Dialog widmete. Ab 1952 war er als Pfarrer, Oberpfarrer und später Dekan Seelsorger in der Jugendstrafanstalt Schwäbisch Hall.
Christlich-jüdischer Dialog
Im Rahmen seiner Lebensaufgabe des christlich-jüdischen Dialogs führte er eine umfangreiche Korrespondenz mit Partnern im In- und Ausland, hielt unzählige Vorträge, verfasste zahlreiche Zeitschriftenbeiträge und schrieb eine Vielzahl von Publikationen. Für dieses Engagement und die damit verbundenen wissenschaftlichen Leistungen wurde ihm 1963 von der Faculté Libre de Thélogie Protestante de Paris der Titel eines Dr. theol. ehrenhalber und 1986 vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg der Titel eines Professors verliehen. Rudolf Pfisterer war auch Träger der Otto-Hirsch-Medaille (1992).
Familie
Seine Frau Elisabeth Pfisterer geb. Klenk erhielt 1994 für ihr vielfältiges soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz. Von seinen fünf Kindern war der Sohn Dr. Karl Dieterich Pfisterer Theologischer Vorstand des Diakonischen Werkes der EKD, der Sohn Rudolf Pfisterer Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Rudolf Pfisterer ist am 29. Oktober 2005 in Schwäbisch Hall gestorben.
Schriftstellerisches Werk
Einige seiner Veröffentlichungen: Juden - Christen, getrennt - versöhnt (1964) – Im Schatten des Kreuzes (1966) – Von A bis Z. Quellen zu Fragen um Juden und Christen (1973, 21985) – Zwischen Kasernenhof und Schlaraffenland. Erwägungen zum Strafvollzug (1973) –Verantwortung. Informative Texte: Jüdisch-Christlicher Dialog / Strafvollzug (1973) – Israel oder Palästina? Perspektiven aus Bibel und Geschichte (1992) – Kompaß im Chaos. Die Zehn Gebote (1998) – Der vergessene Schatz. Stabile Währung für unseren Weg: Das Glaubensbekenntnis (1994). – Von 1977 an übersetzte er vom Französischen ins Deutsche das 4-bändige Standardwerk von Léon Poliakov: Geschichte des Antisemitismus. 1984 wurde ihm eine Festschrift gewidmet: Scheidewege. Ein Leben für den Christlich-Jüdischen Dialog.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/pfisterer-rudolf (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Planck, Reinhold
-
Von: Butz, Andreas
Inhaltsverzeichnis
Reinhold Planck (1866-1936)
1: Familienverhältnisse
V Karl Christian P. (17.1.1819-7.6.1880), Ephorus, Philosoph. M Auguste P., geb. Wagner (20.12.1834-1925). G Karl (*31.5.1857-1899), Marie (*9.7.1858), Adelheid (*16.5.1860-1894), Mathilde (*29.11.1861-31.7.1955), Hermann (*21.11.1868-1932), Klara (*21.4.1873-1892). ∞ 1896 Anna, geb. Meyer (7.9.1869/nach russischer Zeitrechnung 26.8.1869-24.6.1946), Tochter des Hermann Mayer, Schieferölfabrikant. K Walter (7.10.1902-1937), Margarete, verh. Reusch (*23.4.1908).
2: Biographische Würdigung
Als P. am 3. Februar 1866 geboren wurde war sein Vater Karl Christian Planck, der ein umfangreiches philosophisches Werk hinterlassen hat, Lehrer am Gymnasium in Ulm. 1869 zog die damals achtköpfige Familie nach Blaubeuren, wo der Vater am dortigen Seminar als Professor wirkte. An diesem Ort besuchte P. von seinem sechsten bis achten Jahr die Elementar-, von seinem achten bis 13. Jahr die Lateinschule. Der Vater, der 1879 Ephorus des Seminars Maulbronn wurde, verstarb bereits im Jahr nach dieser Ernennung. P. war zu diesem Zeitpunkt erst vierzehn Jahre alt. Kanzleirat Planck in Stuttgart nahm ihn als Pflegesohn an. So kam es auch, dass P. nach einem halben Jahr vom niederen theologischen Seminar in Maulbronn zu dem Gymnasium in Stuttgart wechselte, das er bis zu seinem 18. Lebensjahr besuchte. Nach bestandener Konkursprüfung studierte er ohne Unterbrechung am Tübinger Stift Theologie, um für den Beruf des evangelischen Pfarrers ausgebildet zu werden. Von der Militärpflicht als Einjähriger war er wegen Untauglichkeit befreit. Nach Abschluss dieses Studiums führte ihn der unständige Dienst als Vikar und als Pfarrverweser nach Eberdingen, Ensingen und Reichenbach. Unmittelbar nach Beendigung seiner Zeit in Reichenbach im Februar 1891 wurde er für ein halbes Jahr beurlaubt und nahm für diesen Zeitraum eine Anstellung als Privatlehrer in Oberstdorf in Bayern an. Im Oktober des Jahres wurde er Pfarrverweser in Bronnweiler bei Reutlingen, wo er im Pfarrhaus auch seine Mutter - und zeitweise auch seine Schwester - aufnehmen konnte, die ihm den Haushalt führten. Immer wieder musste er darauf achten, sich zu schonen, da er – konstitutionell bedingt – bei Überanstrengung zu nervöser Ermattung mit körperlichen Begleiterscheinungen neigte. 1895 wurde er in Bronnweiler, wo er bereits seit vier Jahren als Pfarrverweser tätig war, zum Pfarrer ernannt. Im Frühherbst dieses Jahres führte ihn eine mehrwöchige Studienreise nach Norddeutschland, unter anderem um an einer sozialistischen Tagung in Berlin teilnehmen zu können, ein Zeichen dafür, dass er sich bereits vermehrt mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzte. Nun, da durch die Pfarrerstelle die äußeren Verhältnisse gesichert waren, konnte eine Ehe geschlossen werden, und zwar 1896 mit einer Reutlinger Fabrikantentochter. Seine Tätigkeit in Bronnweiler ließ ihm noch Zeit zur wissenschaftlichen Weiterbildung. 1908 erfolgte der Wechsel auf die Pfarrstelle Winnenden, wo er fast ein Vierteljahrhundert wirken sollte. 1910 nahm er an dem „5. Weltkongress für ein freies Christentum und religiösen Fortschritt“ in Berlin teil, dem ersten interreligiösen Kongress in Deutschland, den liberale protestantische Theologen maßgeblich gestalteten. In den Folgejahren tat sich der denkerisch veranlagte Pfarrer auch als Vortragsredner zu christlichen und sozialen Themen hervor und äußerte sich vermehrt in publizistischen Beiträgen. Durch den Verlauf des Weltkrieges wurde P. zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Werk seines Vaters inspiriert und war davon überzeugt, dass dessen Rechtsphilosophie für die Zeit des kommenden gesellschaftlichen Umbruches praktisch umsetzbare Antworten enthalte. Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsbegriff in der Philosophie seines Vaters führte dazu, dass er im Jahr 1921 in Tübingen über dieses Thema promovierte. Im selben Jahr trat P. als Redner auf der ersten „christrevolutionären“ Tagung im Stuttgarter Sieglehaus auf. Für soziale Probleme hatte er lebhaftes Interesse und fühlte sich dem religiösen Sozialismus verbunden. Auch von der Persönlichkeit und dem Werk Friedrich Naumanns war er beeinflusst. Wie sein Dekan ihm 1923 bescheinigte, war P. ein Vertreter eines Christentums der Tat, im Gegensatz zu einem Christentum des Glaubensbekenntnisses. Durch das gesellschaftspolitische Engagement, das er nicht streng von seiner amtlichen Tätigkeit als Pfarrer trennte, entfremdete er sich zunehmend von Teilen seiner Gemeinde. Auch seine vorgesetzte Behörde sah sich aufgrund seiner vermehrten Aktivitäten nun immer öfter genötigt, sich mit seiner Person zu beschäftigen.
Seinen Ruhestand, der im Jahr 1931 eintrat, verbrachte er in Ludwigsburg. 1933 ließ er sich dort von der SPD als Kandidat für die Gemeinderatswahl aufstellen. Allerdings trat er noch vor der ersten Sitzung im April 1933 zurück, um die Kirche durch seine politische
Tätigkeit - gerade auch im Hinblick auf zu erwartende Konflikte mit den Nationalsozialisten - nicht zu belasten.
Im Jahr 1935 gründete er gemeinsam mit seiner Schwester Mathilde, die sich wie er um die Verbreitung des geistigen Erbes des Vaters bemühte, die Karl-Christian-Planck-Gesellschaft, die in Ludwigsburg und in Stuttgart Mitglieder fand. Noch kurz vor seinem Tod versuchte er, die Nationalsozialisten für einen Teil der Philosophie seines Vaters zu gewinnen. Am 13. September 1936 verstarb er in Ludwigsburg nach längerer, schwerer Krankheit.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Zum Gedächtnis an Reinhold Planck, Dr. phil., Stadtpfarrer i.R., 1937
Schwäbischer Merkur 1936, Nr. 219,9
Quellen:
LKAS, A 127, Nr. 1798
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/planck-reinhold (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Rebmann, Johannes

-
Von: Kittel, Andrea
Inhaltsverzeichnis
Johannes Rebmann (1820-1876)
1: Herkunft und Ausbildung
Entdecker des Kilimandscharo, Erforscher mehrerer ostafrikanischer Sprachen, Geograf und Missionar: Das Leben und Wirken des am 16. Januar 1820 in Gerlingen geborenen Johannes Rebmann würde sich gut als Stoff für einen Abenteuerroman eignen.
Johannes Rebmann stammte aus einfachen Verhältnissen, war Sohn eines Bauern und Weingärtners. In der Schule fiel er als begabter und in der Bibel belesener Schüler auf. Der Drang nach geistiger und geistlicher Betätigung führte ihn nach der Konfirmation in die pietistischen Privatversammlungen am Ort. Höhere Bildung wie auch soziale und räumliche Mobilität gab es für die bäuerliche Bevölkerung damals nicht. Für einen aufgeweckten jungen Mann wie Johannes Rebmann bot daher der Weg in die Mission die große und wohl auch einzige Chance, in die weite herausfordernde Welt zu kommen.
Als 19jähriger wurde er zur Ausbildung in das Missionshaus in Basel aufgenommen, fünf Jahre später übersiedelte er nach London zur Church Missionary Society (CMS). Von dort aus wurde er 1846 zur Unterstützung des aus Derendingen stammenden Missionars Johann Ludwig Krapf nach Ostafrika in die Gegend um Mombasa gesandt, wo Rebmann schließlich ohne Unterbrechung nahezu 30 Jahre blieb.
2: Missionstätigkeit und Entdeckungen
Ausgezogen war Rebmann, um das Evangelium zu verkündigen. Doch bald hatte er feststellen müssen, dass die Umstände auf dem Missionsfeld überaus schwierig waren. Das Klima war für Europäer strapaziös. Nicht wenige erlagen tropischen Krankheiten oder kamen gewaltsam zu Tode. Sein unmittelbares Umfeld war geprägt von Sklaverei und innerafrikanischem Sklavenhandel unter arabischem Einfluss. Plünderungen und Raubzüge durch umherziehende Stämme waren keine Seltenheit. Die Kulturen und Lebensweisen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die politischen Verhältnisse wie auch die geografische und geologische Situation in diesem Landstrich waren nahezu unbekannt.
So beschlossen Rebmann und seine Mitstreiter, sich zuallererst die notwendigen Grundkenntnisse anzueignen. Sie erlernten Sprachen, die bis dahin niemand erfasst hatte und unternahmen ausgedehnte Erkundungsreisen, um das Missionsfeld erschließbar zu machen.
Auf einer Reise ins Dschaggaland im Jahr 1848 sah Johannes Rebmann als erster Europäer den Kilimandscharo. Einheimische hatten ihm von dem Mondglanz des Gebirges erzählt, dessen Geister jeden töten, der sich seinem Gipfel nähere. Rebmann erkannte, dass es sich um Schnee handelte und berichtete von dem überwältigenden Anblick nach Europa. Während die englischen Geografen seinem Bericht von dem Schneeberg aufgrund der Nähe zum Äquator jahrzehntelang keinen Glauben schenkten, erhielt er von der Geografischen Gesellschaft in Paris eine Ehrenmedaille.
Rebmann hatte sprachlich Zugang zu den Einheimischen und nahm ihre Erzählungen ernst. Durch Beschreibungen und Skizzen schuf er so die Grundlagen für weitere geografische Entdeckungen – wie etwa die der großen Seen im Quellgebiet des Nils. Auch als Sprachexperte leistete er mit seinen Wörterbüchern und Grammatiken in mehreren ostafrikanischen Sprachen wichtige Voraussetzungen für spätere Missionare und Forscher.
Bei allen Verdiensten in der Forschung war die Mission doch seine Herzensangelegenheit geblieben. Große Mühe und Ausdauer hatte es erfordert, bis es endlich gelang, in der Missionsstation Rabai eine kleine christliche Gemeinde aufzubauen – darunter befanden sich auch ehemalige Sklaven. Mit vielen Problemen hatte er fertig werden müssen. Schwer getroffen hat ihn der Verlust seiner Frau und Gefährtin, Emma Tyler, mit der er 15 Jahre verheiratet war, und die 1866 starb. Probleme machte ihm schließlich sein schwindendes Augenlicht. 1875 kehrte er nahezu erblindet nach Gerlingen zurück, geführt und betreut von Isaak Nyondo, einem der ersten Christen in Rabai. Ein Jahr später, am 4. Oktober 1876, starb Johannes Rebmann in Korntal.
Nachwirkungen
Auf dem Kilimandscharo wurde im Jahr 1900 Rebmann zu Ehren ein Gletscher nach ihm benannt. In seinem Elternhaus in Gerlingen hat die Rebmann-Stiftung 2004 ein Museum eingerichtet. Im Internet stellt sie sein Tagebuch, Karten und weitere Quellen zur Verfügung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/rebmann-johannes (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Scheffbuch, Rolf
-
Von: Schnurr, Jan Carsten
Rolf Scheffbuch (1931-2012)
-
Rolf Scheffbuch (1931-2012)
Fotograf: Bernhard Weichel. Mit freundlicher Genehmigung
Den Grundstein für Rolf Scheffbuchs Entwicklung zu dem vielleicht wichtigsten Repräsentanten des württembergischen Pietismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts legte sein Elternhaus. 1931 in Calw geboren, wuchs er in Stuttgart auf. Der Vater, Adolf Scheffbuch, im Dritten Reich entschieden regimekritisch, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg leitender Mitarbeiter im Kultusministerium und CDU-Landtagsabgeordneter. Er vermittelte dem ältesten von sechs Kindern die Faszination für politische und kirchliche Mitgestaltung. Die Mutter, Maria Scheffbuch, und die Großmutter, Johanna Busch, entstammten einer traditionsreichen pietistischen Großfamilie und prägten ihren Sohn bzw. Enkel mit einer erwecklichen, zugleich bildungsbejahenden Bibelfrömmigkeit, die er als fröhlich und unverkrampft erlebte.(1) Großen Einfluss besaßen daneben die beiden Onkel und bekannten Evangelisten Wilhelm und Johannes Busch, deren Vorbild und seelsorgerlicher Begleitung Scheffbuch Entscheidendes für seine geistliche Entwicklung zugeschrieben hat.(2) Unter anderem vermittelten sie ihm die Vision für eine missionarische Jugendarbeit im Rahmen der Landeskirche oder des CVJM, wie sie auch in Stuttgart bald aufblühte. Von 1965 bis 1974 war Scheffbuch dann selbst Leiter des Evangelischen Jugendwerks (bis 1971: Evangelisches Jungmännerwerk) in Württemberg. Wissenschaftlich-theologische Anregungen hatte er während seines Studiums in Bethel, Tübingen und Bonn vor allem von Helmut Thielicke, Otto Michel und Adolf Köberle erhalten; eine bei Köberle in Tübingen begonnene Doktorarbeit blieb unvollendet.(3)
Die längste Zeit seines beruflichen Lebens lagen Scheffbuchs Aufgaben in der Gemeindearbeit. Zwischen 1959, dem Jahr seiner Eheschließung mit Sigrid Gutbrod, und 1965 war er dritter Pfarrer am Ulmer Münster. Ab 1975 lebte die inzwischen sechsköpfige Familie in Schorndorf, wo Rolf Scheffbuch 14 Jahre lang als Dekan und Gemeindepfarrer wirkte. Er besaß die Fähigkeit anschaulich zu predigen, aber auch Menschen auf einer persönlichen Ebene zu begegnen, Vertrauen zu gewinnen und zur Mitarbeit zu motivieren. 1989 bis 1995 kehrte er – nun als Prälat – ans Ulmer Münster zurück. Auch das Amt des Regionalbischofs verstand er als ein pastorales Amt der Begleitung und des Zuspruchs, diesmal für die etwa 500 Pfarrerinnen und Pfarrer seines Sprengels. Gerade die seelsorgerlichen Möglichkeiten seines Berufes waren ihm wichtig. „Es gehört zum besonderen Vorrecht eines Pfarrers, dass er Schwerstkranke und Sterbende begleiten darf“, meinte er etwa(4) und ermutigte dazu, mit Menschen, denen das Gebet fremd geworden ist, gemeinsam zu beten.(5)
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Rolf Scheffbuch jedoch als Kirchenpolitiker. Die Weichen hierfür hatte der württembergische Landesbischof Martin Haug gestellt, als er den jungen Theologen 1957 nach dessen Vikariat zu seinem persönlichen Referenten berief. Die drei Jahre auf dem Oberkirchenrat gaben Scheffbuch Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen des kirchenleitenden Amtes. Von Haug ermutigt, kandidierte er 1965 für die württembergische Landessynode, wurde deren Mitglied und blieb bis 1989, als er wegen seiner Berufung ins Prälatenamt aus der Landessynode ausschied, eine ihrer prägenden Persönlichkeiten. Scheffbuchs kirchenpolitisches Engagement fiel in die Zeit, in der die nunmehr flächendeckend durchgeführte Urwahl zur württembergischen Landessynode(6) dem schwäbischen Pietismus neues Gewicht und damit unerwartete Möglichkeiten der Mitgestaltung brachte. Synodale, die dem Pietismus nahestanden, sammelten sich in dem Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ (bis 1971: „Bibel und Bekenntnis“), der in der Synode über eine relative, zeitweise sogar absolute Mehrheit verfügte. Von 1977 bis 1989 war Scheffbuch Sprecher des Gesprächskreises, daneben mehr als zwei Jahrzehnte lang auch Mitglied der Synode der EKD, in der er eine theologische Minderheitenposition repräsentierte. Als profilierter Kirchenpolitiker, dem viele auch ein hohes politisches Amt zugetraut hätten, wusste er eloquent und verbindlich aufzutreten, Mehrheiten zusammenzubringen und Kompromisse zu schließen. Er konnte aber auch polarisieren, Gegnern entgegentreten und Kompromisse ablehnen, wo er die Geltung von Bibel und Bekenntnis bedroht sah. Das „Kämpferische“, meinte er einmal im Rückblick, sei „eine Gabe Gottes auch, die er manchen Leuten verleiht, die nicht aus falscher Schüchternheit zurückstecken müssen, die stellvertretend für andere eintreten müssen, auch wenn sie schlaflose Nächte haben, ob’s denn richtig war, dass sie den Mund aufgemacht haben“.(7) Scheffbuch wusste, dass er in seiner Kirche nicht nur Freunde besaß.
In der Kritik stand er etwa, als der württembergische Synodalpräsident Oskar Klumpp im Vorfeld des Stuttgarter Kirchentages 1969 zurücktrat, nachdem ihm eine von Scheffbuch mitunterzeichnete Presseerklärung Indiskretionen bezüglich der Beteiligung des Pietismus an dem Großereignis vorgeworfen hatte.(8) Kontrovers war auch die langjährige Auseinandersetzung um die württembergische Haltung zur Genfer Ökumene.(9) Neue missionstheologische Ansätze, denen schon der junge Scheffbuch als Teilnehmer der Ecumencial Student Conference 1955/56 in Athens (Ohio) und als Jungdelegierter auf der Dritten Vollversammlung des ÖRK 1961 in Neu-Delhi begegnet war, hatten in den sechziger Jahren zu inhaltlichen Schwerpunktverschiebungen in der Ökumene geführt. Besonders augenfällig wurden diese in dem 1969/70 entwickelten Antirassismus-Programm mit seinem Sonderfonds zur humanitären Unterstützung verschiedener, auch militärisch operierender, Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika und in der um die Jahreswende 1972/73 durchgeführten Weltmissionskonferenz in Bangkok. Sie veranlassten Scheffbuch als Vorsitzenden des Synodalausschusses Diakonie/Ökumene/Mission gemeinsam mit Landesbischof Helmut Claß, ein Gesprächstreffen einer württembergischen Delegation mit Vertretern des Weltkirchenrates in Genf zu organisieren. Bei dem Treffen vom 16. bis 18. Juni 1974 legten die Württemberger einen Fragenkatalog vor,(10) der ihre Sorge widerspiegelte, der ÖRK habe binnen weniger Jahre sein biblisches Missionsverständnis durch eine (links-)politische Befreiungstheologie und ein teilweise synkretistisches Dialogverständnis ersetzt. Auch wenn Mission dem Bildungsbürger seit Lessing „als Glaubensfanatismus, als Intoleranz“ gelte, wie Scheffbuch wenig später vor der EKD-Synode konzedierte, gehörten nach seiner Auffassung sozialdiakonische Hilfe und das auf „Bekehrung Andersgläubiger“ zielende Glaubenszeugnis zusammen,(11) denn „eine Christenheit, die hilft, aber nicht redet, ist unsozial, lieblos. Mission ist unaufgebbar“.(12) Seine Initiative, die über die EKD bestehende Mitgliedschaft der württembergischen Landeskirche im ÖRK in eine „unmittelbare Mitgliedschaft“ umzuwandeln und diese dann vorerst ruhen zu lassen, scheiterte 1981 nur knapp.(13)
Rolf Scheffbuchs Bedeutung für den theologisch konservativ-pietistischen Flügel der Landeskirche lag allerdings nicht nur in seiner synodalen und kirchenleitenden Tätigkeit. Von dem Korntaler Pfarrer Fritz Grünzweig gefördert, war er schon Ende der 1960er Jahre zu einer treibenden Kraft auch in der 1951 als Evangelisch-Kirchliche Arbeitsgemeinschaft für Biblisches Christentum gegründeten württembergischen Ludwig-Hofacker-Vereinigung (heute: Christusbewegung „Lebendige Gemeinde“) geworden. Fast zwei Jahrzehnte lang, zwischen 1980 und 1999, stand er ihr vor. Als Netzwerk der alt- und neupietistischen Kräfte in der württembergischen Landeskirche wurde sie im Laufe der Jahre zu einem Forum und Impulsgeber für diverse missionarische und diakonische Initiativen, Aktionen und Werke. Hierzu zählten etwa die Hilfsorganisationen Hilfe für Brüder und Christliche Fachkräfte International, das Tübinger Albrecht-Bengel-Haus, die Jugendmissionskonferenzen und die Süddeutschen Missionswochen. Auf publizistischem Gebiet entstanden eine eigene Lesepredigtreihe für Lektoren bzw. Prädikanten, die Lutherbibel erklärt und die Zeitschrift Lebendige Gemeinde. Zentrale Veranstaltung blieb die seit 1956 jährlich an Fronleichnam stattfindende Ludwig-Hofacker-Konferenz (seit 1996: Christustag), die ein sprunghaftes Wachstum erlebte und seit den siebziger Jahren zumeist parallel an mehreren Orten abgehalten wurde.(14) Gemeinsam mit seinem Bruder Winrich, einem Stuttgarter Pfarrer, brachte Rolf Scheffbuch auch den von der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ 1973 in Dortmund veranstalteten evangelikalen Gemeindetag unter dem Wort nach Württemberg: Seit 1975 wurde die Ludwig-Hofacker-Konferenz in mehrjährigen Abständen (bis 2002 sieben Mal) zu einem für ganz Deutschland konzipierten Gemeindetag in Stuttgart ausgeweitet. Diese Großveranstaltungen, die die Württemberger – anders als Teile der Bekenntnisbewegung – von kirchenpolitischer Konfrontation mit der Landeskirche oder dem Deutschen Evangelischen Kirchentag freihalten und als glaubensstärkende „Feste des Volkes Gottes“(15) gestalten wollten, erreichten in den 1980er Jahren Besucherzahlen von jeweils fünfzig- bis sechzigtausend.(16)
Die Organisationsform, die Scheffbuch und seine Kollegen für ihr diakonisch-missionarisches Engagement bevorzugten, war das aus Spenden finanzierte, von landeskirchlicher Versorgung und Kontrolle unabhängige und auf die Mitarbeit von Laien zählende „freie Werk“. Dem Einwurf, hier würden evangelikale „Parallelstrukturen“ zu bestehenden kirchlichen Einrichtungen geschaffen, begegnete Scheffbuch mit dem Hinweis, in der Kirchengeschichte seien geistliche Impulse meistens durch private Initiativen entstanden. Sein Paradebeispiel war Christian Friedrich Spittler, der visionäre schwäbische Sekretär der Basler Christentumsgesellschaft, der mit der Gründung zahlloser pädagogischer, missionarischer und karitativer Einrichtungen die deutsche Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts mit in Gang gesetzt hatte und den er einmal als seine Lieblingsgestalt in der Kirchengeschichte bezeichnete.(17) „Wache Christen wie Spittler haben immer zusätzliche Aktionen ins Leben gerufen – nämlich wenn Notwendigkeit dazu bestand“, schrieb Scheffbuch. „Derselbe Spittler, der doch als Gründer der Baseler Mission gelten darf, hat auf der Chrischona ein weiteres Missionsausbildungsinstitut geschaffen, weil er Bedarf dafür sah. … Wir dürfen uns heute nicht allein mit der Pflege des Überkommenen begnügen!“(18) Umgekehrt wird man vermuten dürfen, dass die freien Werke und vielfältigen Aktionsformen der Ludwig-Hofacker-Vereinigung dazu beitrugen, zahlreiche erwecklich gesinnte Christen Württembergs, die sonst nach freikirchlichen Alternativen gesucht hätten, innerhalb der Landeskirche zu halten. Rolf Scheffbuch jedenfalls stand für ein landeskirchliches Christentum, auch wenn er mit großer Sympathie von den amerikanischen Freiwilligkeitskirchen sprechen und mit freikirchlichen Christen eng zusammenarbeiten konnte. Er erinnerte gerne an das Beispiel Johann Albrecht Bengels, der bei aller Kirchenkritik in seiner Kirche geblieben war und sie, so glaubte Scheffbuch, nachhaltig positiv verändert hatte.(19)
Die Kirchengeschichte spielte für ihn auch sonst eine wichtige Rolle. Seine Leidenschaft für die „Erforschung des Lebens ‚christlicher Väter und Mütter‘“(20) veranlasste Scheffbuch, in zahlreichen Vorträgen, Artikeln und Büchern dem schwäbisch-pietistischen Milieu ein Bewusstsein für seine Geschichte zu vermitteln. Hierzu zählten Figuren wie Bengel, Hofacker, Kapff und Blumhardt,(21) aber auch Frauen wie Sophie Zeller-Siegfried, Charlotte Reihlen oder Scheffbuchs Urgroßmutter Pauline Kullen(22) sowie die Dichter evangelischer Lieder quer durch die Jahrhunderte, die ihn nach eigener Einschätzung mehr geprägt hatten als alle theologischen Werke.(23) Ausführlich beschäftigte er sich mit der Geschichte Korntals, wo er nach seiner Pensionierung mit seiner Frau lebte und sich bis zuletzt mit Verkündigung und Seelsorge in die dortige Evangelische Brüdergemeinde einbrachte.(24) In Schriften, Vorträgen und Führungen erläuterte er Interessierten die weltweiten missionsgeschichtlichen Wirkungen, die von der kleinen, 1819 gegründeten pietistischen Siedlung ausgegangen waren. Dass Rolf Scheffbuch auch die von ihm selbst erlebte und mitgestaltete württembergische Kirchengeschichte der letzten Jahrzehnte historisch zu reflektieren vermochte, erlebte, wer sich mit ihm darüber unterhielt.
So wichtig Scheffbuch seine schwäbischen Wurzeln waren, so sehr faszinierte ihn die weltweite Christenheit. Bereits 1955/56 hatte ein Studienjahr in den USA neue Verbindungen geschaffen und seinen kulturellen und kirchlichen Horizont erweitert. Hinzu kamen seine Teilnahme an wichtigen ökumenischen Treffen und das internationale Engagement im Rahmen der Missionswerke – aber auch Reisen, die sich aus Scheffbuchs weltweiten Kontakten ergaben.(25) Besonders wichtig wurde für ihn die Lausanner Bewegung für Weltevangelisation. Die Eindrücke, die er von dem Ersten Lausanner Kongress im Juli 1974 und der darin integrierten seelsorgerlich-evangelistischen Stadionveranstaltung mit Billy Graham mitnahm, hatten, wie er später schrieb, großen Einfluss auf die Gestaltung der Stuttgarter Gemeindetage unter dem Wort.(26) Mehrere „Lausanner“ Theologen aus dem globalen Süden, wie z.B. Bischof Festo Kivengere aus Uganda, Gottfried Osei-Mensah aus Ghana und Ajith Fernando aus Sri Lanka, traten später auch in Stuttgart als Redner auf. Scheffbuch knüpfte Kontakte zu Kirchen etwa aus der Ostafrikanischen Erweckungsbewegung, von denen er Impulse für das eigene kirchliche Leben erhoffte. Er beteiligte sich an weltweiten Konsultationstreffen, war Mitglied des Internationalen Lausanner Komitees und leitete mehrere Jahre lang dessen Europäischen Zweig. In dieser Funktion trat er angesichts weitreichender Säkularisierung für eine „Neu-Evangelisierung Europas“ ein.(27) So zählte er auch zu den Hauptverantwortlichen der 1993 mit Billy Graham, von 1995 an mehrmals mit Ulrich Parzany durchgeführten europaweiten Großevangelisation ProChrist.
Hinter all diesen Aktivitäten stand Scheffbuchs Überzeugung, dass Allein Jesus Christus, der Gekreuzigte – so der Titel seines letzten, posthum erschienenen Buches (28)– die Mitte evangelischer Theologie bilden dürfe. Er sei für den Glaubenden „der Einzige, der dann auch im Tode festhalten kann“.(29) Zu Scheffbuchs Gewohnheiten gehörte es, täglich vier Kapitel in der Bibel zu lesen. Dass Teile seiner Kirche die Verlorenheit des Menschen ohne Gott oder den stellvertretenden Opfertod Christi in Zweifel zogen, deutete er als „erschreckenden Abbruch der Brücken zwischen der Bibel und der Gegenwart“.(30) Auch sein eigenes konservativ-pietistisches Milieu empfand er in späteren Jahren manchmal als zu angepasst. Scheffbuch wollte seine Zeitgenossen „zur Sache“ rufen,(31) indem er sie an die reformatorischen Exklusivpartikel erinnerte: „Gott rettet allein durch Christus, allein durch seine Gnade, allein durch den Glauben an ihn. So rettet Gott, allein so!“(32) Diese Kritik zielte auf den liberalen Zeitgeist. Scheffbuch warnte aber auch vor einer frommen Selbstsicherheit und Siegermentalität, die er vor allem in der charismatischen Bewegung,(33) aber teilweise auch im Pietismus wahrnahm. „Mich stört der Unterton von Sicherheit“, schrieb er, „als ob denn auch nur einer von uns schon das himmlische Ziel erreicht habe.“(34)
Von solchen kritischen Urteilen nahm Rolf Scheffbuch sich selbst nicht aus. „Es war meist eigene Schuld mit dabei, wenn ich in großes Gedränge kam“, schrieb er 1996,(35) und zu seinem achtzigsten Geburtstag: „Im zerrinnenden Leben wird mir immer erschreckender bewusst, wie schwer ich durch meine Art Menschen … belastet habe.“(36) Besonders einige krisenhafte Momente, etwa die Vorbereitung einer Predigt über „Sündenvergebung“ im Winter 1962, die er als erschütterndes Bewusstwerden von eigenem Versagen erlebte, oder eine riskante Krebsbehandlung 2001 mit den sie begleitenden Ängsten und Selbstzweifeln hatten dieses Gefühl der eigenen Unvollkommenheit verstärkt.(37) Sie hatten Scheffbuch aber auch die paulinische Rechtfertigungslehre und die Aussage von der Christusgemeinschaft existentiell bedeutsam gemacht. Römer 4,5 („Gott macht Gottlose gerecht!“) wurde für ihn so zu einer Schlüsselerkenntnis,(38) Lukas 15,2 („Jesus nimmt die Sünder an“) ein „Zuspruch des unsichtbar gegenwärtigen Jesus an mich“.(39) So blickte Rolf Scheffbuch zuversichtlich in die Zukunft. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 2012 ist er verstorben. Er liegt auf dem Korntaler Friedhof begraben.
Erstabdruck in: Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland 2012 (Jg. 139/1), Gütersloh 2015, S. 136–143. Mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/scheffbuch-rolf (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schempp, Paul
-
Von: Haag, Norbert
Inhaltsverzeichnis
Paul Schempp (1900-1959)
1: Lebensdaten
-
Paul Schempp (1900-1959)
Fotograf: Dieter Ehlermann
Eltern: Geb. am 4. Januar 1900 als fünftes von neun Kindern des altpietistisch geprägten Handwerkmeisters Andreas Schempp und seiner Ehefrau Anna, geb. Layer.
Ausbildung: Besuch des humanistisch geprägten Eberhard-Ludwig-Gymnasiums in Stuttgart, Abschluss als Klassenprimus. - Theologiestudium in Tübingen 1919-1920, Marburg 1920-1921 und wieder in Tübingen 1921. Im Rahmen einer Beurlaubung hörte er Vorlesungen Karl Barths in Göttingen; akademische Lehrer: Neutestamentler Adolf Schlatter (Tü), Kirchengeschichtler Müller (Tü), Religionswissenschaftler Friedrich Heiler (Ma), Karl Barth (Gö); Stiftler und Mitglied der akademischen Verbindung Nicaria; freundschaftliche Beziehungen zu Hermann Diem, Heinrich Fausel und Richard Widmann; während der Studienzeit Vf. eines Ms. mit dem Titel: Ave victi! – Gedanken und Bekenntnisse eines Heidenchristen, in der er die verkrusteten Kirchenstrukturen beklagt; machte die zweite Aufl. von Barths Römerbrief im Stift populär und entfachte damit „eine Revolution“.
Beruflicher Werdegang: Nach Vikariat Repetent am Stift 1925-1929; intensives Lutherstudium, Publikation seines ersten Buches Luthers Stellung zur Heiligen Schrift; Studienreisen nach Frankreich, Dänemark, Balkanländer, USA. Religionslehrer in Bad Cannstatt 1929-1931; Pfarrer in Waiblingen (April 1931-August 1931); Religionslehrer am Königin-Olga-Stift und Königin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart; Entlassung aus dem Schuldienst aus politischen Gründen (Sept. 1931-5. Sept. 1933); Pfarrverweser bzw. Pfarrer in Iptingen im Dienst der Landeskirche (Pfarrverweser Okt. 1933 -29. März 1933, dann Pfarrer), im Dienst der Gemeinde bis 29. Nov. 1943; Konflikte mit der Kirchenleitung insbes. wegen der Stellung zur Bekennenden Kirche; Austritt aus der Landeskirche kurz vor Weihnachten 1943; Nov. 1948 Aussöhnung mit Landesbischof Theophil Wurm, Wiedereinsetzung in seine Rechte als Prediger; Lehrer für evangelische Religion, Philosophie und Deutsch am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium (ab 1949); Verleihung des Theologischen Ehrendoktors durch die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn 1955; Berufung zum Prof. für praktische und systematische Theologie ebd. zum WS 1958/59; Tod am 4. Juni 1959 nach schwerem Leiden.
Familie: 1929 Eheschließung mit Erika Siepmann, Lehrerin aus Westfalen.
2: Biographische Würdigung
Seine theologische Prägung verdankt der hochbegabte Paul Schmepp neben seinem altpietistischen Elternhaus vor allem Karl Barth. Seine eigenen Interessen galten Martin Luther, dessen Theologie er für die theologische Existenz und den Beruf des Pfarrers für seine Zeit fruchtbar zu machen suchte. Strenge Bibelorientierung mit kritischer Wissenschaft zusammenzudenken war für Paul Schempp entscheidend bedeutsam: „Der Hörer soll nicht der Person oder dem Geiste des Pfarrers glauben, sondern seinem Wort, aber auch dies nicht, ohne es an der Schrift zu prüfen, und der Pfarrer soll sich auf Gottes Befehl und Wort berufen können, auch und gerade da, wo der eigene Glaube fehlt oder schwach ist“(1). Schempp engagierte sich seit 1929 in den entstehenden Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaften, deren Lenkungskreis er angehörte, und bei der Überarbeitung der agendarischen Kirchengebete. Das kritische Wort württembergischer Pfarrer zur Gleichschaltung vom April 1933 wurde von ihm mit verfasst.
An seiner frühen und grundsätzlichen Gegnerschaft zum nationalsozialistischen Staat und den Deutschen Christen kann kein Zweifel bestehen. Im Lehrerkollegium seiner damaligen Schule war dies bekannt, spätestens, seit er eine heftige Diskussion mit den Worten beendet hatte: „Jetzt gehe ich zu meinen künftigen Kriegswitwen!“(2) Wilhelm Rehm, eine Schlüsselfigur der Deutschen Christen in Württemberg, griff in wegen seiner Haltung in einem Zeitungsartikel scharf an und evozierte damit die Intervention der Schulbehörde, die Schempp zur schriftlichen Stellungnahme aufgeforderte. Schempp bekannte offen, dass die Kirche das Evangelium nicht im Geiste des Dritten Reiches zu verkünden habe, „sondern im Geiste Gottes, und wer Nationalsozialismus und Christentum einfach gleichsetzt, deshalb weil der Nationalsozialismus eine religiöse Bewegung sei oder ist, der … verwechselt Religiosität und christlichem Glauben. Ein Christ wird gerade jetzt für die Freiheit dieser Verkündigung mit Ernst eintreten, damit nicht aus dem Evangelium für Gottes Reich unter der Hand ein solches vom dritten Reich wird“(3).
Am 5. September 1933 aus dem Schuldienst entlassen, „weil diese Worte in einem für die nationalsozialistische Bewegung verletzenden Sinn“(4) zu verstehen seien, übernahm Schempp im Oktober die Pfarrstelle in Iptingen, einer 600 Seelengemeinde im Dekanat Vaihingen (heute Mühlacker). Neben seiner Tätigkeit als Ortspfarrer engagierte er sich stark in den theologischen Debatten seiner Zeit: als Publizist – Schempp war Mitinitiator der Blätter zur kirchlichen Lage (die im April 1934 in der theologischen Zeitschrift der Bekennenden Kirche Evangelische Theologie aufgingen) –, als Mitglied der seit 1935 als Theologischen Sozietät firmierenden Theologengruppe, und als Teilnehmer der Bekenntnissynoden von Barmen (30./31. Mai 1934) und Berlin-Dahlem (20. Okt. 1934).
Dass die Kirchenleitung unter Landesbischof Theophil Wurm die Beschlüsse der beiden Bekenntnissynoden nicht den Gemeinden bekanntgab, führte zu einem ersten heftigen Zusammenstoß zwischen Schempp und seinem Landesbischof. Schmepps Drängen, die Auseinandersetzung mit den DC in die Gemeinden zu tragen und dort allein mit den Mitteln des Wortes auszufechten, wies Wurm als „töricht und anmaßend“ zurück; dass er die theologische Kompetenz eines Paul Schempp gleichwohl zu schätzen wusste, zeigt sich daran, dass er ihm im Juni 1935 die Aufgabe übertrug, die Rechtmäßigkeit der von den DC beherrschten Kirchenverwaltungen zu widerlegen – eine Aufgabe, die Schmepp virtuos meisterte.
In dem Maße, wie die württembergische Kirchenleitung eigene Wege jenseits der Vorläufigen Leitung der Bekennenden Kirche einschlug, wuchsen die Spannungen zwischen ihr und jenen Gruppierungen innerhalb der württembergischen Pfarrerschaft, die sich an der Bekennenden Kirche orientierten, der Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg und insbesondere der Theologischen Sozietät. Als sich der Lutherische Rat Ende Juli 1936 öffentlich von der Denkschrift der Zweiten Vorläufigen Kirchenleitung distanzierte und der Oberkirchenrat in Stuttgart ihre Verlesung im Gottesdienst untersagte, hielt Schmepp die Zeit gekommen, mit der württembergischen Kirchenleitung grundsätzlich ins Gericht zu gehen: Er könne, so der Vorwurf an den württembergischen Landesbischof im Brief vom 8. Sept. „den Verdacht nicht unausgesprochen lassen, daß es dem Oberkirchenrat im ganzen Kirchenkampf wesentlich um seine eigene Freiheit umd um seine Sorge für gesetzliche Ordnungen“ gegangen sei. „Wie sollte man sich sonst die Wendigkeit erklären, mit der man zwischen Bekennender Kirche und Staat ständig laviert ist“(5).
Der nun rasch eskalierende Konflikt, in dem Schempp dem Oberkirchenrat die geistliche Leitung der Kirche absprach, kulminierte 1938, als Theophil Wurm den Treueid auf Hitler als probates Mittel, um mit dem NS-Staat zu einem modus vivendi zu kommen, von den Geistlichen seiner Landeskirche einforderte. Gegen diesen „frivolen“ Willkürakt der Kirchenleitung verwahrte sich Paul Schempp mit 50 weiteren Angehörigen der Sozietät – öffentlich, vor der Gemeinde, wie auch nicht öffentlich in Schreiben an Dekan und Landesbischof. Unüberbrückbar wurde die Kluft weniger aufgrund weiterer inhaltlicher Differenzen – z.B. der Bußliturgie vom 30. Sept. 1938, dem Verhalten des Oberkirchenrats in den Fällen Otto Mörike und Julius von Jan – denn aufgrund der unversöhnlichen Hartnäckigkeit Paul Schempps. Denn dieser ließ nichts unversucht (und sei es aufgrund gezielter Provokationen), um den Oberkirchenrat zu zwingen, zu den an ihn herangetragenen kritischen Bemerkungen und Fragen vor Pfarrerschaft und Gemeinden Stellung zu beziehen. Als am 2. September 1939 das Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet wurde, mochte er sich am Ziel wähnen. De facto kam es jedoch nicht zur erhofften Auseinandersetzung in der Sache, sondern zur Amtsenthebung, weil Schempp die kirchliche Ordnung missachtet, seine vorgesetzten Dienststellen und ihre Träger beleidigt und in der Öffentlichkeit herabgesetzt sowie ihnen trotz Verpflichtung im Ordinationsgelübde den Gehorsam verweigert habe (Urteil vom 29. März).
Weil sich die Gemeinde in Iptingen aber mit ihrem Pfarrer solidarisch erklärte, wurde die gerichtlich festgestellte Entfernung aus dem Amt praktisch nicht vollzogen. Über Jahre vom Oberkirchenrat toleriert, führten beiderseitige Übergriffe auf den bisherigen status quo 1943 zum definitiven Bruch. Am 29. November 1943 legte Schempp in einem Schreiben an Wurm sein Pfarramt in Iptingen nieder und erklärte kurz vor Weihnachten seinen definitiven Austritt aus der Landeskirche.
Nach dem Krieg bestanden die alten Fronten zunächst fort. Zusammen mit Hermann Diem veröffentlichte Paul Schempp im Febr. 1946 eine Broschüre mit dem bezeichnenden Titel Restauration oder Neuanfang in der Kirche? In ihr präsentierten die beiden Sozietätler den Entwurf einer neuen Kirchenordnung, um aus den Lehren der Vergangenheit die richtigen Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen. Dazu gehörte auch, das Versagen auch der Bekennenden Kirche im Unrechtsstaat des Dritten Reiches deutlich zu benennen – weit deutlicher, als dies ursprünglich von der Evangelischen Kirche Deutschlands beabsichtigt und im Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Okt. 1945 schließlich erfolgt war.
Paul Schempp persönlich brachten die Jahre nach dem Krieg von Erfolg und Anerkennung. Nach Kriegsende zum Prediger der Reformierten Gemeinde in Stuttgart berufen, warb er als Leiter der Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaft für Deutschland unermüdlich für das Anliegen der Bekennenden Kirche. Theologisch ungeheuer produktiv, war er als Redner und Publizist ein vielgefragter Mann. Im November 1948 kam es, vermittelt durch Hermann Diem, zur Aussöhnung mit Landesbischof Theophil Wurm. Schempp erhielt seine Rechte als Prediger des Evangeliums zurück und wurde am Eberhard-Ludwig-Gymnasium in Stuttgart erneut als Lehrer für die Fächer evangelische Religionslehre, Philosophie und Deutsch tätig. 1955 von der Theologischen Fakultät der Universität Bonn mit der Verleihung der theologischen Doktorwürde geehrt, nahm er ein Jahr später einen Ruf an die Bonner Universität als Professor für praktische und systematische Theologie an. Eine akademische Wirksamkeit blieb ihm jedoch durch seinen frühen Tod verwehrt.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur
Quellen:
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, A 127, Nr. 1993, Personalakte Paul Schempp
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Teilnachlass Widmann, Kirchliche-Theologische Sozietät (noch unverzeichnet)
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Nachlass zu Paul Schempp (noch unverzeichnet)
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schempp-paul (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Scheurlen, Paul
-
Von: Kienzle, Claudius
Inhaltsverzeichnis
Paul Scheurlen (1877-1947)
1: Familienverhältnisse
V Heinrich S. (1842-1921), Landgerichtskopist in Tübingen). M Friedericke, geb. Weber (1844-1920). G 8 (4 starben im Kleinkindalter. Namen der anderen: Christian Paul, Friedericke, Rosa Henriette Walpurga, Thekla Johanna Mina) °° Barbara Margarethe, geb. Gierich (1893-1983) K Eine Tochter, ein Sohn.
2: Biographische Würdigung
Der am 25.09.1877 in Königsbronn (OA Heidenheim) geborene S. besuchte in Tübingen die Elementarschule sowie die unteren und mittleren Gymnasialklassen, bevor er nach bestandenem Landexamen 1891 ins Seminar Maulbronn eintrat, wo er sich mit Hermann Hesse befreundete. Im Seminar Blaubeuren legte er 1895 die Konkursprüfung ab, die ihm im selben Jahr die Aufnahme des Theologiestudiums in Tübingen ermöglichte. Dort studierte er zunächst von seinem pietistischen Elternhaus im Heimatort Lustnau aus. Wenig später erhielt er einen Stipendienplatz im Evangelischen Stift. S. hörte vor allem beim Alttestamentler und Orientalisten Julius Grill (1840-1930), einem Vertreter der Religionsgeschichtlichen Schule, sowie bei dem Praktologen Johannes Gottschick (1847-1907) und dem Systematiker Theodor Haering (1848-1928), beide Ritschlianer.
Nach seiner Ordination in der Tübinger Stiftskirche durch Dekan Karl August Elsässer, entschloss sich S. zunächst vom Eintritt in den Pfarrdienst abzusehen und eine Hauslehrerstelle in Tempelberg bei Berlin anzunehmen. Die Arbeit an einer philosophischen Dissertation bei Erich Schmidt brach er ein Jahr später ab und ging nach Genua, wo er die Söhne des deutschen Generalkonsuls unterrichtete. Dort vertrat er gelegentlich den Gesandtschaftsprediger, dessen Nachfolger er zunächst werden sollte. Nach einem Todesfall in der Familie und aus gesundheitlichen Gründen kehrte er jedoch 1902 nach Württemberg zurück, wo er Vikar in Tailfingen (Dekanat Balingen) wurde.
Erst 1907 bekam er die dortige zweite Pfarrstelle übertragen. Bereits während seiner Vikarzeit publizierte S. im Bereich der Jugendliteratur. In den Folgejahren verfasste er für die Evangelische Gesellschaft Stuttgart Flugblätter über die in Württemberg verbreiteten religiösen Gemeinschaften und Bewegungen, die er 1912 in einem in der zeitgenössischen Terminologie so benannten „Sektenbüchlein“ zusammenfasste. Weitere Publikationen zu heimatkundlichen, religiösen und pädagogischen Themen folgten. Vergleichsweise früh gab er ein örtliches Evangelisches Gemeindeblatt heraus. Als Vorsitzender des Evangelischen Arbeitervereins war er zudem um die Abgrenzung zur Sozialdemokratie und die gleichzeitige Integration von Fabrikarbeitern bemüht.
S. heiratete 1915 Margarethe Gierich, mit der er zwei Kinder hatte. Nach etlichen vergeblichen Bewerbungen um besser dotierte und prominentere Stelle erhielt er 1918 zunächst die geschäftsführende Pfarrstelle in Tailfingen und wurde 1922 zum Dekan von Biberach ernannt. Dort setzte er mit der Herausgabe des Evangelischen Diasporaboten seine publizistische Tätigkeit fort. Er nahm 1925 als Korrespondent für kirchliche Presseorgane an internationalen und interkonfessionellen Kirchenkonferenzen in Skandinavien teil.
In den Auseinandersetzungen zwischen der württembergischen Kirchenleitung um Landesbischof Theophil Wurm und der Reichskirche im Herbst 1934 stellte sich S. zunächst positiv zu den reichskirchlichen Einigungsversuchen und distanzierte sich von Wurms Widerständigkeit. Nicht zuletzt um in dem katholischen Umfeld seines Diasporabezirks den Eindruck innerprotestantischer Uneinigkeit zu vermeiden, akzeptierte der weltanschaulich konservative Theologe als einer der wenigen württembergischen Dekane die deutschchristliche kommissarische Landeskirchenregierung.
Nach der Behauptung der organisatorischen Selbständigkeit der württembergischen Landeskirche solidarisierte sich S. auf Druck der Kirchenleitung mit Wurm und verfolgte eine Strategie der „Befriedung“. Mit diesem Begriff umschrieb S. die Praxis, Veranstaltungen der aktiven Biberacher Gruppe der „Deutschen Christen“ in kirchlichen Räumen zu verbieten und gleichzeitig bekenntniskirchliche Kundgebungen zu dulden, ohne sich selbst kirchenpolitisch zu exponieren. Diese Haltung brachte ihn mehrfach in Konflikt mit nationalsozialistischen Stellen. Im September 1934 und Juni 1938 erbrachte S. die geforderten Eidesleistungen auf Adolf Hitler. In den 1930er Jahren veröffentliche er volkstümliche Lebensbilder von deutschen Protestanten, die seiner Ansicht nach Vorbildcharakter haben sollten.
Obwohl seine Gesundheit während der Kriegszeit zunehmend abnahm, konnte er im Januar 1947 sein 25jähriges Dienstjubiläum als Dekan feiern und trat im selben Jahr 70jährig nur zögerlich in den Ruhestand. S. verunglückte wenige Monate später am 13. Dezember 1947 auf einer Autofahrt, die er für das Evangelische Hilfswerk unternahm, tödlich.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Nachrufe in Evangelischer Diasporabote 18 (1947), S. 45-47
Hans-Otto Binder, Biberach in der Zeit der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur, in: Geschichte der Stadt Biberach, 1991, S. 553-601, S. 589
Gerhard Schäfer, Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation zum Kirchenkampf, Bd. 4., 1977, S. 134-137.
Quellen:
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/scheurlen-paul (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schick, Erich

-
Von: Schnürle, Joachim
Inhaltsverzeichnis
ERICH SCHICK (1897-1966)
Dem Theologen Erich Schick wurde die Missionsarbeit und die Seelsorgearbeit zur Lebensaufgabe. Friso Melzer einer seiner Weggenossen bescheinigt Erich Schick im Jahr 1972: „Erich Schick ist wohl der literarisch fruchtbarste Seelsorger unseres Jahrhunderts gewesen: hat er uns doch mehr als 60 Bücher und Schriften meist seelsorgerlichen Inhalts geschenkt.“
1: Kindheit und Jugend
Erich Schick wurde in die Pfarrfamilie Schick in Ruppertshofen am 23.April 1897 hineingeboren. Sein Vater Friedrich Schick war seit 1891 Pfarrverweser in der Kapelle in Ruppertshofen, die zur Kirche in Tonolzbronn gehörte, ab 1892-1898 dann als „definitiver Pfarrer“ dort. Seit 1840-1892 waren Pfarrverweser in Ruppertshofen eingesetzt, Friedrich Schick war dann der erste Pfarrer. Ein Wechsel der Pfarrstelle des Vaters stand im Jahr1898 an. In Unterböhringen wurde dann auch der Bruder Friedrich am 11.12.1901 geboren, der ebenfalls Pfarrer wurde. Der Sohn Friedrich bekleidete Pfarrstellen1926 in Pfeffingen, 1933 in Degerschlacht und 1947-1957 in Gomaringen, Er war Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Biblisches Christentum, einem Vorläufer der Ludwig-Hofacker-Vereinigung in Baden Württemberg, was die kirchenpolitische Prägung in der Familie ebenfalls verdeutlicht.
Nach dem Tod des Vaters am 22. September 1906, zu diesem Zeitpunkt war Erich gerade 8 Jahre, zog die Mutter mit den Kindern nach Korntal. Die Pfarrerstochter nahm ihren Vater Johann Balthasar Weinheimer mit nach Korntal, der auch zuvor schon in der Familie Schick gelebt hatte. Dieser war 1830 in Ebingen geboren, wirkte als Pfarrer in Herzkamp in Westfalen, in Wüstenrot, Löwenstein und Möhringen sowie Oetisheim und schließlich in Täferrot. Seit seiner Pensionierung 1902 lebte er bei seiner Tochter Maria und dem Schwiegersohn Friedrich und begleitete so seine verwitwete Tochter mit den Kindern im Jahr 1906 nach Korntal. Dort starb der Großvater von Erich Schick am 31. März 1913. Der im Ruhestand lebende Pfarrer war somit ab dem 4. Lebensjahr von Erich ein festes Mitglied in der Familie und übernahm wahrscheinlich auch ab 1906 Vater-Pflichten nach dem Tod von Friedrich Schick. Über bleibende Eindrücke von seiner Seite berichtet Erich jedoch in seinen Schriften nicht. In Korntal entstand eine herzliche Verbindung zu Johannes Hesse, dem verwitweten Vater von Hermann Hesse. Dieser hat auch prägend auf Erich Schick gewirkt.
Erich Schick berichtet von dieser Zeit erste geistliche Eindrücke durch seinen Konfirmator Paul Heim (1865-1930), den Bruder des Theologieprofessors Karl Heim. Zu seinem Konfirmator hat er zeitlebens dankbar aufgeschaut. Immer wieder berichtete Schick in seinen Schriften von den einschneidenden Erfahrungen des ersten Weltkrieges. Nach dem Abitur 1915 wurde er zum Militärdienst einberufen und nahm an der Somme-Schlacht teil. Der Verlust vieler Kameraden, das tägliche Konfrontiertsein mit dem Tod und der eigenen Endlichkeit
2: Ausbildung und Eheschließung
Von 1919 bis 1922 studierte er Theologie in Tübingen, wo er 1922 das erste Examen ablegte. Nach einigen Jahren Dienstzeit als Religionslehrer, Repetent, Vikar und Pfarrer in Bickelsberg-Brittheim wurde er 1931 in seine Lebensaufgabe als Lehrer am Basler Missionsseminar berufen. Nach Schließung dieses Instituts unterrichtete er von 1959 bis 1965 am Predigerseminar auf St. Chrischona bei Basel, wo zuvor schon dreizehn Jahren lang nebenamtlich tätig war. Schick hat als Lehrer, als Seelsorger, theologischer Schriftsteller und Redner eine breite Wirksamkeit weit über Basel hinaus entwickelt. Seine Schriften bewegten sich meist im Bereich praktisch-theologischer Themen. Ihm war es ein Anliegen, Impulse aus der Kirchengeschichte und des Kirchenliedes auf Fragestellungen der praktischen Seelsorge anzuwenden. Gerne hat er dazu „Auslegungen“ zu Chorälen des Kirchengesangbuches erarbeitet. Auch kurz dargestellte Schriftauslegungen zu Abschnitten des Neuen Testamentes stammen aus seiner Feder. 72 Bücher und Broschüren wurden von ihm gezählt. Seine private handschriftliche Bibliographie umfasst 410 Einträge, viele in christlichen Publikumszeitschriften und dem Basler Missionsmagazin veröffentlicht.
Im Herbst 1932 trat Schick in den Ehestand mit Dora Schick geborene Schultze (13.1.1904-11.8.1963), der Tochter des bereits verstorbenen Riehener Diakonissenpfarrers. Sie wurde ihm zur treuen Mitarbeiterin bei seinen schriftstellerischen Arbeiten. Die Ehe blieb kinderlos.
Die Tübinger Universität verlieh Erich Schick 1953 die theologische Ehrendoktorwürde. Schicks Wirken in der Ausbildung von Missionaren sein seelsorgerliches Schrifttum hat Generationen von Pfarrern und Laien geprägt. Erich Schick ist am 20.01.1966 in Basel verstorben.
3: Prägung und Lebensleistung
Schick selbst hat wichtige Ereignisse, insbesondere seine Kriegserlebnisse des Frühjahrs 1917 die Fronterfahrung und das Todeserleben an der Somme wiederholt als prägend für seine Entwicklung dargestellt, so in der Schrift Gottebenbildlichkeit aus dem Jahr 1936 und in einem seiner Hauptwerke, Heiliger Dienst, das im Jahr 1935 erschienen ist. Auch die Begegnung und Beschäftigung mit Gestalten der Kirchengeschichte nennt er selbst als wichtige Begleiter und Lehrer auf seinem Lebensweg. Dazu zählt er an erster Stelle Sören Kierkegaard (1813-1855), unter den Schwabenvätern besonders Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782), dann auch der Katholik Franz von Baader (1765-1841) und der Mystiker Jakob Böhme (1575-1624).
Da Erich Schick nicht die gesundheitliche Stabilität aufwies, die für eine Arbeit auf dem „Missionsfeld“ erwartet wurde, richtete er seine Arbeit für die Mission ganz in den Fußspuren seines großväterlichen Freundes und Gönners Johannes Hesse ein. Die Hilfen, die er dem alternden Missionsschriftsteller in Korntal leistete, mündeten direkt in seine Tätigkeit als Lehrer an den beiden auf Spittler zurückgehenden Einrichtungen, dem Missionsseminar der Basler Mission und dem Seminar der Pilgermission St. Chrischona. Er redigierte über mehrere Jahre das Evangelische Missions-Magazin, für das sich früher schon Johannes Hesse verantwortlich zeichnete. Er veröffentlichte ein Buch zur evangelischen Missionsgeschichte: Vorboten und Bahnbrecher – Grundzüge der evangelischen Missionsgeschichte bis zu den Anfängen der Basler Mission, Basel 1943. Erich Schick prägte durch Lehre, Wort und Schrift, wie auch mit seiner Missionsgeschichte Generationen von Schülern und späteren Missionaren.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Martin Benker, Segnende Seelsorge: Seelsorge bei Erich Schick, in: Thorsten Dietz und Hans-Jürgen Peters (Hg.): Seelsorge auf dem Feld des Denkens, Festschrift für Sven Findeisen, Marburg, 1995, 81-88.
Jochen Eber, 1999, Erich Schick, in: BBKL Band XVI, 1999, Spalten 1412-1418.
Nahamm Kim, 2006, Leiden als Opfer. Zur christozentr. Leidensvorstellung in der Seelsorgelehre von Erich Schick, in: ThBeitr 37, 2006, 131-146.
Friso Melzler, 1972, Erich Schick (23.4.1897 - 20.1.1966) - Seelsorger für Leidende, in: Stuttgarter Evang. Sonntagsblatt 106, Nr. 17, 23.4.1972, 7-8;
Joachim Schnürle, Das Werden eines Seelsorgelehrers – prägende Begegnungen für Erich Schick (1897–1966), Biblisch erneuerte Theologie. Jahrbuch für Theologische Studien (BeTh) 1, 2017, 237-254.
Joachim Schnürle, Erich Schick (1897-1966) als Mann der Mission – Missionsgeschichtsschreibung in den Jahren des 2. Weltkriegs, Evangelische Missiologie 36, 2019 (1), 47-54.
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schick-erich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schmid, Eugen
-
Von: Butz, Andreas
Inhaltsverzeichnis
Eugen Schmid (1867-1949)
1: Familienverhältnisse
V Karl S. (19.4.1828-7.1900), Rechnungsrat. M Pauline Katharine, geb. Litzenmayer (*22.11.1841). G Paul Ernst (1.11.1868-16.3.1869), Otto (*23.2.1870), Mathilde (*31.5.1871), Emil (*10.3.1873), Martha Luise (*11.11.1875), Karl Hermann (17.10.1876). ∞ 24.4.1897 Cécile, geb. Hafner (1.4.1871-19.7.1955), Tochter des Bundesrichters Heinrich Hafner. K Otto (* 28.2.1899), Irene (*3.6.1901), Eugenie (*8.12.1903).
2: Biographische Würdigung
-
Eugen Schmid (1880-1960), um 1902
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 4210. Fotograf: C. Stichaner, Ulm
S. wurde am 18. Oktober 1867 als erstes von insgesamt sechs Kindern in Friedrichstal bei Baiersbronn im Schwarzwald geboren. Sein Vater war in der Verwaltung des dortigen Hüttenwerks beschäftigt, von wo er 1878 in das Werk zu Wasseralfingen versetzt wurde. Auch wurde ihm dann noch der Titel eines Rechnungsrats verliehen. Für S. bedeutete das den ersten Wohnortwechsel, sowie den Wechsel von der Baiersbronner Realschule auf die Lateinschule in Aalen. Nachdem er das Landexamen bestanden hatte besuchte er die niederen theologischen Seminare in Maulbronn und Blaubeuren. Er war nun zum Studium der Theologie und dem Beruf des Pfarrers bestimmt. Nach bestandener Konkursprüfung erhielt S. die staatliche Erlaubnis zum Studium der Theologie im Tübinger Stift. Dort leistete er von Herbst 1885 bis 1886 zunächst seinen militärischen Dienst als Einjährig-Freiwilliger und konnte sich dann seinen Studien widmen. Nach Abschluss seiner universitären Ausbildung wirkte er im unständigen Dienst als Vikar und als Pfarrverweser in Plattenhardt, Göttingen bei Ulm, Cannstatt, Weingarten, Essingen und in Friedrichshafen. Ihm wurde ein Staatsbeitrag für eine wissenschaftliche Reise gewährt, die ihn im Wintersemester 1892/1893 nach Berlin führte. Das Ziel dieser Reise war es vor allem, an Lehrveranstaltungen bei den damals bedeutenden Theologen Harnack und Kaftan teilzunehmen. 1896 promovierte er in Tübingen zum Dr. phil. mit einer Arbeit über den württembergischen Philosophen Johann Christoph Schwab. Im Jahr darauf, als durch seine erste ständige Anstellung die äußeren Verhältnisse gesichert waren, verehelichte er sich mit seiner Frau, die aus Lausanne in der französischen Schweiz stammte. Nach Pfarrdiensten auf den zweiten Pfarrstellen in Brackenheim und in Heidenheim, wo er auch Bezirksschulinspektor war, erfolgte im Jahr 1908 seine Ernennung zum Dekan von Herrenberg. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1934 wirkte er auf dieser verantwortungsvollen Stelle. Allerdings versah er dort seinen Dienst auch noch über seine Versetzung in den Ruhestand hinaus bis Januar 1935 weiter. Seine letzten Jahre verbrachte er in seinem Haus in Vaihingen auf dem Fildern. Auch hier war er noch tätig, etwa als Aushilfslehrer an der dortigen Oberschule, sowie durch weitere schriftstellerische Arbeiten.
S., dessen Interesse zunächst eher der Philosophie galt, beschäftigte sich spätestens ab 1899 mit Fragen der württembergischen Schulgeschichte. Dieses Thema sollte sich zum Schwerpunkt seines Forschungsinteresses entwickeln und seine diesbezüglichen Arbeiten sind nach wie vor von Bedeutung. Seine ersten Aufsätze zu diesen Fragestellungen erschienen im Jahr 1900. Umfangreichere Veröffentlichungen folgten. Das erste größere Werk behandelte die Geschichte des Religionsunterrichts in der evangelischen Volksschule Württembergs im neunzehnten Jahrhundert. Nur zwei Jahre später erschien bereits der erste von zwei Bänden, die das württembergische Volksschulwesen umfassend darstellen sollten, und die von der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte herausgegeben wurden. Dieser Band schildert in großem Bogen die Entwicklung des Schulwesens in Altwürttemberg, ausgehend von seinen Anfängen im Mittelalter, über seine Beförderung im Reformationszeitalter bis hin zum Ende des alten Reiches 1806. In dem umfangreichen und detaillierten Folgeband stellte er die weitere historische und rechtliche Entwicklung bis 1910 dar, sowie auch die Einrichtung der verschiedenen nun entstehenden Lehrerseminare. Diese Arbeiten gelten heute noch als die „klassischen“ Werke zur Geschichte des deutschen Schulwesens in Altwürttemberg, und S. als ein ausgezeichneter Kenner der Quellenlage zu diesem speziellen Thema, auch wenn die Werke – trotz der offensichtlich umfassenden Arbeit an den Quellen - nicht allen wissenschaftlichen Standards genügen. Bereits 1936, ein Jahr nach seinem Umzug nach Vaihingen auf den Fildern, wo er seinen Ruhestand verbrachte, erschien die Ortsgeschichte Vaihingens aus seiner Feder. Als Motiv für die Arbeit an diesem lokalgeschichtlichen Werk, das nach wie vor die maßgebliche Veröffentlichung zur Geschichte dieses heutigen Stuttgarter Ortsteils ist, nannte er den Wunsch, so mit seinem neuen Wohnort bekannt und in ihm heimisch zu werden. Am 18. April 1949 verstarb er in Stuttgart-Vaihingen.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Dieter Schnermann, Eugen Schmid (1867-1949) – Dekan und ein Mann „von ausgebreiteter Gelehrsamkeit“, in: Herrenberger Persönlichkeiten, 1999, S. 387 f.
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schmid-eugen (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schneller, Magdalena
-
Von: Eisler, Jakob
Magdalena Schneller (1821-1902)
-
Magdalena Schneller
Landeskirchliches Archiv Stuttgart
Jugend und Hochzeit
In Bezgenrieth wird am Neujahrstag 1821 dem Bäcker Joseph Böhringer und seiner Ehefrau Christina, geb. Schmid aus Heiningen eine Tochter Magdalena geboren. Das Ehepaar hatte noch zwei weitere Töchter. Im Jahr 1831 zieht die Familie nach Eschenbach und Joseph Böhringer übernimmt das Gasthaus mit Übernachtungsmöglichkeit zum „Schwarzen Adler“. Das Elternhaus ist sehr religiös und hier werden Magdalena die ersten christlichen Eindrücke vermittelt. Durch gute Lehrer, die auf sie eingingen und durch den Konfirmandenunterricht wurde sie selbstsicherer. Sie beendet die Volksschule in Eschenbach und soll einen Beruf ergreifen. Zuerst zieht sie aber für zwei Jahre zum Ortspfarrer Johann Christian Engel (1798-1877) und lebt dort als Hausgenossin. Sie wird wie eine eigene Tochter gehalten und geliebt und lernt einen Pfarrershaushalt kennen. Sie bekommt neue Anregungen und wird in die Literatur eingeführt. In vielen Gesprächen mit Pfarrer Engel und dessen Frau werden ihre religiös-schwärmerischen Gedanken gemäßigt. Gleichzeitig lässt ihr Tagebuch erkennen, welche Fragen sie in geistiger und geistlicher Hinsicht bewegen. Im Alter von 23 Jahren entwickelt sich bei ihr der Wunsch in der Mission zu arbeiten. Für ihre Eltern ist diese Idee genauso phantastisch wie die Ablehnung verschiedener Heiratsanträge, da sie ja eine gute Partie ist.-
Im nahen Dorf Ganslosen (heute Auendorf) arbeitet der beliebte Lehrer Johann Ludwig Schneller (1820-1896) und hält dort „Stunden“. Magdalena besucht mit anderen aus Eschenbach diese Vorträge und nutzt die Gelegenheit, Herrn Schneller auch zu ihren Heiratsanträgen zu befragen. Bei einigen rät er ihr sogar zu. Aber sie will noch nicht heiraten. In den „Stunden“ bekommt sie auch neue geistliche Anregungen und Hilfen. Sie arbeitet privat als Krankenpflegerin in verschiedenen Orten, dann als Aufseherin in der Göppinger „Rettungsanstalt“ und später als Aufseherin in Wilhelmsdorf bei Ravensburg, einer Anstalt für entlassene weibliche Gefangene.
Der Lehrer Schneller arbeitet inzwischen als Leiter einer Anstalt für entlassene jugendliche Gefangene in Vaihingen/Enz. Magdalena bleibt im Briefverkehr mit ihm und lässt sich in ihrem Glaubensleben von ihm beraten. Bei einem Besuch 1847 in ihrem Elternhaus vor seiner Abreise in die Schweiz als Leiter der Missionsschule St. Chrischona schreibt er in ihr Stammbuch die prophetischen Worte „Wir sollen in Jerusalem Bürger werden“. Ende 1853 verloben sie sich und werden am 8. August 1854 in Eschenbach von Pfarrer Engel getraut. Ein verheirateter Bruder ist für Christian Friedrich Spittler (1782-1867), dem Gründer von St. Chrischona, aber nicht akzeptabel. Deshalb bekommt Schneller von Spittler den Auftrag, das Brüderhaus der Pilgermission in Jerusalem zu leiten.
Reise nach Jerusalem
Am 2. Oktober fährt Schneller mit Magdalena und 6 anderen Handwerkermissionaren auf einem Segelschiff von Marseille nach Jaffa. Die dramatische Überfahrt ist in dem Reisetagebuch Schnellers und dem Büchlein „Nach Jerusalem müssen wir fahren“ beschrieben. Am 25. November wird die Gruppe endlich in Jaffa ausgebootet und zieht am 29. November von der evangelischen Gemeinde herzlich empfangen in Jerusalem ein. Im Brüderhaus herrscht eine reine Männerwirtschaft. Magdalena versucht mit schwäbischer Gründlichkeit erst einmal das Haus in Ordnung zu bringen. Im Mai 1855 erfolgt die dramatische Totgeburt ihres 1. Kindes. Ein Jahr später erlebt sie eine völlig normale Geburt ihres Sohnes Theodor. Magdalenas Schwester, Christine Mühlhäuser aus Eschenbach, war die Taufpatin aus der Ferne. Weitere Kinder des Ehepaares Schneller waren Ludwig, Maria, Benoni und Johannes.-
Die Idee mit dem Brüderhaus in Jerusalem scheitert. Mit dem Erbteil von Magdalena beginnt das Ehepaar weit außerhalb von Jerusalem einen Hausbau und wohnt während dieser Zeit in Laubhütten. Sie werden mehrmals von Arabern überfallen und ausgeraubt. Eine Laubhütte brennt beim Kochen ab. Aber sie werden in allem bewahrt. Nach der Sicherung durch Polizeiposten können sie endlich doch in ihr eigenes Haus einziehen.
Leben und Wirken im Syrischen Waisenhaus
Magdalena kann jetzt in der Mission arbeiten und hat mit ihren eigenen ein Haus voller Kinder und wird von allen voll Verehrung „Mama Schneller“ genannt. In der Leitung der wachsenden Anstalt unterstützt sie ihren Mann und ist gleichzeitig für die Führung des bald auf 40 Kinder angewachsenen Haushalts verantwortlich. Täglich drei Mahlzeiten, Kleidung waschen und flicken, Kinder trösten und erziehen. Sie trägt die ganze Last der Anstaltsleitung während einer monatelangen Krankheit Schnellers. Es werden immer mehr Waisenkinder aufgenommen. Ihre eigenen Kinder muss sie bald zur Schul- und Studienausbildung nach Deutschland abgeben und sieht sie erst viele Jahre später wieder. Auch als ihre Tochter Maria von einer Töchterschule in Göppingen zurück und andere Helferinnen dazu kommen, liegt die Verantwortung der Leitung des großen Haushalts weiter bei ihr.
Im 57. Lebensjahr stürzt sie auf dem Weg zur Kirche nach Jerusalem von ihrem Esel und erleidet einen Schenkelbruch, der nur langsam verheilt und ihr eine lebenslange Gehbehinderung einbringt. Von da an ist sie auf einen Stock und eine sitzende Lebensweise angewiesen. Ihrem arbeitsfreudigen Leben werden dadurch Zügel angelegt. Aber im Sitzen kann sie noch gepresste Blumen aus dem „Heiligen Land“ auf Karten kleben und verkauft diese an Touristen und Freunde des Syrischen Waisenhauses. Vom Erlös dieser Arbeit spendet sie sogar zwei Glocken für die Waisenhaus-Kirche. Weiterhin führt sie einen regen Schriftverkehr mit den Freunden und Spendern des Syrischen Waisenhauses sowie ehemaligen Mitarbeiterinnen.
Lebensende
Magdalena Schneller erlebt den Ausbau des Syrischen Waisenhauses und das Wachsen der Familie mit Enkelkindern. Das zunehmende Alter macht sich jedoch bei ihr bemerkbar. Im Herbst 1896 stirbt Johann Ludwig Schneller nach kurzer Krankheit. Der Tod ihres geliebten Mannes macht sie einsam und sie erlebt das Witwenleid trotz aller Fürsorge und Liebe ihrer Kinder. Beim Besuch des deutschen Kaiserpaares 1898 in Jerusalem wird ihr von der Kaiserin Auguste Victoria das „Frauen-Verdienstkreuz am weißen Band“ für ihre große Lebensarbeit verliehen. Dann folgt ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr jüngster Sohn, Dr. jur. Johannes Schneller (1865-1901), Vizekonsul in Kairo, stirbt plötzlich. Sie ist darüber untröstlich.
Ihre Schwäche wird größer und im Beisein ihres Sohnes Theodor und ihrer Tochter Maria schläft sie am 25. Mai 1902 still ein. Zwei Tage später wird sie auf dem Zionsbergfriedhof neben ihrem Mann begraben.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schneller-magdalena (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schneller, Johann Ludwig

-
Von: Eisler, Jakob
Inhaltsverzeichnis
1: Herkunft und Ausbildung
Als Johann Ludwig Schneller 1820 in Erpfingen als Sohn des in bescheidenen Verhältnissen lebenden Landwirts- und Weber-Ehepaars Johann und Anna Katharina Schneller zur Welt kam, schien ihm zunächst ein Leben wie das seiner Eltern vorbestimmt. Doch mit viel Energie, Fleiß und Begabung machte der junge Johann Ludwig schnell auf sich aufmerksam.
Unterstützt vom Pfarrer und Lehrer seines Heimatortes, bestand er mit nur 18 Jahren das Lehrer-Examen mit Auszeichnung. Nach dem zweiten Examen durfte er dann selbst Lehrer für Württemberg ausbilden.
2: Ruf nach Basel und Entsendung nach Jerusalem
Nach einigen Schulstellen im Württembergischen wurde Schneller, der seine geistige Heimat früh in den pietistischen Kreisen von Korntal fand, von Christian Friedrich Spittler nach Basel berufen. Als Hausvater in der Pilgermission führte er ein äußerst karges Leben ohne Gehalt und nur das Nötigste an Nahrung und Kleidung für sich und zwanzig Zöglinge. Gemeinsam mit ihnen wohnte er im Turm der Kapelle.
Schneller galt als äußerst asketisch und hart gegen sich selbst - aber dies half ihm bei seiner weiteren Laufbahn.
Im Jahr 1854 lernte Johann Ludwig Schneller die Gastwirtstochter Magdalene Böhringer nicht nur kennen, sondern offenbar auch lieben: Bereits am 8. August 1854 heirateten die beiden. Sie war gewissermaßen eine Kollegin - sie arbeitete als Lehrerin der Ziegler'schen Anstalt in Wilhelmsdorf.
Noch im selben Jahr brach das Ehepaar von Basel aus mit weiteren Zöglingen nach Jerusalem auf. Dort diente Johann Ludwig Schneller in dem von Spittler 1846 gegründeten Brüderhaus als Hausvater. Dank der Mitgift seiner Frau gelang es ihm bald, ein eigenes Grundstück außerhalb der Stadtmauern zu erwerben, wo er ein einfaches Haus errichtete.
Hierzu gehörte viel Mut, denn rings um die Altstadt gab es damals weder Bauten noch bebautes Land. Mehrfach wurde Schneller überfallen. Die Familie musste daraufhin wieder in das Brüderhaus nach Jerusalem zurückkehren.
Erst als die osmanischen Behörden - das Gebiet des heutigen Israel gehörte damals zum Osmanischen Reich - die Straße zwischen Jerusalem und der Hafenstadt Jaffa bewachen ließen, konnten Schnellers wieder in ihr Haus ziehen.
3: Begründung des Syrischen Waisenhauses
Die nächste Wendung bekam das Leben von Johann Ludwig Schneller und seiner Frau im Jahr 1860. Im Sommer war im heutigen Libanon ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Eine Revolte christlicher Maroniten gegen die drusischen Landbesitzer im Libanongebirge mündete im „Massaker von Damaskus“: Mindestens 20.000, andere Quellen sprechen von mehr als 30.000 Christen, waren innerhalb kurzer Zeit von Drusen und Muslimen umgebracht worden. Viele weitere wurden aus ihren Dörfern und Städten vertrieben - und flüchteten unter anderem in die Region Beirut.
Als Christian Friedrich Spittler in Basel von der Katastrophe erfuhr, gab er dem Leiter des Pilgermissionsgeschäftes in Jerusalem im September 1860 einen Auftrag: „Wie leicht hätte Jerusalem ein zweites Damaskus werden können, und Er hat Euch so unaussprechlich gnädig bewahrt. Aus Dankbarkeit und im Vertrauen auf Ihn habe ich unsern Freunden in Europa angezeigt, daß wir in Jerusalem ein Syrisches Waisenhaus errichten wollen, wobey der liebe Bruder Schneller Waisen-Vater seyn soll, dem ich bereits umständlich über dieses Vorhaben geschrieben habe. Sobald mir Beiträge für diesen wichtigen Zweck eingehen, will ich Euch solche zuschicken, damit Schneller nach Beirut abreisen und vorläufig sechs Knaben holen und dann einen kleinen Anfang machen kann. Ich bitte Euch, ihn auch mit Rath und That zu unterstützen ...“
Am 29. Oktober 1860 reiste Schneller nach Beirut, um von dort Waisenkinder zu holen. Er kehrte am 11. November mit neun Waisenkindern zurück. So entstand das Syrische Waisenhaus von Jerusalem.
Spittler sandte ihm einige Zöglinge der bei Basel gelegenen Pilgermission St. Chrischona als Lehrer und Helfer. „Unsere Waisen schlafen samt und sonders noch auf dem Boden“, schreibt Schneller. „Eine zusammengerollte Matte unter dem Kopfe dient für je vier Kinder als gemeinschaftliches Kopfkissen. Außerdem hat jedes eine mangelhafte Decke, in die es sich einwickeln kann“.
In den ersten drei Jahrzehnten seines Bestehens hat Johann Ludwig Schneller das Syrische Waisenhaus zusammen mit einem Kuratorium in Jerusalem geleitet, welches der Pilgermission unterstellt war.
Allerdings löste sich Schneller mit Hilfe des „Vereins für das Syrische Waisenhaus in Jerusalem mit Sitz in Deutschland“ von der Pilgermission: Unter der Leitung seines zweiten Sohnes Ludwig wurde fortan die Heimatarbeit und die Spendenbeschaffung von Köln aus organisiert.
4: Konzeption und Entwicklung des Waisenhauses
Schneller brachte neue erzieherische Ansätze in den Orient. Orientiert an den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Württemberg entstandenen „Rettungsanstalten“, propagierte die Leitung des Syrischen Waisenhauses ein Erziehungsideal, das „Gott“ und die „Welt“ zusammensah: angestrebt wurde nicht nur die religiöse Erziehung der Kinder im Geiste des Neupietismus, sondern auch die Vermittlung fundierter beruflicher Kenntnisse.
Mit dieser Konzeption war das Syrische Waisenhaus ein Novum nicht nur im Palästina des 19. Jahrhunderts, sondern im gesamten Osmanischen Reich. Es entwickelte sich zur größten und wichtigsten Erziehungsanstalt des Vorderen Orients.
Die Blütezeit des Waisenhauses fiel in die Spätphase der osmanischen Herrschaft und die Anfänge der britischen Mandatszeit, das heißt: in die Jahre 1890 bis 1930. Die vor den Toren Jerusalems gelegene Anstalt vergrößerte sich um ein Vielfaches, um schließlich im Jahr 1914 die Fläche der Altstadt Jerusalems zu übertreffen.
Zeit ihres Bestehens suchte das Syrische Waisenhaus Tradition und Moderne in einer für den württembergischen Pietismus spezifischen Weise zu verbinden: Für Johann Ludwig Schneller als Leiter der Anstalt und seine Nachfolger blieb der missionarische Gedanke von zentraler Bedeutung. Kinder arabischer Christen sowie muslimische Kinder sollten für den Protestantismus gewonnen werden.
Dabei hat sich die Schule auf Initiative Johann Ludwig Schnellers schon früh für Mädchen geöffnet - eine absolute Neuheit in der arabisch geprägten Region. Die Erziehung erfolgte geschlechtsspezifisch, orientierte sich an deutschen Normvorstellungen und Erzielungsidealen und bot ein weites Spektrum beruflicher Möglichkeiten im Bereich der Landwirtschaft und des Handwerks.
Die handwerkliche Ausbildung war in den Anfängen der Anstalt an deren Grundbedürfnissen orientiert. Danach wurden eine Schusterei, Schneiderei, Drechslerei, Tischlerei, Schlosserei, Töpferei, Ziegelei, Buchbinderei und Buchdruckerei gegründet. Somit konnten die Schüler gemäß ihren Neigungen und Begabungen einen Beruf erlernen, mit dem sie später ihr Brot verdienen sollten.
Im Jahr 1888 gründete Johann Ludwig Schneller gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Theodor (1856–1935) eine höhere Schule, die mit deutschen Gymnasien vergleichbar war. Aus ihren Absolventen rekrutierte sich die Lehrerschaft der Anstalt, der arabischen Schulen und die Beamtenschaft - zuerst des Osmanischen Reiches, dann der englischen Mandatsregierung.
5: Die landwirtschaftliche Zweigstelle Bir Salem
Ein weiterer Plan Johann Ludwig Schnellers war es, eine moderne, evangelisch-arabische Gesellschaft, die vom Ackerbau leben würde, zu gründen. Die württembergischen Templer, die sich 1869 im Land niedergelassen hatten, brachten ihn auf die Idee, eine arabische Siedlung in der Nähe von Ramle zu gründen. Zu diesem Zweck wollte Schneller 1877 von der türkischen Regierung in der Küstenebene Boden kaufen.
Aber erst 1889 gelang es ihm – mit Unterstützung von Kaiser Wilhelm II. – das Terrain Bir Salem (Der Friedensbrunnen) auf 40 Jahre zu pachten. 1907 konnte sein Sohn Theodor das Gelände dann endgültig kaufen. Die dort errichtete Ansiedlung sollte unter Leitung von Matthäus Spohn (1866–1935) in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht zum Vorbild in Palästina werden.
6: Nachwirkung
Im Jahr 1896 starb Johann Ludwig Schneller. Er hatte sein Ziel, eine evangelische christlich-arabische Gesellschaft zu gründen, nicht erreichen können. Wohl aber trug er zur Entwicklung der Landesbevölkerung und deren Ausbildung in handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufen bei. Die rund 5.000 Kinder, die in den Schneller‘schen Anstalten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ihre Ausbildung erhielten, waren mithin in ihrer arabischen Umwelt privilegiert, sie stellten die Elite in ihrem jeweiligen Wirkungskreis.
Infolge des Zweiten Weltkriegs kam die Arbeit des Syrischen Waisenhauses in den Jahren 1939/40 zum Erliegen. Nach 1945 war, bedingt durch den Holocaust, an eine Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit in dem 1948 entstehenden Staat Israel nicht zu denken.
Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten entschloss sich der Vorstand des Vereins des Syrischen Waisenhauses, mit Hermann Schneller einen Enkelsohn des Gründers mit dem Wiederaufbau des Schulwesens im Libanon zu beauftragen. Heute betreibt das Syrische Waisenhaus Bildungseinrichtungen im Libanon (Khirbet-Kanafar) und Jordanien (Amman).
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/347 (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schoell, Jakob
-
Von: Lächele, Rainer
Inhaltsverzeichnis
Jakob Schoell (1866-1950)
1: Familienverhältnisse
V Johannes Schoell, Bauer in Boehringen
∞ 1894 Emilie, geb. Hagenmayer (1867-?)
K Otto, Gerhard (*1899), Hedwig (*1902), Anna Luise (*1909)
2: Biografische Würdigung
-
Jakob Schoell (1866-1950)
Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, U1, Nr. 92 (Nr. 561)
Schoell wurde am 11. September 1866 in Böhringen auf der Schwäbischen Alb geboren. Von 1884 bis 1888 studierte er in tübingen als Stiftsangehöriger evangelische Theologie. 1889 erwarb er den Titel eines Dr. phil. 1888 war er als Vikar und Pfarrverweser in Walddorf tätig. 1890 bis 1892 übernahm er eine Vertretung am Gymnasium in Ulm. Im Spätsommer 1892 unternahm Schoell eine wissenschaftliche Reise nach Italien. Sie war gewissermaßen der Lohn für seine vorzüglichen Examina.
1905 wurde Schoell zum ersten Vorsitzenden des Landesverbandes der Evangelischen Arbeitervereine gewählt. Seit 1906 vertrat er Göppingen in der 7. Landessynode.
Seit 1918 wirkte Schoell als Prälat des Sprengels Reutlingen und wurde somit auch Mitglied der Kirchenleitung. Im Oberkirchenrat war Schoell zuständig für die Bereiche Schule und Religionsunterricht. Der Vertreter der liberalen, volkskirchlichen Richtung betätigte sich als aktives Mitglied der Freien Volkskirchlichen Vereinigung. Schoells Tätigkeit beschränkte sich jedoch keineswegs auf die Kirchenverwaltung. Er war vielmehr ein Mann der Öffentlichkeit, der gut schrieb und nicht zuletzt auch viel gelesen wurde. Die hohen Auflagen seiner zumeist knappen Bände sprechen für sich.
Als Beispiel dafür kann seine schmale Christenlehre stehen, die 1934 erschien und als „Unterweisung für Erwachsene“ verstanden wurde. Schoell wollte hier das Wesentliche des christlichen Glaubens formulieren, ohne jedoch dogmatisch zu reden. Der damaligen herrschenden Ideologie des Nationalsozialismus mussten Sätze wie „Kirche ist eine Gemeinschaft besonderer Art“ als Angriff auf das Ideal der „Volksgemeinschaft“ besonders anstößig erscheinen.
Gerade nach 1918 versuchte er mit Bänden wie „Vaterlandsliebe und Christentum?“, „Was ist's mit dem Eigentum?“ oder „Ist mit dem Tode alles aus?“ Antworten auf die allgegenwärtigen Sinnfragen nach dem verlorenen Krieg zu geben.
Eine wesentliche Rolle spielte Schoell auch im Evangelischen Volksbund für Württemberg, dem mitgliederstärksten protestantischen Verband Württembergs nach dem Ersten Weltkrieg. Schoell leitete 1919 den Gründungsausschuss des Evangelischen Volksbundes und bekleidete seit 1919 die Position des zweiten Vorsitzenden. 1923 bestand der Volksbund aus 750 Ortsgruppen und 225.000 Mitgliedern, und hatte somit 20 Prozent der erwachsenen evangelischen Bevölkerung Württembergs hinter sich.
Seine vielfachen Pflichten im Deutschen Kirchentag und im Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss machten ihn weit über Württemberg hinaus bekannt. Der Ökumeniker Schoell unterhielt schließlich weltweite Kontakte als Teilnehmer an Weltkirchenkonferenzen und als Mitglied im Ökumenischen Rat. 1924 und 1929 trat Schoell bei den Wahlen zum Amt des Kirchenpräsidenten an. 1929 unterlag er dem späteren Landesbischof Theophil Wurm nach einem spannenden Abstimmungsduell.
Schoell verließ Ende 1933 des Oberkirchenrat und trat in den Ruhestand. Der 67-jährige Prälat hatte schon früh Skepsis an den Reichskirchenplänen der Deutschen Christen geäußert und öffentlich die durch den Nationalsozialismus beförderte Hinwendung kirchenfremder Menschen zur evangelischen Kirche bezweifelt. Obwohl er sofort ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragte, wurde Schoell zum Bauernopfer, das die evangelische Kirchenleitung den dominierenden Deutschen Christen gegenüber brachte – als Beitrag zur „Verjüngung der Kirchenleitung“. Zwischen 1936 und 1940 übernahm Schoell zahlreiche Stellenvertretungen an Stuttgarter Kirchengemeinden. Nach der Zerstörung seines Stuttgarter Hauses 1943 lebte Schoell bis zu seinem Tod am 2. Mai 1950 in seinem Geburtsort Böhringen. Im Rückblick wurde Schoells „nüchterner, schwäbischer Wirklichkeitssinn“ wie auch seine absolute Wahrhaftigkeit hervorgehoben
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Prälat D Dr. Jakob Schoell +. In: Freie Volkskirchliche Vereinigung in Württemberg. Nachrichtenblatt Nr. 4, 30.5.1950
Eine ökumenische Persönlichkeit. In: Ev. Gemeindeblatt 44, 1950, Nr. 23
Für Arbeit und Besinnung, Beil. W 4, 1950, 298-299, 423-424
Stuttgarter Zeitung 6, 1950, 102, 13
Gerhard Schäfer (Hg.): Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation zum Kirchenkampf, Bd. 1-6, Stuttgart 1971-1986
Quellen:
Personalakte Landeskirchliches Archiv Stuttgart A 127, S 294
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schoell-jakob (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schrenk, Elias
-
Von: Quack, Jürgen
Elias Schrenk (1831-1913)
-
Elias Schrenk
Foto: BMDZ
Geboren wurde Elias Schrenk am 19. September 1831 in Hausen ob Verena, einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Der dortige Kindergarten trägt seinen Namen, im Rathaussaal hängt sein Bild, und im Pfarrhaus wird sein griechisches Neues Testament aufbewahrt. Der junge Elias Schrenk wollte Pfarrer werden. Aber da sein Vater früh starb, musste er die Schule verlassen und Geld verdienen. In Tuttlingen wurde er zum Kaufmann ausgebildet, bevor er einige Jahre später Missionar wurde. Von Basel aus war er 1859 an die Goldküste, ins heutige Ghana, geschickt worden. Als Elias Schrenk 1875 wegen seiner angegriffenen Gesundheit nach 16 Jahren Missionsdienst aus Afrika zurückkommt, zieht er nach Frankfurt und wirkt als Reiseprediger der Basler Mission in Hessen und Thüringen.
Es ist die Zeit der industriellen Revolution und des Frühkapitalismus; viele Menschen ziehen aus den Dörfern in Städte. Die dortigen Kirchengemeinden erreichen die Arbeiter nicht. Es häufen sich die Klagen über die Entkirchlichung breiter Bevölkerungsschichten. Aber was dagegen tun? Die Einladung zum Sonntagsgottesdienst und zur pietistischen „Stunde“ reichen offensichtlich nicht mehr. Neue Methoden sind nötig. Schrenk geht hin zu den Menschen. Er spricht nicht nur in Kirchen und Sälen, sondern auch an Orten, wo sonst kein Pfarrer auftaucht: in Turnhallen, Tanzlokalen und Zirkuszelten. Er macht es, wie er es als Missionar in Afrika gemacht hat: er geht dahin, wo die Leute sind - und erwartet nicht, dass die Menschen zu ihm kommen. Ab 1884 ist er als freier Evangelist in ganz Deutschland tätig. Gleichzeitig mit der Evangelisation für die Kirchenfernen hält er Bibelstunden mit den örtlichen Gemeinden. Denn die Gemeinden sollen „Missionsgemeinden“ werden.
Elias Schrenk wurde er zu einem der Väter der Gemeinschaftsbewegung und war entscheidend beteiligt an der Abgrenzung zur Pfingstbewegung. Er starb 1913 in Bethel.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schrenk-elias (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schumacher, Gottlieb Samuel
-
Von: Eisler, Jakob
Gottlieb Samuel Schumacher (1857-1925)
-
Gottlieb Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
* 21.11.1857 Zanesville/Ohio USA
+ 26.11.1925 Haifa/Palästina
Gottlieb Schumacher gilt als einer der bedeutendsten Palästina-Deutschen des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Er stammte ursprünglich aus einer in Tübingen alteingesessenen, einflussreichen Familie. Bis heute zählt er zu den bedeutendsten Palästina-Forschern und trug wesentlich zum Aufbau des Landes bei. Sein Vater Jacob Friedrich Schumacher wanderte im Revolutionsjahr 1848 in die USA aus. 1851 siedelte sich der Vater in Zanesville/Ohio an und heiratete drei Jahre später die Witwe Juliana Christina Dorn aus Wüstenrot/Württemberg, die eine Tochter, Maria, in die Ehe mitbrachte. Am 21. November 1857 wurde das einzige Kind dieser Ehe – Gottlieb Samuel – geboren.
In Zanesville hatte Jacob Schumacher sich einer Gemeinde angeschlossen, die seit 1855 mit Christoph Hoffmann (1815–1885), dem Sohn des Begründers Korntals, in brieflichem Kontakt stand. 1859 schloss er sich Hoffmanns Bewegung für eine ‚Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem’ – den Templern – an. Chr. Hoffmann wollte in Jerusalem den geistigen Tempel der Gesellschaft gründen, weswegen seine Anhänger zunächst auch „Jerusalemsfreunde“ genannt wurden.
Anfang der 1860er Jahren wurde der Plan gefasst, eine Templergemeinde in den USA zu gründen. Mit vier Jahren zog Gottlieb mit seinen Eltern in die Nähe von Buffalo im Staate New York wo sein Vater zum Vorsteher der neuen Templergemeinde in „Maresa“ ernannt wurde. Nach einigen Jahren verließen die Schumachers diese Siedlung wieder und zogen 1865 nach Buffalo, wo sie bis August 1869 lebten. Dort verbrachte Gottlieb seine ersten Schuljahre.
Zwischenzeitlich hatten die Tempelvorsteher Württembergs, Christoph Hoffmann und Georg David Hardegg (1812–1879), mit der Auswanderung vom Kirschenhardthof nach Palästina begonnen.
1869 wurde mit dem Bau der württembergischen Kolonie Haifa begonnen. Die Tempelleitung am Kirschenhardthof bei Marbach bat die amerikanischen Templer, die beiden Familien Schumacher und Oldorf nach Palästina zu schicken. 12jährig kam Gottlieb Schumacher im Oktober 1869 in Haifa an.
Hier erlebte Gottlieb Schumacher die schweren Anfänge der Templer-Ansiedlung in Palästina. Zunächst besuchte er die arabische Schule in Haifa, wo er schnell arabisch lernte. In der deutschen Schule in Haifa schließlich erlernte er bei seinem Lehrer Traugott Frei (1846–1891) neben der englischen Muttersprache französisch und deutsch. Zudem unterstützte er seinen Vater bei Entwürfen für Bauten in Haifa, Nazareth und bei verschiedenen Bildhauerarbeiten. Von 1876 bis 1881 studierte er an der technischen Hochschule in Stuttgart Ingenieurwesen (Hoch- und Tiefbau) und Architektur. In Stuttgart besuchte er oft seinen Vetter Ministerialdirektor v. Dorn und konnte dadurch Kontakte zu den führenden Kreisen in Württemberg knüpfen. 1882 kehrte er ins elterliche Haus in Haifa zurück. Seine erste eigene Arbeit war die Planung einer neuen Friedhofsanlage für die deutsch-französische evangelische Gemeinde in Beirut. Darauf folgte die Vermessung der Strecke zwischen Haifa und Damaskus für die Bahnlinie einer Beiruter Gesellschaft, die jedoch erst Jahre später (1905) in ähnlicher Form von einer englischen Gesellschaft realisiert wurde.
-
Gottlieb Schumacher in seinem Arbeitszimmer
Aus dem Nachlass von Professor Dr. Alex Carmel, Haifa
Schumacher war mehrere Jahre Bezirksingenieur in Akko, der Hauptstadt von Nordpalästina, und war dort für den Brücken- und Straßenbau zuständig. In dieser Zeit wurden z.B. die Brücken am Kisonfluss gebaut, Karten von Haifa gezeichnet und weitere Vermessungsarbeiten durchgeführt. Schumachers Initiative ist es zu verdanken, dass der Name der Stadt Haifa, deren Schreibweise in lateinischen Buchstaben auf 17 verschiedene Arten vorkam ab 1886 nun die einheitliche Schreibweise 'Haifa' bekam. Er entwarf viele staatliche Bauten im Bezirk Akko und führte eine große Zahl von Baumaßnahmen entlang der Küste und in Galiläa durch. So plante er das Krankenhaus der schottischen Mission in Tiberias, den Komplex der Londoner Judenmissionsgesellschaft in Safed sowie das Regierungsgebäude (Serail) am selben Ort. Er übernahm die Bauleitung am russischen Hospiz in Nazareth. Für Haifa plante er ein neues Regierungsgebäude und eine Hafenanlage; beide wurden jedoch nicht gebaut. In Haifa selbst wurden lediglich die Verlängerung des russischen Landungsstegs (1890), der Landungssteg der Deutschen Kolonie (genannt Kaiserdamm, 1898) und seine Planung des Kaiserdenkmals am Karmelberg (1910) realisiert. Für die neu gegründeten jüdischen Kolonien plante er mit Unterstützung von Baron Edmond de Rothschild unter anderem die Weinkellereien in Sichron Jakob am Karmelberg und die Kellereien in Rischon le Zion bei Jaffa. Als die deutsche Himmelsfahrtkirche am Ölberg in Jerusalem gebaut werden sollte, übertrug man Gottlieb Schumacher die gesamte Bauaufsicht dieses größten Bauprojekts im Palästina der Osmanischen Zeit.
Besondere und größere Bedeutung erlangte er allerdings durch sein kartographisches Werk. Als im Jahre 1884 der Wiener Prof. Dr. Wilhelm Anton Neumann (1837–1919) den Golan und Ajlun bereiste, lernte er Schumacher kennen und schlug vor, dass Schumacher diese Region im Auftrag des „Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas“ kartographieren solle. Die Verhandlungen führten dazu, dass Schumacher und der von der königlich preußischen Akademie der Wissenschaften unterstützte Dr. Friedrich Wilhelm Noetling (1857–1928) die topographische und kartographische Vermessung des Ostjordanlandes (heute Syrien und Jordanien) ab 1885 in Angriff nahmen. Die Vermessungen erstreckten sich vom Fuß des Berg Hermon bis an den Fluss Jabbok. Von Sommer 1894 bis 1902 reiste Schumacher alljährlich in das Ostjordanland, um Lücken in älteren Aufnahmen zu schließen und die Karten zu vervollständigen. Schumacher arbeitete auch für den „Englischen Verein zur Erforschung Palästinas“ (Palestine Exploration Fund). Viele seiner gedruckten Werke erschienen in London.
-
Gottlieb Schumacher bei der Ausgrabung von Meggido, am rechten Bildrand stehend
Familienarchiv von Familie Beilharz, Stuttgart
Schumacher entdeckte jüdische Grabhöhlen aus der Talmudischen Zeit in der Nähe von Haifa, dies sollte eine seiner ersten archäologischen Ausgrabungen werden. Die Ergebnisse zu diesem Fund veröffentlichte er in der „Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins“. 1903 bis 1905 hatte er die Leitung der Ausgrabungen in Tell el-Mutesellim (Megiddo) und arbeitete in Baalbeck mit Prof. Dr. Otto Puchstein (1856–1911) bei der Bestandsaufnahme zur Palastrestaurierung. 1908 arbeitete er für die Harward University bei Ausgrabungen in Samaria.
In Haifa war er Teilhaber der Export- und Importfirma Dück und Co. und der Zement und Ziegelfabrikation der Gebrüder Beilharz. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war er Mitbegründer der Erdöl-Gesellschaft am Toten Meer. Bei Kriegsausbruch 1914 wurde Schumacher Chefingenieur der IV. kaiserlichen ottomanischen Armee und nach dem türkischen Rückzug gehörte er der 27. Vermessungsabteilung des deutschen Heeres an. Im Jahre 1918 zog er zu seinem Schwiegersohn Dr. Carl Lorch nach Schwäbisch Gmünd wo er mit der Fertigstellung der Karten des Ostjordanlandes für den Deutschen Palästina-Verein befasst war. Ende 1921 gingen alle Karten an einen Verlag in Leipzig und Mitte 1924 konnte der Druck vollendet werden.
Da Gottlieb Schumacher auf der schwarzen Liste der Engländer stand, wurde ihm – für ihn unbegreiflich - die Rückkehr nach Palästina zunächst verwehrt. Im Jahre 1922 erlitt er einen Schlaganfall. 1924 endlich erhielt er von der englischen Regierung die Genehmigung zur Wiedereinreise. Er starb ein Jahr später in seinem Sommerhaus am Karmelberg in Haifa.
An der Universität Haifa bemühte sich Prof. Dr. Alex Carmel (1931–2002), ein Institut zur Erforschung des christlichen Beitrages zum Aufbau des Landes zu gründen, das den Namen Gottlieb Schumacher trägt. Bundespräsident Dr. Richard von Weizäcker schrieb 1985 an Prof. Carmel darüber wie folgt:
„Schon aus landsmannschaftlicher Verbundenheit habe ich das segensreiche Wirken der württembergischen Templer von ihren Anfängen im vorigen Jahrhundert an mit großer Anteilnahme verfolg. Ich würde mich freuen…wenn durch Ihr eigenes persönliches Engagement es gelingen würde… einen Gottlieb-Schumacher-Lehrstuhl finanziell sicherzustellen.“… Im Jahre 1987 stiftete das Land Baden-Württemberg und der Autokonzern Daimler-Benz das nötige Geld für die Gründung des Gottlieb Schumacher-Instituts. Es wurde am 27. Oktober 1987 mit einem festlichen Akt an der Universität Haifa in Israel eingeweiht.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
-

- Gottlieb Schumacher
Gottlieb Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
-

- Gottlieb Schumacher in seinem Arbeitszimmer
Gottlieb Schumacher in seinem Arbeitszimmer
Aus dem Nachlass von Professor Dr. Alex Carmel, Haifa
-

- Gottlieb Schumacher bei der Ausgrabung von Meggido, am rechten B
Gottlieb Schumacher bei der Ausgrabung von Meggido, am rechten Bildrand stehend
Familienarchiv von Familie Beilharz, Stuttgart
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schumacher-gottlieb-samuel (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Schumacher, Jakob
-
Von: Eisler, Jakob
Jacob Schumacher (1825–1891)
-
Jakob Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
Von Tübingen über Buffalo (U.S.A.) nach Palästina
Jacob Friedrich Schumacher wurde am 16. April 1825 in Tübingen als zweiter Sohn von Carl Christoph Schumacher und seiner Frau Marie Magdalene, geb. Sinner, geboren. Einen Tag später wurde er in der Tübinger Stiftskirche von Pfarrer Johann Gottfried Pressel (1789–1848), dem späteren Tübinger Dekan, getauft.(1) Die Familie Schumacher war eine alteingesessene Steinmetz- und Maurerfamilie in Tübingen. In den örtlichen Kirchenbüchern finden sich bereits im 17. Jahrhundert erste Aufzeichnungen über sie.
Ab seinem achten Lebensjahr besuchte er die Latein-, später die Realschule in Tübingen. Am 5. Mai 1839 wurde Jacob Schumacher konfirmiert.(2) Nach seiner Konfirmation begann er bei seinem Vater in Tübingen eine Lehre als Steinmetz. Er arbeitete einige Zeit unter Anleitung seines Vaters, später als selbstständiger Bauführer am neuen Universitäts-Krankenhaus. Über weitere Bauten in Tübingen, die er sicherlich mit seinem Vater ausführte, fehlen leider sämtliche Informationen.
Als Bauführer zog er später nach Stuttgart und beaufsichtigte dort unter anderem die Errichtung der Villa der Familie Heinrich von Prieser (1797–1870) und war an verschiedenen anderen Bauten beteiligt.
Im Revolutionsjahr 1848 entschloss er sich mit seinen zwei Brüdern Jakob Christof und Carl Wilhelm zur Auswanderung nach Amerika, wohin ihm die Eltern ein Jahr später nachfolgten.(3) Durch Vermittlung von württembergischen Emigranten kam er nach Wheeling in West-Virginia und heiratete dort die aus Stuttgart stammende Wilhelmine Wörner. Sie war eine sehr fromme Frau und veranlasste Jacob Schumacher, sich mit Religionsfragen auseinanderzusetzen. Beide begnügten sich jetzt nicht mit dem sonntäglichen Kirchenbesuch, sondern suchten nach einer Gemeinschaft, in welcher das „Sehnen des Herzens Befriedigung fände“ – wie Schumacher es später bezeichnete.(4) Ohne aus ihrer Kirche auszutreten, besuchten sie einige Versammlungen der Methodisten und anderer religiöser Richtungen, fanden aber nirgends rechte Befriedigung. Wilhelmine starb nach kurzer, außerordentlich glücklicher aber kinderloser Ehe.(5)
Schumachers erste Arbeit in Wheeling war der Bau einer Brücke über den Ohio. 1851 siedelte er nach Zanesville/Ohio über und heiratete drei Jahre später die Witwe Julie Dietle geborene Dorn (1819–1888) aus Wüstenrot/Württemberg, die eine Tochter, Maria, in die Ehe mitbrachte. Im Jahre 1857 wurde der Sohn Gottlieb geboren.
Über die Anfänge Schumachers in den U.S.A. und seine Verbindung zu den Templern berichtet posthum der Nekrolog:
„In Zanesville gelang es ihm sehr bald, sich einen weiten Berufskreis zu eröffnen; mit großem Vertrauen wurde ihm die Leitung öffentlicher und privater Bauten übertragen, auch widmete er sich eingehend der Bildhauerei und verfertigte eine Anzahl schöner Kunstwerke in Marmor. Auch in religiöser Hinsicht entfaltete Schumacher bald eine Tätigkeit in Zanesville und sammelte ein kleines Häuflein um sich, mit dem er sonntäglich Erbauungsstunden hielt. Das von ihm gelesene Wochenblatt ‚Weltbote’ gab als Beiblatt ‚Die Zeichen der Zeit’ heraus. Dieses Blatt wurde auch von den Brüdern in Buffalo gelesen, und durch dasselbe wurde Schumacher mit den Buffaloer Brüdern bekannt. Letztere standen schon seit 1855 mit Christoph Hoffmann (1815–1885) in brieflichem Verkehr und lasen die ‚Süddeutsche Warte’ und andere Tempelschriften, die Schumacher nun auch kennen lernte. Er machte 1859 einen Besuch in Buffalo und schloss sich der Bewegung für eine ‚Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem’ an“.(6) Die Bewegung der Tempelgesellschaft entnahm ihre Glaubensgrundsätze dem im 17. Jahrhundert entstandenen Pietismus. Der Vorsteher Christoph Hoffmann wollte im Heiligen Land den geistigen Tempel der Gesellschaft gründen. Deshalb wurden die Templer zunächst „Jerusalemsfreunde“ genannt. Der Bewegung, die damals noch nicht außerhalb der Landeskirche stand, schlossen sich viele Tausend Württemberger an. Unter ihnen waren viele, die in dieser Zeit in den Kaukasus auswanderten.(7)
In Amerika wurde der Plan gefasst, eine Gemeinde von Templern in den USA zu gründen. In der Nähe von Buffalo wurde ein Stück Land erworben. Nachdem Jacob Schumacher sein Haus in Zanesville verkauft hatte, siedelte er im Februar 1860 nach Buffalo über. Die Besiedlung des gekauften Landes wurde begonnen, und Schumacher wurde zum Vorsteher der neuen „Maresa“ Gemeinde ernannt. Er plante die Siedlung, zeichnete die Grundrisse und sogar die Pläne der Wohnhäuser. In kurzer Zeit waren sechs Häuser in Cheektowaga außerhalb von Buffalo erbaut. Da am Anfang die finanziellen Mittel fehlten, entschloss man sich, für ein Jahr aus einer gemeinschaftlichen Kasse zu leben („gemeinsame Arbeit und gemeinsamer Tisch“).(8) Für den Lebensunterhalt wurden auch die ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen bebaut.(9)
Erst im März 1862 kaufte Jacob Schumacher ein Grundstück für seine Familie in der neuen Siedlung Maresa (Grundstück Nr. 58). Da er in den Besiedlungsjahren für die Gemeinde arbeitete, übernahm diese die Kosten für den Erwerb. Leider wuchs die Siedlung nicht wie geplant, so dass in Maresa insgesamt nur 40 Personen lebten. Nach einigen Jahren verließen auch die Schumachers die Siedlung und zogen 1865 wieder nach Buffalo, wo sie bis August 1869 wohnten.(10)
Zwischenzeitlich hatten die Tempelvorsteher Württembergs, Christoph Hoffmann und Georg David Hardegg (1812–1879), eine Reise nach Palästina unternommen. Sie kamen am 30. Oktober 1868 in Haifa an und wollten dort „Vorposten und Empfangsstation“ für künftige Palästina-Einwanderer errichten.(11) Aus den Erfahrungen einer gescheiterten amerikanischen Kolonie in Jaffa und der misslungenen Versuche der Templer-Zöglinge in der Jesreel-Ebene hatte Hoffmann gelernt, dass eine strenge Auswahl unter den Einwanderungskandidaten vorgenommen werden musste. Er meinte, dass „es kein sichereres Mittel gäbe das angefangene Werk in diesem Lande zu Grunde zu richten, als wenn man den Armen die Reise hierher erleichterte, ohne zugleich für ihren Unterhalt hier sorgen zu können“.(12)
Hardegg und Hoffmann waren sich einig, dass Haifa der geeigneteste Platz für die Ansiedlung der Templer war. Einfach war die Entscheidung nicht, da Palästina damals ein Teil des osmanischen Reich war. Die Provinz war vernachlässigt und die heimischen Einwohner den Fremden gegenüber negativ eingestellt.(13)
-
Templerkolonie Haifa 1877, Zeichnung von Jakob Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
Allen Widerständen zum Trotz wurde 1869 mit dem Bau der württembergischen Kolonie Haifa begonnen. Die Tempelleitung bat die amerikanischen Templer, die beiden Familien Schumacher und Oldorf nach Palästina zu schicken. So kam Schumacher im Oktober 1869 als einer der ersten Ansiedler nach Haifa.
Hier fand Schumacher sowohl in äußerer als auch in geistiger Hinsicht eine außergewöhnliche und spannende Tätigkeit. Er entwarf nach den Angaben Hardeggs den Plan für die Kolonie, machte die Pläne für die einzelnen Wohnhäuser, leitete oder überwachte wenigstens die einzelnen Bauten und Straßenanlagen, wie in der „Süddeutschen Warte“ berichtet wurde:
„Die Straße zwischen den Häusern ist zu einem beträchtlichen Teil fertig, die Plätze zwischen und hinter denselben sind zu Gärten verwandelt, deren jeder mit einer Steinmauer von ca. 4 Schuh Höhe umgeben ist. Im Westen der Kolonie an dieselbe anstoßend dehnt sich ein ebenes fruchtbares Ackerfeld aus …“(14)
Als Georg David Hardegg von den türkischen Behörden auch Teile des Karmelberges bekam, wurde Schumacher mit der Vermessung und Aufteilung dieses Areals beauftragt:
„Die Vermessung selbst, welche in zwei Tagen, gestern und heute, den 31. Januar 1871 und 1. Februar, vorgenommen wird, trägt so sehr den türkischen Charakter an sich, dass ich nicht umhin kann, dieselbe etwas zu schildern. Zwei arabische Geometer haben das Geschäft zu besorgen, Hr. Schumacher, Bruder Johann Wilhelm Gohl und Hr. David Hardegg sind von unserer Seite beigegeben … Hr. Schumacher zeigte den Türken nach dem Plan, den er aufgenommen hat, die Grenze des Stückes. Die Linie dieser Grenze wird nun von den türkischen Mathematikern mit ihrer Messschnur pünktlich gemessen …“(15)
In der Gemeinde musste Jacob Schumacher die Leitung der sonntäglichen Versammlungen übernehmen und auch sonst bei allen Fragen der inneren und äußeren Entwicklung der Kolonie mitberaten, soweit dies bei dem eigensinnigen Charakter Georg David Hardeggs möglich war.
Im Jahre 1872 wurde Jacob Schumacher das amerikanische Konsulat übertragen, was in der Kolonie für so wichtig erachtet wurde, dass ein Dankgottesdienst hierfür anberaumt wurde. Schumacher hat auch dieses Amt mit großer Treue und Sorgfalt verwaltet, obwohl die reiche amerikanische Republik den Dienst umsonst verlangte. Schumacher hoffte, dass von Seiten der in Haifa ansässigen amerikanischen Templerfamilien Investitionen fließen würden – aber ohne Erfolg.(16)
Hoffmann und Hardegg hatten verschiedene Ansichten bezüglich der Besiedlung Palästinas, was zu einem ernsthaften und langjährigen Streit zwischen den beiden Vorstehern der Templergemeinde in Palästina führte. Über das gespannte Verhältnis zwischen beiden Vorsteher wurde geschwiegen, da die Templerleitung sich Sorgen um die weitere Entwicklung des Siedlungsprozesses machte.(17)
Als durch die Spannung zwischen Hardegg und Hoffmann Haifa isoliert wurde, versuchte Schumacher zwischen Hardegg, der Tempelleitung und Hoffmann zu vermitteln. Dies scheiterte und Hardegg zog sich von seinen Ämtern in Haifa zurück. Schumacher wurde nun gebeten, als Vorsteher der Kolonie Haifa zu agieren, was er mit viel Gespür und Geschick bis zu seinem Tod auch tat.(18)
Jacob Schumacher plante und baute viele Bauwerke im Norden Palästinas; leider sind nur wenige Quellen erhalten geblieben. So plante und baute er z.B. mit anderen Templern das Mädchen-Waisenhaus der englischen Frauenmissionsgesellschaft in Nazareth. Darüber berichtet die „Süddeutsche Warte“:
„Miß Rose nahm den Plan, ein großes Waisenhaus zu bauen, ernstlich auf. Sie ließ den deutschen Architekten Hrn. Jacob Schumacher in Haifa den Plan machen, der in England gut geheißen und genehmigt wurde. Am 3. September 1872 kam Hr. Schumacher mit einigen Deutschen, um den Bau des Waisenhauses zu beginnen, der aber mehr Arbeit und Geld kostete als man am Anfang glaubte … Das Gebäude ist sehr stark und schön gebaut, eine Zierde für Nazareth … Am 19. November 1875 verließen die Deutschen den Bau, da er als fertig betrachtet werden konnte“.(19)
Jacob Schumacher versuchte, seinen Sohn Gottlieb für seinen Beruf zu begeistern, so wie es sein Vater auch bei ihm getan hatte. 1876 schickten die Schumachers ihren Sohn zum Studium des Architektur- und Ingenieurwesens nach Stuttgart. Um dessen Aufenthalt zu finanzieren, zeichnete Jacob Schumacher 1877 ein Panoramabild der Deutschen Kolonie Haifa. Er ließ es in den USA bei Sorg in New York drucken und vertreiben, weil er hoffte, dass es sich in den USA gut verkaufen ließ. Diese Hoffnung erfüllte sich, denn die Amerikaner unterstützten damals alles, was aus dem Heiligen Lande kam.(20)
-
Grab von Jakob Schumacher in Haifa
Fotograf: Jakob Eisler
Ebenso bemühte sich Jacob Schumacher insbesondere durch Artikel in den Zeitschriften die „Süddeutsche Warte“, „Aus Abend und Morgen“ und den „Weltboten“ und durch Privatkorrespondenz auf das Werk der Tempelgesellschaft aufmerksam zu machen. Im Jahre 1881 begleitete er zu diesem Zweck Christoph Hoffmann sen. auf einer Reise nach Amerika.(21)
Am 8. September 1888 starb Schumachers zweite Gattin, was ihn sehr traf. Als das Haifaer Gemeindehaus im Jahre 1890 vergrößert wurde, meißelte Jacob Schumacher seinen letzten Türsturz für die Gemeinde. Auf ihm darauf stand: „Bis hierher hat der Herr geholfen 1890“.(22) Seit Ende 1890 nahmen die Kräfte Jacob Schumachers ständig ab und jede Arbeit, die er unternahm, kostete ihn große Anstrengung. Am Morgen des 7. September 1891 starb er in seinem Haus in der deutschen Kolonie.
Jacob Schumacher hat in drei verschiedenen Erdteilen gelebt, und dabei in jedem ein Drittel seiner Lebenszeit verbracht; in Europa 23 Jahre, in Amerika 21 Jahre und in Palästina 22 Jahre. Welche Anerkennung ihm auch von der einheimischen Bevölkerung in Haifa und im Norden Palästinas entgegengebracht wurde, geht aus der Teilnahme an seiner Beerdigung hervor. Behörden und Bevölkerung nahmen daran in großer Zahl teil, wiesonst bei keiner Beerdigung eines Deutschen. Am Grabe sprachen die drei Ältesten der Tempelgemeinde, dann sprach der Konsul Friedrich Keller (1838–1913) in französischer Sprache, damit auch die Nichtdeutschen und namentlich die Konsule der verschiedenen Länder seine Ansprache verstehen konnten.(23)
Schumachers Grabstein in Obeliskenform, den er selbst für seine Frau und sich gemeißelt hatte, steht bis zum heutigen Tag auf dem Deutschen Friedhof in Haifa.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
-

- Jakob Schumacher
Jakob Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
-

- Jakob Schumacher
Jakob Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
-

- Templerkolonie Haifa 1877, Zeichnung von Jakob Schumacher
Templerkolonie Haifa 1877, Zeichnung von Jakob Schumacher
Archiv der Tempelgesellschaft
-

- Grab von Jakob Schumacher in Haifa
Grab von Jakob Schumacher in Haifa
Fotograf: Jakob Eisler
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/schumacher-jakob (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Seitz, Johannes
-
Von: Schnürle, Joachim
Johannes Seitz – eine Gründergestalt der frühen Gemeinschaftsbewegung
-
Fotograf: Richard Kaiser, Bautzen
Aufgewachsen ist Seitz in einem kleinen Dorf der Calwer Waldgebiete im nördlichen Schwarzwald. Als Sohn eines Kleinbauern war er als Ältester von neun Geschwistern schon früh an körperliche Arbeit gewohnt. Landwirtschaft bedeutete in den engen Schwarzwaldtälern Handarbeit mit Sense, Rechen und Schaufel. Der Weg von Johannes schien vorgebahnt, die kleine Landwirtschaft weiterzuführen. Geboren am 07. Febr. 1839 in Neuweiler, erlebte er in seiner Kindheit die politischen Unsicherheiten des Vormärz und der folgenden Jahre mit, soweit diese Themen bis in den nördlichen Schwarzwald drangen. Das Tagesgespräch war in Neuweiler seit Mitte der 1840er Jahre die Predigt und deren Auswirkung des Pfarrers Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) in Möttlingen. Obwohl Möttlingen fünf Wegstunden von Neuweiler entfernt lag, war die Kunde von dem geistesmächtigen Prediger bis in den Calwer Wald gedrungen. Die Wirtin Veil und deren Ehemann hatten dort Heilung von einer Krebserkrankung der Ehefrau und von einer psychischen Belastung des Ehemannes erfahren. Diese Sensation lief durch das Dorf, einem Ort, der nach den Beschreibungen von Johannes Seitz durch Alkoholsucht und verfallene Sittlichkeit gekennzeichnet war. Die Wirtsleute, die vom Zuspruch ihrer Wirtschaft trefflich profitierten, waren andere Menschen geworden. Sie rühmten die Predigten Blumhardts und warben nun für einen christlichen Lebenswandel. Johannes Seitz Senior war einer der ersten, die heimlich den Weg nach Möttlingen machten, um selbst zu sehen, was da berichtet wurde. Von der Predigt wurde er wie von einem Keulenschlag getroffen – unruhig über seinen verlorenen Zustand kam er zurück. Frau und Kinder haben erlebt, wie er durch einen Kampf der Höllenangst hindurchgebrochen ist zu einer Glaubenszuversicht.
Der Sohn berichtete: „Und nun wurde ‚das spöttische Seitzle‘ das Werkzeug, im Dorf ein heiliges Feuer anzuzünden. Zuerst besuchte er, vom Geiste Gottes getrieben, die Nachbarn. Eine ganze Reihe von Bauern hat sich mit ihren Kindern daraufhin zu Gott bekehrt. Dann wurden in meinem Elternhaus Versammlungen gehalten. Immer mehr Menschen gingen nach Möttlingen. Es wurde eine große Bewegung.“ So entstand im Hause Seitz die erste Gemeinschaftsstunde von Neuweiler, der Vater Seitz vorstand. Johannes der Sohn berichtet später von seinem Vater: „Er wurde ein mächtiger Glaubensmann, durch dessen Glauben und Gebete in jener Zeit Dinge geschehen sind, die mitunter fast an Wunder grenzten.“ Dieses Erleben von Bekehrungen und auch wunderbare Heilungen auf ernstliches Gebet hin, hat Johannes Seitz in seiner Kindheit und Jugend geprägt.
Entscheidende Glaubenswege
Der jugendliche Johannes Seitz musste jedoch seinen eigenen Weg finden. Die von Möttlingen in die Umgebung ausgehenden Wirkungen ließen dann Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts bereits wieder nach. Blumhardt hatte sein Pfarramt verlassen und war 1852 nach Bad Boll übergesiedelt. Dort übernahm er von der Regierung das Kurhaus und baute es zu einem Seelsorgeheim aus. Es zeigte sich nun im Schwarzwald der Mangel, dass die Erweckungsbewegung an der charismatischen Gestalt Blumhardts hing. Er hatte es nicht als seine Aufgabe gesehen, die entstehenden Gemeinschaften tiefer zu führen und auf eine Eigenständigkeit der Bewegungen hinzuarbeiten. Die entstandenen christlichen Gruppen waren noch nicht selbstständig genug um ohne eine Leitung zu bestehen. Viele der Gemeinschaftskreise orientierten sich nun an den „Jerusalemfreunden“, auch Deutscher Tempel genannt. Diese Bewegung wurde durch Christoph Hoffmann (1815-1885) angeführt. Hoffmann war ein Sohn des Gründers von Korntal Gottlieb Wilhelm Hoffmann (1771-1846). Der junge Hoffmann war 1848 Abgeordneter bei der deutschen Nationalversammlung, 1854 verbreite er mit Christoph Paulus (1811-1893) einen Aufruf zur Auswanderung der Gläubigen nach Palästina, um dort die für Israel geltenden Verheißungen in Anspruch zu nehmen. In jenem Jahr wurde am 24. August im „Waldhorn“ von Ludwigsburg die Gemeinschaft gegründet als „Gesellschaft für die Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem“. Ein „Freiwilliger Ausschuss“, bestehend aus Christoph Hoffmann, Christoph Paulus, Georg David Hardegg und Louis Höhn, plante weitere Schritte. Eine Zeitschrift „Süddeutsche Warte“ wurde gegründet. Hardegg, der eine Veränderung seiner äußeren Lage nicht notwendig hatte, sprach zuerst den Gedanken aus, als Vorbereitung für die geplante Auswanderung nach Palästina schon in der schwäbischen Heimat eine eigene geschlossene Gemeinde zu gründen. So sollte die vorgesehene Erkundungsreise nach Palästina und die dazu nötigen Vorbereitungen gemeinschaftlich gelingen. Der Kirschenhardthof in der Nähe von Ludwigsburg konnte von den Jerusalemfreunden dann im April 1856 bezogen werden.
Die Templer, Hoffmannianer oder Kirschenhardthofgesinnte traten ab 1858 in den Gemeinden des Calwer Waldes auf. Ihre Prediger wurden als Erben von Blumhardts Werk angesehen. Ab 1858 wurden in Württemberg bis zu 10000 Mitglieder gesammelt. Einer der Prediger, Martin Blaich aus Zwerenberg (1820-1903), der später der engste Mitstreiter von Johannes Seitz wurde, hatte diesen in den Dienst berufen.
In der folgenden Woche ging der jugendliche Johannes durch manche innere Unruhen, bis er sich dazu entschließen konnte diesem Aufruf zu folgen. Geplant war eine Ausbildung über 4 Jahre in der Predigerschule des Kirschenhardthofes. Nach 2 ½ Jahren war Seitz dann aber bei Bibelstunden in der Gegend von Murrhardt so überzeugend, dass gebeten wurde, ihn dort direkt als Prediger einzusetzen. Deshalb wurde die Ausbildungszeit verkürzt. Es entstand in den nächsten Wochen eine Erweckung. Seitz Bedenken wurden von Christoph Paulus abgewiesen: „Das hätte Gott nicht getan, wenn er mich nicht reif für diese Arbeit gefunden hätte“.
Die Gründergestalt – Der Reichsbrüderbund (1878)
In diesen ersten Jahren des Dienstes von Johannes Seitz kam es zu einem ausgedehnten Reisedienst, den er oft auch gemeinsam mit seinem väterlichen Freund Martin Blaich ausführte. Anfangs war er im Bezirk Murrhardt stationiert und kam dabei auch in die angrenzenden Gebiete Frankens. Einige Gemeinschaftsgründungen gehen auf die Arbeit dieser Templer-Evangelisten zurück. Später wurde Seitz nach Stuttgart versetzt, mit dem Ziel auch den Umgang mit den Städtern zu üben. Der begabte Prediger aus dem Bauernstand sollte darauf vorbereitet werden, später eine Leitungsfunktion in der Templergemeinschaft zu übernehmen. Dies wurde jedoch durch die geistliche Entwicklung der Leiter und die damit einhergehenden Gewissensnöte, durch die Johannes ging, vereitelt. In einem längeren Abnabelungsprozess wurde Seitz die rationalistische Veränderung der Gesellschaft bewusst, zu der er immer weniger ein Ja hatte. Nur durch die Versetzung nach Schlesien im Jahr 1873, auf Grund einer Anfrage aus Marklissa, konnte Seitz den ihn bedrückenden Umständen in Württemberg entkommen. Von dort kam er nach kurzer Zeit nach Neusalz an der Oder in Liegnitz. Nachdem die Leiter des Tempels auch Taufe und Abendmahl verwarfen spitzte sich der innere Zwiespalt bei dem schwäbischen Prediger zu. Seitz war verunsichert, da Blaich innerlich noch ganz dem Tempel zuneigte. Nach weiterer Überzeugungsarbeit fühlten sich beide von Gott geführt aus der Gesellschaft auszutreten und mit Freunden aus Sachsen und Posen den „Evangelischen Reichsbrüderbund“ zu gründen, in Lissa im Jahr 1878. Dies war die erste Gründung von Johannes Seitz mit seinen Freunden, die bis heute als Württembergischer Brüderbund und seit 01.01.2012 als Württembergischer Christusbund ein Dachverband verschiedener Gemeinschaften darstellt.
Wie schon zu Beginn seiner Tätigkeit schlug das Herz von Johannes Seitz für die Evangelisation. Er war im Evangelisationsdienst in Schlesien, Posen, Sachsen, Brandenburg, Pommern und Ostpreußen unterwegs. Daneben besuchte er weiterhin die von ihm gegründeten Kreise im Schwarzwald, in der Hohenlohe und in Franken.
Gründung der Evangelischen Karmelmission (1904)
Neben der Evangelisation in verschiedenen Teilen Deutschlands war das frühere Interesse an Israel und dessen besondere Stellung in Gottes Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Auch nach der offiziellen Trennung von den Jersualemfreunden bestand weiterhin Kontakt zu den inzwischen auch selbstständigen Ansiedlungen um Georg David Hardegg, der sich auch von der Tempelgesellschaft losgesagt hatte. Erste Templer waren 1868 nach Israel ausgewandert nachdem es kurz vor den 60er Jahren erste Erkundungsfahrten gab. Es wurden dort mehrere Kolonien gegründet. Zuerst wurde in Haifa gesiedelt. Später wurden die Siedlungen Jaffa (1869), Sarona (1871), Jerusalem (1873), Wilhelm (1902) und Bethlehem-Galiläa (1906) gegründet. Johannes Seitz besuchte die Tempelgemeinden erstmals 1872 in Israel. Zu diesem Zeitpunkt bestanden ja bereits drei der Kolonien. Als er dort ankam war gerade die größte Krisensituation ausgebrochen. Hoffmann hatte Hardegg abgesetzt und dieser trennte sich dann von der Gesellschaft. Mit ihm traten auch viele der bekenntnistreueren Mitglieder aus. Hardegg blieb dann mit seinen Anhängern in Haifa. Seitz hielt sich zu Hardegg, da dieser ihm innerlich am nächsten stand: „Er war aber gerade derjenige, von welchem wir am meisten Anregung und Segen hatten, und durch ihn lebten wir immer der Überzeugung, die Tempelsache setzte das fort, was wird durch Pfarrer Blumhardt und Jungfrau Trudel empfangen hatten.“
Die Verbindung des Reichsbrüderbundes mit Hardegg wurde gehalten. So war Haifa die Missionsstation des Reichsbrüderbundes im heiligen Land. Nach dem Tod Hardeggs wurde die Kolonie von Friedrich Keller (1838-1913) dem Vizekonsul oder Konsularagenten geleitet. Dieser stammte wie Johannes Seitz aus Neuweiler und war ein Klassenkamerad von Johannes gewesen. So wurden auch durch diesen Kontakt weiterhin Besuche gepflegt. Martin Blaich reiste 1881 nach Palästina und schickte einen Aufruf nach Deutschland: „ Wir sollten auf dem Karmel eine Zufluchtsstätte für Leidende und Erholungsbedürftige schaffen. Keine Gegend ist so geeignet wie der Karmel. Wenn man ein Luftkurhaus hätte, würden auch sogleich Leute aus Jerusalem, Jaffa, Port Said, Alexandrien, Kairo usw. kommen. Und was für eine schöne Gelegenheit hätte man da, das Evangelium in alle Gegenden des Morgenlandes zu tragen.“ Seitz besuchte Palästina wieder 1886 und kurz nach dem Tod von Martin Blaich 1903. Dabei wurde die von Blaich gewünschte Missionsstation nach mancherlei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Johannes Seitz und Friedrich Keller gegründet. 1903 zeigte sich dann, dass ein größeres Gebäude nötig sei, um dem Auftrag nachzukommen. Keller und Seitz traten gemeinsam vor Gott, um im Gebet die Probleme und Hindernisse zu bewältigen. Dies war die von Johannes Seitz vorgeschlagene Strategie, die er schon in seinem Leben immer wieder genutzt hatte: „Die Hand des Höchsten kann alles ändern, und es ist das Vorrecht Gottes, dass er unsere dümmsten Streiche wieder gutmachen kann, wenn wir uns darüber beugen und wahre Buße tun und auch mit ganzem Ernst darum bitten.“ Die Frau von Johannes Seitz, war davon überzeugt, dass Pfarrer Schneider aus Sachsen angefragt werden sollte, in die Arbeit einzutreten. Nachdem Pfarrer Martin Philipp Schneider (1862-1933) ins Werk gerufen war und dieser auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellte zum Kauf eines Hotels neben dem kleinen Karmelheim, begann die Arbeit zu florieren. Schneiders Einzug im Missionshaus auf dem Karmel am 29.Mai 1904 wird als das offizielle Gründungsdatum der Karmelmission gezählt. Diese ist bis heute in verschiedenen Ländern aktiv, um Muslimen das Evangelium von Christus zu bezeugen.
Das Erholungsheim in Teichwolframsdorf und die Arbeitsprinzipien
Das Erholungsheim in Teichwolframsdorf wurde von Johannes Seitz im Jahr 1900 gegründet. Es handelt sich um das dritte Haus, das der Württemberger als Erholungsheim gegründet hatte. Zuvor hatte er in Preußisch-Bahnau das Haus seiner alternden Wirtsleute käuflich übernommen und im Jahr 1898 nach einem Ruf nach Sachsen ein Haus in Limbach gekauft mit Unterstützung von gleichgesinnten Freunden. Dieses Haus hatte ca. 10 Gästezimmer. Der Andrang an Erholungsgästen nahm stetig zu, so dass Gäste in den umliegenden Häusern untergebracht werden mussten. Ein Nachbarhaus stand zum Verkauf an, so dass eine Ausweitung des Werkes in denkbare Nähe rückte. Im Gebet wurde Seitz klar, dass dieser Ort in der Stadt nicht Gottes Wille entspreche.
Bei der weiteren Suche wurde ihm ein Grundstuck in der Nähe des Werdauer Waldes in Teichwolframsdorf angeboten. Dort baute Seitz mit seiner Frau dann ein großes Erholungsheim, das auf eine Bettenzahl von 100 Betten konzipiert war.
Ihm ging es darum, Erholung und Heilung für den inneren Menschen zu erreichen. Dazu sah er die Notwendigkeit, das Leben des Einzelnen in die richtige Beziehung zu Gott zu bringen, was durch Buße und Selbstgericht geschehen müsse. Dies wird deutlich in einer Anmerkung, die er seinem Hausprospekt anfügte:
Anmerkung: Wie man in den Anstalten Männedorf, Cannstatt, Hauptweil u. dergl. oft gesehen hat, so durften auch wir in und außerhalb unserer Anstalten Bahnau und Teichwolframsdorf erfahren, wie der Herr schon an manchen als unheilbar Aufgegebenen Seine Verheißung bestätigte: „Ich bin der Herr, dein Arzt,“ wenn sich der Kranke durch gründlich Buße, Selbstgericht und Heiligung seines Lebens in die rechte Stellung seinem Gott bringen ließ.
Darum ist die Tätigkeit unsers Hauses vor allem auf das Ziel gerichtet, sowohl die gesunden wie kranken Gäste durch die Mittel des Evangeliums und der Seelenpflege in die rechte Stellung zu Dem zu bringen, der die Quelle aller Seligkeiten und auch aller leiblichen wie geistigen Gesundheit und alles Lebens ist.
So erlebten viele der Gäste eine Zeit der geistlichen Zurüstung wie auch der körperlichen Kräftigung und mancher wunderbarer Heilungen. Krankenheilung auf den Glauben hin erlebte Johannes Seitz ja bereits in seinem Heimatdorf Neuweiler. Dieses Erleben prägte die Anschauungen des Evangelisten. Diese frühe Erfahrung und der Einfluss von Dorothea Trudel bis in seine Heimat, den nördlichen Schwarzwald waren Vorbild für die von ihm gegründeten Erholungsheime. Über Krankenheilungen, die durch ihn vermittelt wurden bzw. in seinem Umfeld und seinen Heimen geschehen sind berichtet Seitz ebenfalls in seiner Autobiographie.
Doch war auch dort der Ruf zum Glauben und die Festigung im Glauben das Hauptziel, das verfolgt wurde. Das Mittel des Evangeliums war die Methode die angewandt wurde. Dazu wurden biblische Andachten, „Erbauungsstunden“ gehalten, nämlich am Morgen und am Abend. Im Hausprospekt wird dies so ausgedrückt:
Das Erholungsheim Teichwolframsdorf ist eine Stätte für solche, welche das Bedürfnis haben, sich auf kürzere längere Zeit in die Stille zurückzuziehen, um neben der leiblichen Erholung und Ruhe auch Stärkung für Seele und Geist zu finden, zu welchem Zwecke die täglich zweimal stattfindende biblische Erbauungsstunde und Gebetsgemeinschaft dient.
Soweit auch Kranke oder in ihrer Gesundheit angegriffene Personen in das Erholungsheim Aufnahme wünschen, um der leiblichen Ruhe und geistlichen Pflege des Hauses sich zu bedienen, können nur solche berücksichtigt werden, welche weder bettlägerig noch geisteskrank noch mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind. Im Hause selbst werden keine allopathischen noch homöopathischen Mittel verabreicht, auch keine Wasserkuren angewendet. Sollte jemand ärztliche Hülfe wünschen, so leistet der Arzt im Orte dieselbe gern.
Dieser kommt auch allwöchentlich einmal ins Haus, um die neu angekommenen Gäste zu sehen, welche Kontrolle von der Behörde verlangt wird.
Eine ärztliche Begleitung wurde durch die Behörden verlangt, die durch einen niedergelassenen Mediziner vor Ort gewährleistet wurde.
Grundlage aller seelsorgerlichen Arbeit war ihm die Rechtfertigung aus Glauben allein. Darauf hat er immer wieder hingewiesen. Gekämpft hat er gegen jegliche gesetzliche Aktivität, die einer bestimmten Methode und bestimmten Vorschriften eine eigene Kraft zuschreiben wollte. Dies veranschaulichte Seitz selbst in seinen Erfahrungen, in denen er von gesetzlichen Bestrebungen des „Ostpreußischen Gebetsvereins“ berichtet, gegen die er sich auch stellte.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Fritz Barth: Templer und andere Erweckungsbewegungen im Nördlichen Schwarzwald und weit darüber hinaus, Bad Wildbad 2015
Max Runge: Johannes Seitz und der Aufbruch der neueren Gemeinschaftsbewegung, Dritte Auflage, Berlin 1969
Joachim Schnürle: Johannes Seitz aus Neuweiler und seine Erholungsheime – Zum 100. Todesjahr. Einst & Heute, Historisches Jahrbuch für den Landkreis Calw 2022/23, 2022, S. 137-146
Joachim Schnürle: Johannes Seitz – eine Gründergestalt der frühen Gemeinschaftsbewegung – zum 100. Todesjahr. Diakrisis 43 (2, Themenheft: „Macht und Gewalt“), 2022, S. 82-90
Johannes Seitz: Erinnerungen und Erfahrungen, Dritte Auflage, Chemnitz 1922
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/seitz-johannes (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Seiz, Johann Ferdinand
-
Von: Eisler, Jakob
Johann Ferdinand Seiz (1738-1793)
Er setzte sich für die allgemeine Schulpflicht ein, wollte die Armut abschaffen und war ein strenger Pfarrer. Außerdem gilt Johann Ferdinand Seiz als „Dichter des Pietismus“.
Johann Ferdinand Seiz wurde laut Taufregistereintrag am 7. Januar 1738 als Sohn des Pfarrers Georg Seiz in Lombach bei Freudenstadt geboren. Im frühen Kindesalter bekam er Unterricht bei seinem Vater in Adelberg zusammen mit dem späteren Theologen und Dichter Karl Friedrich Harttmann (1843–1815). Im Jahre 1752 wurde er in die Klosterschule von Denkendorf aufgenommen und lernte dort unter Prälat Philipp Heinrich Weissensee (1673–1767). Zwei Jahre später wechselte er nach Maulbronn. Im Theologischen Stift in Tübingen trat er am 10. September 1756 ein, wo er 1766 Repetent wurde. Seine erste Stelle trat er 1768 als Diakon in Besigheim an und heiratete im gleichen Jahr in Murrhardt die jüngste Tochter von Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782), Eberhardine Sophie (1748–1802). Oetinger wurde somit nicht nur sein Geistiger Vater, sondern auch sein Schwiegervater. Von den zehn Kindern dieser Ehe kamen nur drei ins Erwachsenenalter und überlebten den Vater.
Johann Ferdinand Seiz zog bei seinen Predigten oft das Prophetische Wort des Alten und Neuen Testaments heran und warnte vor Abweichungen dieser Schriften.
Laut Eduard Emil Kochs Einschätzung war Seiz‘ erklärtes Ziel: „daß der Bettel abgeschafft werde, und daß, worauf auch schon in Besigheim sein unermüdliches Bestreben gerichtet war, das Schulwesen in Aufnahme [allgemeine Schulpflicht] kam. Dabei handhabte er, so weit es damals noch möglich war, mit allem Eifer die Kirchenzucht.“
Nur wenige Predigten aus seiner Feder wurden gedruckt so z.B.: Predigt von der heilsamen Gewissensprüfung bei groben Ausbrüchen der Sünde, Tübingen 1771, oder: Zwei Predigten von der christlichen Kirchenzucht der Gemeinde des Herrn in Besigheim, Tübingen 1783. Er wurde auch durch seine Lieder und Gedichte bekannt. Sein bekanntestes Stück ist: „Warten wird nie gereuen“ - ein Aufmunterungslied.
Im Jahre 1790 wurde Seiz Stadtpfarrer in Sindelfingen, wo er nur drei Jahre bis zu seinem Tod am 23. September 1793 wirken konnte.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/seiz-johann-ferdinand (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Spieth, Julius
-
Von: Johannes Stahl
Julius Spieth (1876-1955)
-
Julius und Julie Elisabeth Spieth 1907 bei der Hochzeit in Indien
Archiv der Basler Mission, QL-30.001.0038
Der in Oberesslingen geborene Julius Spieth war Mechaniker und Sonntagsschulhelfer, bevor er seine theologische Ausbildung am Missionsseminar in Basel begann. 1902 wurde er ordiniert und als Basler Missionar nach Hubli (Mysore, Indien) gesandt. 1905 wirkte er in Bidjapur und ab 1907 in Guledgudd (Südindien). Im selben Jahr heiratete er Julie Elisabeth Ritter (1880-1968), die selbst aus einer württembergischen Missionarsfamilie stammte. Die beiden hatten sich durch Vermittlung der Mission in einem intensiven Briefwechsel über die Kontinente hinweg kennen gelernt. Für den Heiratsantrag musste Spieth, wie damals üblich, von der Missionsleitung die Zustimmung erbitten. Ohne ihren Zukünftigen gesehen zu haben, reiste die junge Frau von Basel nach Indien, wo Spieth, wie in Aufzeichnungen zu lesen ist, seine zukünftige Braut an der Hafeneinfahrt mit Spannung erwartete. Sie heirateten am in Mangalore. Sie bekamen sechs Söhne und eine Tochter.
Im Jahr 1914 musste Spieth infolge der beginnenden Wirren des Ersten Weltkriegs seine Tätigkeit in Indien beenden und wurde Fest- und Konferenzredner. Ende 1914 begann er in Holzheim bei Göppingen als Pfarrverweser und 1925 als ständiger Pfarrer, wo er 30 Jahre später starb. 36 Jahre hat er in Göppingen-Holzheim gewirkt und sich gleichzeitig von der „Heimatgemeinde“ aus für den Aufbau der Kirche in Süd-Indien eingesetzt.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/spieth-julius (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Spittler, Christian Friedrich

-
Von: Kittel, Andrea
Christian Friedrich Spittler (1782-1867)
Christian Friedrich Spittler war ein begnadeter Netzwerker, ein Organisationsgenie und Meister im Sammeln von Spenden. In seinem Glauben und Handeln geprägt vom württembergischen Pietismus, gab er Anstoß zu mehr als 20 wohltätigen und missionarischen Einrichtungen.
Der 1782 in Wimsheim geborene Pfarrerssohn arbeitete zunächst als Stadtschreiber in Schorndorf. Er war erst 19 Jahre alt, als ihn im Jahr 1801 sein Freund Karl Friedrich Adolf Steinkopf als Sekretär der Christentumsgesellschaft nach Basel rief. Unter Spittler entwickelte sich die Gesellschaft zu einem Mittelpunkt des religiösen Lebens weit über Basel hinaus.
Beharrlich suchte Spittler nach Antworten auf die Not seiner Zeit. Französische Revolution und Aufklärung hatten Machtverhältnisse und Traditionen radikal infrage gestellt. Soziale Umbrüche brachten den Ärmsten leibliche und geistige Verelendung. Neue Verkehrswege machten unbekannte Weltregionen erreichbar, deren Kolonisierung zeigte sich unter anderem in Ausbeutung und Sklaverei.
„Nicht jammern, Hand anlegen!“ soll Spittlers Motto gewesen sein. Nachdem er mit seinem Kollegen und Mitstreiter Christian Gottlieb Blumhardt bereits 1804 eine Bibelgesellschaft ins Leben gerufen hatte, folgte 1815 die Gründung der Basler Missionsgesellschaft. Nicht aus Profitgier sollten christliche Europäer in fremde Kontinente vordringen. Die ausgesandten Missionare sollten vielmehr Überbringer einer „wohltätigen Zivilisation und eines Evangeliums des Friedens“ sein – wie es das Missionskomitee bereits bei der Gründung formulierte.
Um der zunehmenden Verwahrlosung armer Kinder und Jugendlicher entgegen zu wirken, gründete Spittler mit dem Pädagogen Christian Heinrich Zeller ab 1820 die Armenschullehrer- und Kinderrettungsanstalt in Beuggen. Ab 1838 entstand die Taubstummenanstalt in Riehen mit angegliederter Kleinkinderschule, später noch ein Kinderspital.
Sein Lieblingswerk wurde die 1840 gegründete Pilgermission St. Chrischona in Bettingen. Junge wandernde Handwerker sollten eine biblisch-theologische Ausbildung erhalten, um missionarische Aufgabe in Europa und Nordamerika zu übernehmen – so etwa die Arbeit mit deutschen Auswanderern in Texas.
Spittlers Einsatz für Benachteiligte war unermüdlich. Selbst sein Haus in Basel stand im Dienst des Reiches Gottes. Es war nicht nur Treffpunkt vieler Gleichgesinnter im Hauskreis, sondern auch Herberge für Studenten und betagte alleinstehende Frauen. Seine Frau Susanna (geb. Gölz) war ausgebildete Lehrerin und führte neben dem großen Haushalt noch eine Mädchenschule und sorgte für die beiden Adoptivkinder Susette und Markus.
Bis ins hohe Alter bewahrte sich Spittler eine erstaunliche Schaffenskraft. Antrieb war ihm sein Glaube und die Überzeugung, sich vorbehaltlos Gott zur Verfügung zu stellen, damit Gott durch ihn Außerordentliches bewirken könne. Er verstarb 1867 in Basel.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/spittler-christian-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Spittler, Ludwig Timotheus
Ludwig Timotheus Spittler (1752-1810)
-
Ludwig Timotheus Spittler
Quelle: Württ. Landesbibliothek
Am 11. November 1752 wird Ludwig Timotheus Spittler als Sohn eines Stiftskirchendiakons und späteren Prälaten in Stuttgart geboren. Der hochbegabte und ehrgeizige Spittler gilt heute als einer der bedeutendsten und vielseitigsten Kirchen- und Profanhistoriker des 18. Jahrhunderts, der zugleich stets politisch wirkte.
Schon im Elternhaus wird er vom heiß diskutierten Konflikt zwischen württembergischem Herzog und Landständen früh politisiert. Er ist ein Aufklärer, aber beileibe kein Revolutionär – die alte ständische württembergische Verfassung bleibt ihm zeitlebens ein Ideal.
1770 beginnt er als Stiftsstipendiat das Theologiestudium in Tübingen. Eine wissenschaftliche Reise führt ihn nach Norddeutschland, wo ihn vor allem die Begegnung mit Lessing nachhaltig prägt. Dessen Stil eifert er später ebenso nach wie seiner aufklärerischen Theologie. 1777 wird er Stiftsrepetent, und schon zwei Jahre später erhält er einen Ruf an die Göttinger Universität.
Dort befasst er sich zunächst mit der Kirchengeschichte und veröffentlicht 1782 einen „Grundriss der Geschichte der christlichen Kirche“ – ein schmales, meinungsfreudiges Werk, dem großer Erfolg beschieden ist. Am Schluss dieses Werks entwirft Spittler die Vision einer ökumenischen Überwindung der Kirchenspaltung in einer aufgeklärten Kirche.
In den folgenden Jahren wandte Spittler sich der politischen Geschichte zu. Er verfasst bedeutende Werke über die Geschichte Württembergs und Hannovers und schließlich seinen großen „Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten“. Spittler gilt aber auch als ein Meister der historischen Miniatur und der Kritik. Schon bald hat er seine berühmten Göttinger Kollegen an Ansehen übertroffen. Zunächst unsicher im Vortrag, entwickelt sich Spittler bald zu einem begnadeten Vortragsredner, dessen Vorlesungen weithin großen Anklang finden.
Spittler selbst hat in seiner Württembergischen Geschichte geschrieben, der Wechsel vom Katheder ins Kabinett sei noch den wenigsten gut geraten. Selbst will der ehrgeizige Professor aber diesen Schritt wagen und nimmt seine alten Beziehungen nach Württemberg wieder auf – mit Erfolg: Herzog Friedrich Eugen ernennt ihn 1797 zum Wirklichen Geheimen Rat. Als der Herzog aber noch im selben Jahr stirbt und der despotische Friedrich II. ihm nachfolgt, verdüstern sich die Aussichten Spittlers, reformerisch tätig sein zu können. Als Geheimer Rat ist er unter anderem für die Hochschulen tätig, und die Universität Tübingen hat ihm einiges zu verdanken. Auch seine äußere Karriere verläuft glänzend: Spittler wird zum Staatsminister und zum Freiherrn ernannt. Aber es gehört zur Tragik von Spittlers Leben, dass er, der scharfsinnige Historiker und Anhänger der altwürttembergischen Verfassung als Praktiker der Macht so wenig in der Lage war, Reformimpulse zu geben. Spittler litt darunter. Nach langer Krankheit starb er am 14. März 1810 in Stuttgart.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/spittler-ludwig-timotheus (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Strauß, David Friedrich
David Friedrich Strauß (1808-1874)
Er war ein junger Mann, der zu den größten Hoffnungen berechtigte: unter den Besten in der berühmten „Geniepromotion“ im Tübinger Stift, ein brillanter Kopf, an dessen Lippen die Studenten hingen, wenn er philosophische Vorlesungen hielt. Bis er mit 27 Jahren ein Buch veröffentlichte, von dem Albert Schweitzer schrieb: „Als literarisches Werk gehört … es zum vollendetsten, was die wissenschaftliche Weltliteratur kennt“. Aber es wurde ein Skandalbuch, und Strauß galt vielen Frommen im Land als Zerstörer des Glaubens.
David Friedrich Strauß wurde am 27. Januar 1808 in Ludwigsburg als Sohn eines Kaufmanns und einer Pfarrerstochter geboren. 1821 trat er ins Seminar Blaubeuren ein und begegnete dort Friedrich Christian Baur, der ihn als Lehrer nachhaltig beeinflussen sollte. Hier fand er auch mit einigen Mitschülern zusammen, denen er zeit seines Lebens verbunden sein sollte – Friedrich Theodor Vischer war einer von ihnen.
Das „Leben Jesu“
Strauß wurde 1832 als Repetent an das Tübinger Stift berufen. Dort widmete er sich dem Leben Jesu – ein Wendepunkt nicht nur in seinem Leben, sondern in der ganzen Theologiegeschichte. In diesem epochemachenden Werk unternahm Strauß es, die Jesus-Erzählungen im Neuen Testament als Mythos zu verstehen, als „Einkleidungen urchristlicher Ideen, gebildet in der absichtslos dichtenden Sage“. Der radikal-kritische Blick auf die Evangelien erregte ungeheures Aufsehen und beeinflusste die theologische Forschung nachhaltig. Vieles von dem, was in der historisch-kritischen Erforschung der Bibel heute Gemeingut ist, findet sich hier vorgebildet. Strauß selbst hatte noch gemeint, in seiner Arbeit den Kern des Glaubens freizulegen, seine Kritik wurde aber weithin als Angriff auf das Christentum an sich verstanden.
Noch bevor der zweite Band erschienen war, hatte ihn die Kirchenbehörde von seiner Repetentur abgezogen. In Zürich berief man ihn 1839 auf eine Professur. Das stieß auf der konservativ-kirchlichen Seite aber auf so heftige Gegenwehr, dass die Regierung im sogenannten Straußenhandel darüber stürzte. Nach bevor er den Ruf annehmen konnte, wurde er in den Ruhestand versetzt.
Seine Ehe scheiterte schon bald; die folgenden Jahre waren von Selbstzweifeln, Depressionen und ständigen Ortswechseln geprägt. Auch seine Tätigkeit als Abgeordneter im württembergischen Landtag gab er bald auf. Mit einigem Erfolg verlegte sich Strauß auf das Verfassen biografischer Studien – meist von Außenseitern, in denen er sich wohl selbst sah. Von der Kirche entfremdete er sich zusehends. In seinem Alterswerk Der alte und der neue Glaube verwarf Strauß die christliche Religion vollends zugunsten einer Mischung aus Pantheismus und Materialismus. Er starb vor 150 Jahren, am 8. Februar 1874, in Ludwigsburg und wurde auf eigenen Wunsch ohne Glockengeläut und Geistlichen beigesetzt.
Strauß kann als einer der wirkmächtigsten Theologen des 19. Jahrhunderts gelten – hinter die furiose disruptive Kraft seines Lebens Jesu kann die Theologie seither nicht mehr zurück.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/strauss-david-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Umfrid, Hermann
-
Von: Kienzle, Claudius
Inhaltsverzeichnis
Hermann Umfried (1892-1934)
1: Familienverhältnisse
V Otto Umfrid (1857-1920), Pfarrer, Publizist, Pazifist, Vizepräsident der Deutschen Friedensgesellschaft. M Julie Karoline, geb. Reischle (1861-1936). G Johanna Mathilde Charlotte; Margarete Paula Ottilie ∞ Prälat Karl Hartenstein; Ruth Else Irene. ∞ Irmgard geb. Silcher. K Vier Töchter.
2: Biographische Würdigung
-
Hermann Umfried als Mitglied der Studentenverbindung Nicaria
Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 4864
Der am 20. Juni 1892 in Stuttgart geborene U. wuchs als ältestes von vier Geschwistern im Pfarrhaus des Vizepräsidenten der Deutschen Friedensgesellschaft, Otto U., auf. Der christlich begründete Pazifismus des Vaters, sein Einsatz für die Lösung der sozialen Frage, seine Arbeit für die Völkerverständigung und sein Kampf gegen Militarismus und Imperialismus, prägten U. stark.
Nach dem Abitur studierte er ab 1910 zunächst zwei Semester Jura an der Universität Tübingen und wechselte dann zur evangelischen Theologie. Er belegte Veranstaltungen bei dem Systematischen Theologen Theodor Haering, dem Kirchengeschichtler Karl Müller und dem Neutestamentler Adolf Schlatter, denen er allesamt kritisch gegenüberstand. Darüber hinaus belegte U. auch weiterhin nichttheologische Veranstaltungen. Er schloss sich der akademischen Verbindung Nicaria an, wo er sich den späteren religiösen Sozialisten und Amtsbruder Gottfried Schenkel zum Mentor auserkor. Im Laufe seines Studiums hatte er verschiedene Verbindungsämter inne. Zum Sommersemester 1914 wechselte er an die Universität Marburg, nicht zuletzt um Wilhelm Heitmüller, einen Vertreter der Religionsgeschichtlichen Schule, und den Kulturprotestanten Martin Rade zu hören.
Trotz seiner pazifistischen und antiimperialistischen Überzeugung meldete er sich bereits wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus vaterländischer Gesinnung als Kriegsfreiwilliger. Bald geriet er in englische Gefangenschaft. In den Lagern Frith Hill und Handforth organisierte U. in einer Lagerschule wissenschaftliche, kulturelle und seelsorgerliche Veranstaltungen. Nach einem kurzzeitigen Aufenthalt in einem Repressalienlager in Le Havre wurde er aus gesundheitlichen Gründen im Dezember 1916 in die Schweiz ausgetauscht. In Zürich setzte er sein Studium fort, bis eine Einreise nach Deutschland möglich wurde. Während dieser Zeit studierte er bei dem religiösen Sozialisten Leonhard Ragaz, zu dem er Zeit seines Lebens Kontakt hielt.
Nach der ersten theologischen Dienstprüfung 1918 wurde er in Lorch, dem Wohnort des erblindeten und deswegen pensionierten Vaters, vom dortigen Pfarrer Karl Oelschläger ordiniert. In der revanchistischen Atmosphäre der Nach- und Zwischenkriegszeit waren die früheren pazifistischen Aktivitäten und Polemiken des Vaters ein Karrierehindernis für den Kriegsfreiwilligen Hermann Umfrid. Dass er während seines Vikariats bis zur Übertragung der ersten ständigen Pfarrstelle auf zehn verschiedenen Stellen eingesetzt wurde, entsprach durchaus den damaligen Gepflogenheiten. Auffällig ist hingegen, dass er auch nach seiner zweiten theologischen Dienstprüfung 1920 zwei Jahre lang nur mit Vertretungsdiensten beauftragt wurde und sich in dieser Zeit erfolglos um insgesamt 18 Pfarrstellen bewarb, ehe er zum Pfarrer von Kaisersbach ernannt wurde.
Etwa 1920 trat U. der konfessionellen Jugendreformbewegung „Bund der Köngener“ bei, zu deren führenden Mitglieder er bald zählte. In Vorträgen und Zeitschriftenbeiträgen sensibilisierte er den Bund für Pazifismus, Völkerverständigung sowie ethische und politische Verantwortung. Dabei changierte sein Verhältnis zur Landeskirche zwischen wohlwollender Kritik und distanzierter Treue. Ungeachtet seines Engagements für Toleranz, Freiheit und Menschenwürde vollzog auch U. die Orientierung des Bundes hin zu einer diffusen deutschen Religiosität. So las er die Edda, und seine prosaischen Dichtungen sind geprägt von einer Mischung aus naturmystisch-christlichen und nationalromantischen Motiven. Er nahm im Auftrag des Köngener Bundes an Tagungen der religiösen Sozialisten, dem Weltbund der Jugend sowie internationaler Friedens- und Völkerverständigungsorganisationen teil. Seine Verbundenheit mit der Jugendbewegung zeigte sich auch auf der habituellen Ebene, indem er bei öffentlichen Auftritten bisweilen die jugendbewegte Tracht der Köngener trug. Wenngleich bei U. eine Faszination für das Germanentum einerseits sowie eine thematische Affinität zu den religiösen Sozialisten andererseits erkennbar ist, bestand eine gewisse Nähe zur liberalen Theologie.
Ein Jahr nachdem er seine erste Pfarrstelle in Kaisersbach angetreten hatte, heiratete er 1923 Irmgard Silcher. In Kaisersbach war U. um den Ausgleich zwischen den verschiedenen religiösen Gruppierungen seines Gemeindebezirks bemüht. Zusätzlich übernahm er das Amt des Bezirksjugendpfarrers für den Kirchenbezirk Welzheim. Er entwickelte in seiner landwirtschaftlich geprägten Gemeinde neue kirchliche Angebote für Jugendliche, die trotz seines von Vorgesetzen als akademisch empfundenen Sprachduktus durchaus Anklang fanden. Er beteiligte sich an der aktuellen Debatte um eine zeitgemäße Interpretation der Konfirmation und warnte vor einer allzu dogmatischen Festlegung der Heranwachsenden auf die tradierten Glaubens- und Ritualformen. Durch öffentlich vorgetragene Habitus- und Lebensstilkritik am höheren Beamtentum und Teilen der Pfarrerschaft erregte er erhebliches Aufsehen. Obwohl ihm der Welzheimer Dekan riet, mehr Zurückhaltung walten zu lassen, schränkte U. seine kritischen Äußerungen nicht wesentlich ein.
Nach seinem Wechsel auf die Pfarrstelle im hohenlohisch-fränkischen Niederstetten achtete er auf ein gutes Verhältnis zu seinem katholischen Kollegen und zur dortigen jüdischen Gemeinde. Gleichwohl tauchten in seinen Predigten und öffentlichen Äußerungen antisemitische Stereotypen und Motive des christlichen Antijudaismus auf. Neben einer intensiven seelsorgerlichen Besuchstätigkeit bildete die Arbeit mit Jugendlichen einen weiteren Schwerpunkt seines Wirkens. Hier war seine Herkunft aus der Jugendbewegung deutlich erkennbar. Im freiheitlichen Geist des Bundes der Köngener gab er ungewöhnlicherweise in Schule und Konfirmandenstunde eine Art Sexualkundeunterricht. Tanznachmittage im Pfarrgarten konfligierten ebenfalls mit den zeittypischen kirchlichen Verhaltensnormen. Ungewöhnlich war ferner seine aktive Mitgliedschaft im Turnverein. Sein vielfältiges Engagement in der Gemeinde und im Bund der Köngener führten immer wieder zu psychischen Erschöpfungszuständen, die längere Erholungsphasen nötig machten.
Dem Nationalsozialismus begegnete U. aufgeschlossen. In speziellen Gemeindeveranstaltungen zeigte er seinen Gemeindemitgliedern Wege, mit nationalsozialistischen Ritualen und Ansprüchen positiv umzugehen. Dessen ungeachtet verweigerte er am „Tag von Potsdam“ das von Staat und Partei gewünschte Glockengeläut, weil ihn eine entsprechende Anweisung der Kirchenleitung nicht rechtzeitig erreicht hatte. Schließlich wurde das Geläut mit Billigung durch U. von örtlichen Parteivertretern durchgesetzt. Als wenige Tage später, am 25. März 1933, einem Sabbat, Niederstetter Juden durch auswärtige SA-Männer brutal misshandelt wurden, übermittelte er den Betroffenen umgehend seine Solidarität, protestierte in seiner Predigt am folgenden Sonntag scharf gegen das von der SA als „Polizeiaktion“ charakterisierte Pogrom und kritisierte es als Akt der Rechtlosigkeit und Willkür.
Die an sich der nationalen Begeisterung gewogene und die nationalsozialistische Machtübernahme würdigende Predigt erregte wegen ihrer eindeutigen Verurteilung der Ereignisse vom Vortag den Unwillen der örtlichen Parteieliten. Diese informierten die Gauleitung in Stuttgart, nachdem U. sich geweigert hatte, seine Predigtworte zu widerrufen und ein lokaler Schlichtungsversuch im Kirchengemeinderat, der ihn zunächst stützte, gescheitert war. U. versuchte seinerseits sich – unter Bezug auf ähnliche Stellungnahmen der Geistlichen im benachbarten Öhringen – des Rückhalts seines vorgesetzten Dekans, Otto Hohenstatt, zu versichern. Dieser legitimierte die Verweigerung des Glockengeläuts und gestand U. im Hinblick auf seine Predigt Handlungsfreiheit zu, folgte ihm aber inhaltlich nicht.
U. Eintreten für Rechtsstaatlichkeit, für das Gewaltmonopol des Staates und gegen individuelle Willkür war theologisch motiviert. Es war nach lutherischem Verständnis Sache der Obrigkeit, entsprechend des geltenden Rechtsbewusstseins zu handeln. Gegen dieses Rechtsbewusstsein war von den staatlich nicht legitimierten Schlägern eklatant verstoßen worden. Dass Oberkirchenrat und Dekan nach Prüfung seiner Predigt den theologischen Argumenten weder folgten noch diese anerkannten, sondern statt dessen die Predigt insgesamt – entlang der wohlwollenden Linie der Kirchenleitung gegenüber dem Nationalsozialismus – als zu politisch tadelten, stellte U. vor seinen Kritikern bloß. Hatte bereits sein Vater 36 Jahre zuvor wegen seines theologisch begründeten Pazifismus einen politisch motivierten, offiziellen Verweis der Oberkirchenbehörde erhalten, so verbitterte ihn die jetzige Zurechtweisung der Kirchenleitung. U. begegnete ihr mit Unverständnis und seine Position verlagerte sich ins Grundsätzliche. Vergeblich versuchte er seine Vorgesetzen bis hin zum Kirchenpräsidenten Theophil Wurm mit konkreten Vorschlägen, die er zusammen mit Kollegen des Köngener Bundes ausgearbeitet hatte, zu öffentlichen Stellungnahmen zu bewegen. Die Eingabe an Wurm wurde von der Kirchenbehörde ignoriert. Die äußerliche Situation in Niederstetten schien nach dem Eindruck, den der Dekan bei der folgenden Visitation aufnahm, bald befriedet gewesen zu sein. Innerlich eskalierte Umfrids psychische Labilität in depressive Zustände. Von der Passivität der Kirchenleitung enttäuscht und einer Reihe von Verhören, Drohungen und körperlichen Angriffen erschöpft, fügte er sich im am 21. Januar 1934 tödliche Verletzungen zu.
Ehemalige Mitglieder der jüdischen Gemeinde Niederstetten legten 1979 im Wald der Märtyrer in Yad Vashem einen „Umfrid-Gedenk-Garten“ an. Damit sollte an die „hohen Ideale dieses Kämpfers für Menschenrechte und Menschenwürde“ erinnert werden.
Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Literatur
Literatur:
Willy Collmer, Vor fünfzig Jahren, in: Mitteilungen. Bund der Köngener 229 (März 1983), S. 5-7
Irmgard Umfrid, Hermann Umfrid. Erinnerungen an die Jahre 1930 bis 1934 in Niederstetten, in: Württembergisch-Franken. Jahrbuch 66 (1981/82), S. 203-227
Christoph Weismann, Hermann Umfrid, in: Ulrich K. Gohl/Christoph Weismann (Hrsg.), Die Suche hat nie aufgehört. Die Tübinger Nicaria 1893 bis 1983, Tübingen 1983, S. 154-162
Manfred Schmid, Hermann Umfrid. Kämpfer für Menschenrecht und Menschenwürde, in: Schwäbische Heimat 37, Heft 1 (1986), S. 4-11
Susanne Meyer, Pfarrer Hermann Umfrid und sein Wirken in Niederstetten von 1929-1934. Unter besonderer Berücksichtigung der Niederstettener Synagogengemeinde, (HA zur 1. thD) Tübingen 1989 (unv. Ms)
Eberhard Röhm/Jörg Thierfelder, Juden, Christen, Deutsche. Bd. 1.: Ausgegrenzt 1933-1935, Stuttgart 1990, S. 118-140
Björn Mensing/Heinrich Rathke, Mitmenschlichkeit, Zivilcourage, Gottvertrauen. Evangelische Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus, Leipzig 2003, S. 36+37
Helmut Reischle, Hermann Umfrid (1892-1934). Kämpfer für Gerechtigkeit, in: Freiburger Rundbrief 3 (2003), S. 176-180. Hartwig Behr, „Was gestern in unserer Stadt geschah, das war nicht recht!“, in: Fränkische Nachrichten vom 21. Januar 2004, S. 24
Quellen:
LKA Stuttgart: PA Hermann Umfrid
LKA Stuttgart, A 126 Nr. 651
LKA Stuttgart, K16; Archiv d. Bundes der Köngener.
WLB: Cod. hist. 2" 1016 Anhang Hss II, 176
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/umfrid-hermann (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Umfrid, Otto

-
Von: Sabine Tomas
Inhaltsverzeichnis
Otto Umfrid (1857-1920)
1: Herkunft
Otto Umfrid wurde am 02. Mai 1857 in Nürtingen als Sohn alter württembergischer Familien geboren. Dieses württembergische Erbe blieb sein ständiger Begleiter. Zu seinen Vorfahren zählten unter anderem die Reformatoren Johannes Brenz und Matthäus Alber, Regina Bardili oder Michael Erhart. Bardili wurde als „schwäbische Geistesmutter“ bekannt, Michael Erhart schuf den Blaubeurer Altar. Sein Vater Otto Ludwig Umfrid (1822 - 1913) war Rechtsanwalt und Privatgelehrter.
Nicht nur seine Tätigkeit als Karl Christian Plancks erster Biograf (1819 - 1880) prägte das Denken und die Einstellung seines Sohnes Otto entscheidend - Otto Umfrids letzte Veröffentlichung beschäftigte sich mit der Philosophie Plancks und wurde 1917 unter dem Titel „Da die Zeit erfüllet ward…“ herausgegeben - auch des Vaters Tätigkeit als Rechtsanwalt prägte seine Vorstellung, dass wirklicher Friede vor allem durch Verständigung, Verträge und die Stärkung internationaler Gerichte zu schaffen und zu erhalten sei.
2: Ausbildung und Pfarrdienst in Stuttgart
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Ulm studierte Otto Umfrid ab 1875 am Tübinger Stift evangelische Theologie. In dieser Zeit prägte ihn besonders der Kirchenhistoriker Karl Weizsäcker. 1890 wurde er zunächst Stadtpfarrer an der Martinskirche in Stuttgart, bevor er an die Stuttgarter Erlöserkirche berufen wurde. Ein schweres Augenleiden, eine Netzhautablösung, sorgte dafür, dass er seinen Beruf 1913 aufgeben musste. Neben seinen Pflichten als Pfarrer war er Herausgeber des evangelischen Sonntagsblattes „Grüß Gott“, gab den Volkskalender „Der Friedensbote“ heraus und schrieb ein „Arbeiter-Evangelium“.
3: Engagement für die Deutsche Friedensgesellschaft
Doch eine andere zusätzliche Tätigkeit sollte dafür sorgen, dass Umfrid nicht nur bei seinem Arbeitgeber in Ungnade fiel: 1894 trat Umfrid der Stuttgarter Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft bei und verhalf der Bewegung zu großem Aufschwung im schwäbischen Raum. Nachdem er gesehen hatte, dass sich die Arbeit der Ortsgruppe überwiegend auf interne Treffen und Diskussionen beschränkte, gab er den Impuls, an die Öffentlichkeit zu gehen, damit die Ideen der Bewegung mehr Wirkung erzielen konnten. Er gründete etwa 20 weitere Ortsgruppen und hielt Vorträge. Seine Bemühungen waren so erfolgreich, dass die Geschäftsstelle der Deutschen Friedensgesellschaft 1900 von Berlin nach Stuttgart umzog und fortan fest mit dem Namen Otto Umfrid verbunden blieb, der damals ihr zweiter Vorsitzender wurde.
Otto Umfrid hielt mehrere Vorträge, auch im Ausland. Er schrieb mehrere hundert Aufsätze, überwiegend in der von Bertha von Suttner gegründeten Revue „Die Waffen nieder!“. Trotzdem gelang es ihm nicht, die Legenden um Kaiser Wilhelm I., General Moltke und Bismarck zu zerstören und die Verherrlichung des Krieges in der Bevölkerung nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verhindern.
4: Publizistische Wirksamkeit und Anwärter für den Friedensnobelpreis
Seine Kampfschriften, u.a. „Die Moral in der Politik“ von 1897, in der er Bismarcks Politik kritisierte, wie auch „Anti Treitschke“ aus dem Jahr 1904, in der er sich entschieden gegen die Geschichtsphilosophie Treitschkes stellte, der mit subjektiver Geschichtsschreibung und antisemitischen Schriften die Gewaltbereitschaft und den Nationalismus in der Gesellschaft befeuerte, sorgten für Empörung. Dennoch wurde „Anti Treitschke“ eine seiner bedeutendsten Arbeiten. Darin bekräftigt er, dass an die Stelle der Gewalt gerade im internationalen Umgang das Recht treten solle, die Ausbildung des Völkerrechts solle dafür Sorge tragen, zwischenstaatliche Anarchie und Kriege zu verhindern und zu beenden. So trat Umfrid bereits vor 1914 für den Gedanken eines Völkerbundes ein. Im Jahr 1913 wurde er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, die Verleihung konnte aber aufgrund des Ausbruchs des ersten Weltkriegs nicht stattfinden.
Mit Ausbruch des Krieges verlor die Deutsche Friedensgesellschaft an Mitgliedern, Otto Umfrid aber bleibt der Bewegung treu. Seine publizistische Arbeit unterlag fortan strenger Zensur. Die pazifistische Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtige den „festen unbeirrbaren Willen zum Durchhalten“ und beeinträchtige das Bild Deutschlands im feindlichen Ausland dahingehend, dass dieses „zu falschen Ansichten über die innere Kraft Deutschlands“ komme. Der von Otto Umfrid und Ludwig Quidde herausgegebene „Völker-Friede“ wurde verboten, die nachfolgende Zeitschrift „Menschen- und Völkerleben“ stark zensiert.
Der nun völlig erblindete Otto Umfrid ließ sich nicht entmutigen und führt seine Arbeit im Ausland durch den Besuch pazifistischer Konferenzen in neutralen Ländern fort, bis ihm sein Pass von den Behörden entzogen wurde. Er schaffte es dennoch, seine gesammelten Kriegsaufsätze in die Schweiz zu schmuggeln. Sie wurden im Züricher Verlag unter dem Titel „Weltverbesserer und Weltverderber“ von Orell Füssli veröffentlicht.
Von seinem Augenleiden entkräftet, zog Otto Umfrid mit 59 Jahren samt seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Lorch. Diese lasen ihm aus philosophischen Schriften vor und schrieben seine Gedanken nieder, sodass Umfrid in Lorch seine letzte große Arbeit beenden konnte, sein Werk über den Philosophen Karl Christian Planck. Er starb drei Jahre nach dessen Veröffentlichung am 23. Mai 1920.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/umfrid-otto (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vaihinger, Johann Georg
-
Von: Quack, Jürgen
JOHANN GEORG VAIHINGER (1802-1879)
-
Johann Georg Vaihinger
Archiv der Basler Mission, Signatur BMA QS-30.001.0076.01
Er war einer der besten in seiner Klasse im Missionsseminar – und dennoch erhielt er keine Ausreiseerlaubnis. Das Komitee der Basler Mission war streng: nur wer eine stabile Gesundheit hatte, wurde in die Welt geschickt.
Johann Georg Vaihinger wurde am 26. Januar 1802 in Göppingen geboren. Er erlernte dort zunächst den Beruf des Zeug- oder Tuchmachers. Mit 19 Jahren ging er nach Basel ans Missionsseminar. Damals muss seine Gesundheit noch keinen Anlass zur Sorge gegeben haben, denn vor der Aufnahme wurde geschaut, ob die Bewerber „in physischer, intellektueller, moralischer und religiöser Hinsicht tauglich“ sind. So sah es der Studienplan vor. Während der Ausbildung wurde seine außerordentliche Sprachbegabung festgestellt: er lernte nicht nur Englisch und Holländisch – als Vorbereitung für den Dienst in einer holländischen oder englischen Missionsgesellschaft – sondern auch Griechisch und Hebräisch, um später die Bibel aus der Ursprache übersetzen zu können. Als es sich gegen Ende der Ausbildung abzeichnete, dass er in den Orient gesandt werden sollte, da lernte er auch noch Arabisch
Im Sommer 1825 wurde er für den Dienst „unter den Muslimen“ in der „Persischen Mission“ bestimmt. Dafür wurde er beim Missionsfest in Basel eingesegnet und am 3. August ist Stuttgart ordiniert. Doch dann entschied das Komitee: er ist nicht gesund genug. Keine Ausreise! – Es war ein schweres Augenleiden, das dafür den Ausschlag gab. Auf Grund seiner guten Leistungen und Fähigkeiten bot ihm das Komitee stattdessen an, er sollte als Hilfslehrer am Seminar in Basel bleiben. Er nahm den Vorschlag an und war von 1826 bis 1830 im Missionshaus tätig.
Weil er jedoch keine Aussicht auf eine feste Anstellung in Basel hatte, beantragte er nach einigen Jahren die Übernahme in den Pfarrdienst der württembergischen Kirche. Da er nicht an der Universität studiert hatte, musste er 1830 in Stuttgart eine theologische Dienstprüfung machen, die er mit bestem Ergebnis bestand. Danach wurde er als Vikar zum alten Pfarrer Christoph Friedrich Gerok nach Ofterdingen im Steinlachtal in der Nähe von Tübingen geschickt.
Der Kontakt nach Basel und die Liebe zur Mission dauerten an. Beim 1819 in Tübingen gegründeten Missionsverein wurde mit Freude vermerkt, dass Vaihinger in seiner Gemeinde eine Missionsstunde einführte und auch den Pfarrer Friedrich Mögling in Mössingen anregte, das gleiche zu tun. Dazu warb er auch Spenden für die Mission und beherbergte Zöglinge des Missionsseminars auf ihren Wanderungen von und nach Basel.
1832 wurde Vaihinger Pfarrverweser und ein Jahr später Pfarrer im nahen Grötzingen (bei Nürtingen). 1841 beteiligte er sich an der Gründung des „Medicinischen Missions-Instituts“ in Tübingen, dem Vorläufer des heutigen Deutschen Instituts für ärztliche Mission (DIFÄM). 1842 kam er zurück ins Steinlachtal und wurde Pfarrer in Nehren. Dort entfaltete er eine umfangreiche diakonische Tätigkeit: er gründete einen Armenverein als Träger einer Sparkasse und einer Leihanstalt. In den Hungerjahren 1847/48 richtete er eine Suppenküche ein und setzte sich bei staatlichen Stellen für eine bessere Armenhilfe ein. Daneben veröffentlichte er im Lauf der Jahre fünf Bände der dichterischen und poetischen Schriften des Alten Testament „metrisch übersetzt und erklärt“ – ein wissenschaftliches Meisterstück. Davon schickte er jeweils einige Exemplare nach Basel, um sie den künftigen Missionaren für ihren Dienst mitzugeben. Wenn er schon nicht selbst ausreisen konnte, so wollte er wenigstens die Brüder in ihrer Arbeit unterstützen.
Auch in den wissenschaftlichen Streit der Zeit griff er ein. 1835 hatte David Friedrich Strauß sein Buch „Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet“ veröffentlicht. Sofort reagierte Vaihinger mit einer Schrift „Über die Widersprüche, in welche sich die mythische Auffassung der Evangelien verwickelt: ein Sendschreiben an Herrn David Friedrich Strauß“ (1836).
Vaihinger war zweimal verheiratet. In Grötzingen vermählte er sich 1834 mit Henriette geb. Ficker, die in 15jähriger Ehe neun Kinder gebar. Nach deren Tod 1851 heiratete er Sophie geb. Haug. Von den wohl 15 Kindern aus diesen beiden Ehen Vaihingers starben viele bald nach der Geburt.
1862 wechselte er als Pfarrer nach Kochersteinsfeld. 1866 ging er in den Ruhestand und zog nach Cannstatt, wo er 1879 starb.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/vaihinger-johann-georg (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Vielhauer, Adolf
-
Von: Quack, Jürgen
Adolf Vielhauer (1888-1959 )
-
Adolf Vielhauer
Archiv der Basler Mission, QS-30_001_1210_01
Als Adolf Vielhauer 1906 nach Bali in der deutschen Kolonie Kamerun kam, gab es noch kein geschriebenes Wort in der Mungaka-Sprache, kein Wörterbuch und keine Grammatik. In den Dörfern des hochgelegenen „Graslandes“ wurden verschiedene Dialekte gesprochen. Die Erforschung der Sprache der Bali-Leute und die Übersetzung der Bibel wurde zur Lebensaufgabe von Adolf Vielhauer. Geboren 1880 in Eppingen in Baden, studierte er Theologie und meldete sich dann bei der Basler Mission. In Bali musste er selbst die Sprache lernen und herausfinden, in welchen Orten das „reinste“ Mungaka gesprochen wurde, um auf dieser Grundlage ein Wörterbuch und eine Grammatik anzufertigen – mit großen Schwierigkeiten, denn für manche Laute der Sprache gab es keine Buchstaben.
Auf dieser Grundlage begann er die Übersetzung biblischer Texte. Gleichzeitig galt es, Schulen zu gründen und Fibeln zu verfassen, damit die Menschen ihre Sprache lesen lernten. Das führte zu einem Konflikt mit der deutschen Kolonialregierung. Diese hätte es lieber gesehen, wenn die Kinder in den Missionsschulen Deutsch gelernt hätten. Die Mission aber wollte den Menschen das Evangelium in ihrer eigenen Sprache bringen.
-
Adolf Vielhauer in Kamerun (mit Hausburschen)
Archiv der Basler Mission, E-30.25.042
Nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurden die Missionare von den Engländern interniert. Gegen das Versprechen, nicht Soldat zu werden, durfte er im Oktober 1916 nach Deutschland zurückkehren. Dort setzte ihn die badische Landeskirche als Pfarrer ein. 1919 wurde er Evangelist des altpietistischen Gemeinschaftsverbandes in Württemberg. Nach einigen Jahren erlaubte die englische Regierung den vertriebenen Missionaren die Rückkehr. So kam Vielhauer mit seiner Frau im März 1926 wieder ins Land. Vielhauer war bei der Übersetzungsarbeit sehr auf die Mithilfe und die Vorschläge seiner einheimischen Mitarbeiter angewiesen. Er wollte mit seiner Übersetzung „den Erdgeruch des Graslandes vermitteln“. Die Leser sollten den Eindruck gewinnen, als ob Mose und Jesus in ihrer Mitte gelebt hätten. Daher suchten er und seine Mitarbeiter passende Ausdrücke und Bilder aus den Vorstellungen der Bali. An Christus zu glauben hieß: „seinen Kopf an Christus als Ehrengeschenk geben“.
Wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges konnte die Familie nach einem Heimaturlaub nicht zurück nach Kamerun. Vielhauer übernahm ein Pfarramt in Baden. Krankheitshalber wurde er 1947 in den Ruhestand versetzt, 1959 starb er in Karlsruhe.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/vielhauer-adolf (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Wurster, Simeon Friedrich
-
Von: Eisler, Jakob
Inhaltsverzeichnis
Simeon Friedrich Wurster (1756-1823)
Der Pfarrer und Bienenzüchter Simeon Friedrich Wurster, wurde als achtes Kind und jüngster Sohn des Pfarrers Christoph Friedrich (1719-1804) und seiner Gattin Maria Catharina geb. Rues (1716-1797) geboren. Seine Eltern hatten 1744 in Tübingen geheiratet, lebten anfangs in Mühlen am Neckar, zogen 1749 nach Grüntal, wo Simeon Friedrich geboren wurde, und 1761 weiter nach Wittendorf. Dort war der Vater bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1799 als Pfarrer tätig.
Simeon Friedrich wurde am 19. Dezember 1756 in Grüntal im damaligen Oberamt Freudenstadt im Schwarzwald geboren. Da er aus einer Pfarrerdynastie stammte, war seine Laufbahn schon fast vorbestimmt. Er nahm sein Theologiestudium an der Universität Tübingen am 10. Dezember 1773 auf und beendete es mit Erlangung der Magisterwürde im Oktober 1777. Sein Vater traute ihn 1780 in Wittendorf mit Heinrike Catharine geb. Wagner (*1763), die ihm im Laufe ihrer Ehe sechzehn Kinder schenkte.
1: Ein griechisches Wörterbuch
Zunächst war er von 1780 bis 1786 als Präzeptor in Münsingen tätig. Während dieser Zeit stellte er für den Schulgebrauch einen griechischen Wortschatz der vier Evangelien zusammen. Diese wissenschaftliche Arbeit wurde 1784 unter dem Titel: Vocabularium graecum in IV Evangelistas in usum scholarum veröffentlicht. Anschließend bekleidete er acht Jahre lang eine Präzeptorenstelle in Heidenheim an der Brenz. Seine erste Pfarrstelle trat er 1794 in Zainingen (heute ein Ortsteil der Gemeinde Römerstein Kreis Reutlingen) an, um ab 1802 bis zu seinem Tod über zwanzig Jahre als Pfarrer in Gönningen auf der Schwäbischen Alb zu wirken.
2: Vom Bienenkorb zum hölzernen Kasten
Schon früh setzte er sich mit landwirtschaftlichen Problemen auseinander. Sein besonderes Augenmerk galt der Bienenzucht. In seinem 1785 in Tübingen veröffentlichten Werk: Anleitung zu einer nützlichen und dauerhaften Bienenzucht bot er eine Anleitung – weg vom traditionellen, aus Stroh geflochtenen Bienenkorb hin zu einem hölzernen Bienenkasten, in den Waben eingehängt werden konnten. Umfassend beschreibt er Bienenstand, Bienenkönigin, Drohnen und im Schlusskapitel Honig- und Wachsernte. Der Band ist illustriert mit Abbildungen der von ihm entwickelten hölzernen Stöcke und Methoden der Honiggewinnung. Das Werk erfuhr schon wenige Jahre später eine überarbeitete Neuauflage. Wurster erwarb sich namhafte Verdienste zur Hebung der Landwirtschaft besonders in Württemberg, erlangte jedoch auch überregionale Bedeutung, so dass er 1802 zum Ehrenmitglied der Sächsischen Landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Leipzig ernannt wurde. In Württemberg zählte er nach den Napoleonischen Kriegen zu den Gründungsmitgliedern des „Landwirtschaftlichen Vereins“.
3: "Seiner Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus"
In seiner Gönninger Zeit veröffentlichte er sein letztes Werk: Von der Weisellosigkeit und die Rauber der Bienen. Im Familienregister Gönningen findet sich ein Nachtrag, der seine Bedeutung für die Bienenzucht würdigt: “Er war auf diesem Gebiet seiner Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus.“
Simeon Friedrich Wurster starb laut Totenregister am 9. Mai 1823 nach „2jähriger schmerzvoller Unterleibskrankheit“ in Gönningen. Seine Ehefrau wird dort als Witwe genannt. Ihr Sterbedatum ließ sich nicht ermitteln. Vermutlich verbrachte sie ihren Lebensabend bei einem ihrer Kinder.
4: Verbindung ins Heilige Land
Durch einen seiner Großneffen, Jakob Immanuel Wurster (1832-1874), fanden Wursters Erkenntnisse zur „moderne Bienenzucht“ Einzug ins Heilige Land. Der Großneffe war 1872 dorthin ausgewandert und betätigte sich als Weinbauer und Bienenzüchter. So wurden später in den württembergischen Landwirtschaftlichen Kolonien Haifa, Sarona und Wilhelma nach den beschriebenen Methoden Bienen gezüchtet und das Land konnte mit Recht den Titel tragen: Das Land in dem Milch und Honig fließt…
Aktualisiert am: 23.06.2025
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/wurster-simeon-friedrich (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.
Zimmermann, Johannes
-
Von: Quack, Jürgen
Johannes Zimmermann (1825 - 1876)
-
Johannes und Catherine Zimmermann
Foto: Mission 21, QS-30_002_0237_03
Johannes Zimmermann aus Gerlingen ist der erste Basler Missionar, der eine Afrikanerin heiratete: die geschiedene Catherine Mulgrave. Das Komitee in Basel war empört, als es 1851 von der Eheschließung an der Goldküste (heute Ghana) hörte, – nicht in erster Linie, weil er die allerseits anerkannte und geachtete Afrikanerin geheiratet hatte, sondern weil er das Komitee nicht vorher um Erlaubnis gefragt hatte. Als Strafe wurde ihm für einige Jahre der Heimaturlaub gestrichen. Das war kein größeres Problem für Zimmermann, denn durch die Verbindung mit Catherine Mulgrave wollte er „sich mit Afrika vermählen“ und den Afrikanern ein Afrikaner sein. Das ferne Württemberg interessierte ihn in diesem Zusammenhang weniger.
Catherine Mulgrave wurde um 1827 im heutigen Angola geboren und als achtjähriges Kind von portugiesischen Sklavenhändlern entführt und nach Amerika gebracht. Vor der Küste von Jamaica geriet das Schiff in Seenot und ging unter. Catherine wurde gerettet und vom englischen Gouverneur Mulgrave adoptiert. Von der Herrnhuter Brüdergemeine wurde sie zur Lehrerin ausgebildet.
1842 kam Andreas Riis nach Jamaica, um afrikanische befreite Sklaven als Mitarbeiter für die Basler Mission in Westafrika zu gewinnen. Er hoffte, dass diese das mörderische Klima besser aushalten könnten als die Europäer. In Begleitung von Riis war auch Georg Thompson gekommen, der erste Afrikaner, der in Basel zum Missionar ausgebildet worden war. Er verliebte sich in die damals 16-jährige Lehrerin und sie heirateten noch vor der Überfahrt zur Goldküste. Sie wirkte dort als Lehrerin und gründete die erste Mädchenschule Westafrikas. Doch die Ehe mit Thompson ging nicht gut und wurde wegen seiner Untreue und seinem Alkoholismus nach sechs Jahren geschieden.
-
Ein Gedenkstein mit ghanaischen Adinkra-Symbolen an der Petruskirche in Gerlingen erinnert an den Missionar
Foto: Quack
Als Catherine Mulgrave und Johannes Zimmermann sich begegneten war sie Rektorin der ersten Mädchenschule der Basler Mission in Afrika. Zwei Kinder brachte sie mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen sie noch sechs weitere. Die Beiden waren wie geschaffen füreinander: christlich motiviert, gebildet und doch bodenständig. Bernhard Schlegel aus Belsen besuchte die Familie Ende 1854 in Christiansborg (heute Accra) und berichte in einem Brief: „Zimmermann’s Familie ist eine nette Familie. Ein weißer Hausvater, eine schwarze Hausmutter (er hat nämlich eine getaufte Negerin geheirathet), zwei schwarze Kinder und ein gelbes. Das ist ein amüsierender Zirkel, insbesondere für einen Kinderfreund, dem es wohl ist, in einer Familie sitzen zu können.“
Mission bedeutete für Johannes Zimmermann Hilfe in allen Lebenslagen: Er modernisierte den Landbau, kümmerte sich um Schulbildung, Handwerk und die Förderung von Bodenschätzen. 1854 gegründete er die Siedlung Abokobi als christliches Musterprojekt, in dem für die Menschen ein würdiges, auskömmliches Leben möglich sein sollte. Später zog er zu dem Volk der Krobo, war dort gut eingebunden, so dass der dortige Stammesfürst seine Kinder zur Erziehung in die Mission gab. Zimmermann verschriftlichte die regionale Gâ-Sprache, verfasste Wörterbücher, eine Grammatik, eine Bibelübersetzung und ein Liederbuch.
Zweimal reiste Catherine mit ihrem Mann und ihren Kindern zum Heimaturlaub nach Gerlingen. Als er gezeichnet von Tropenkrankheiten dort 1876 starb, kehrte sie an die Goldküste zurück, wo sie noch 14 Jahre lebte und wirkte.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/zimmermann-johannes (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.