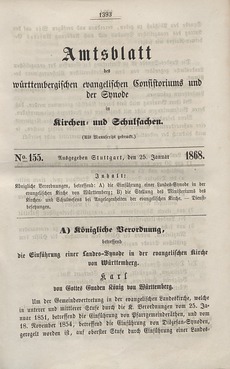Landessynode
-
Von: Hermle, Siegfried
Inhaltsverzeichnis
1: Fünf vergebliche Initiativen: 1818 bis 1861
-
Verordnung zur Einführung einer Landessynode durch König Karl 1868 im Amtsblatt des württembergischen Konsistoriums
Landeskirchliche Zentralbibliothek
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in der Württembergischen Landeskirche für die Gemeindeglieder keine Möglichkeit, Einfluss auf den Weg der Kirche zu nehmen. Die Kirchengewalt lag in der Hand des Landesherrn, der als Summepiskopus fungierte und die Kirchenleitung durch ein von ihm eingesetztes Konsistorium wahrnahm. Wichtige, den theologischen Bereich tangierende Entscheidungen wurden vom so genannten Synodus getroffen, einem Zusammentritt der Generalsuperintendenten mit dem Konsistorium – also nicht zu verwechseln mit einer Synode. Die letzte Entscheidung in allen kirchlichen Fragen lag jedoch in der Hand des Landesherrn. Mit der in Folge des Reichsdeputationshauptschlusses sich ergebenden territorialen Expansion Württembergs zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand die bis dahin gegebene konfessionelle Einheit des Landes ein Ende. Die Neuordnung des Landes sollte durch eine neu zu erarbeitende Verfassung vorangebracht werden. Hierzu wurde 1815 erstmals eine letztlich ergebnislos gebliebene Verfassungsversammlung einberufen. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgte auch der erste Vorstoß im Hinblick auf eine Verselbständigung der Kirche von der staatlichen Obhut.
Einen Impuls des Synodus vom 5. Juni 1818 nahmen die Prälaten Johann Christoph Schmied und Jacob Friedrich Abel auf. Sie legten der zur Beratung des Verfassungsentwurfes zusammengerufenen Ständeversammlung Anträge vor, in denen Wahlen zu einer Repräsentation auch für die Kirche gefordert wurden. (1)
In Schmieds Antrag hieß es ausdrücklich, dass das „Kirchen-Regiment der Evangelisch-Lutherischen Kirche“ künftig „durch den Synodus, das Consistorium und durch freygewählte Glieder der Gemeinden verwaltet“ werden solle. Die Ständeversammlung brachte zwar zum Ausdruck, dass sie diesen Vorschlag „als höchst vortheilhaft“ erachte, doch erklärte sie sich hierfür nicht zuständig. Immerhin war in dem Verfassungsentwurf davon die Rede, dass die inneren kirchlichen Angelegenheiten „der verfassungsmäßigen Autonomie einer jeden Kirchen überlassen“ bleiben sollten. Der Vorstoß jedoch wurde vom König Wilhelm I. persönlich beendet, er erklärte am 15. Januar 1824, dass für ihn eine Repräsentation der Kirchenglieder nicht in Frage komme.
Interessanterweise erfolgte 1833 eine zweite Initiative durch Mitglieder der Kammer der Abgeordneten. Gustav Scholl, Vertreter des Oberamts Aalen, begründete seinen Vorstoß damit, dass „die evangelische Kirche unter absoluter Meisterschaft des Ministeriums des Inneren“ stehe. (2) Es sollte daher eine aus zwölf Laien und zwölf Geistlichen bestehende Repräsentation der Kirche gebildet werden. Doch auch diese Initiative blieb ohne Erfolg, da die Ständeversammlung die Angelegenheit nicht weiter beriet.
So gingen die ersten Vorstöße, die interessanterweise einmal aus dem kirchlichen, das andere Mal aus dem politischen Bereich erfolgten, ins Leere. Dies hing einerseits damit zusammen, dass sich die Landtagsabgeordneten nach wie vor als Vertreter der kirchlichen Interessen verstanden und daher nicht einsahen, dass eine weitere Repräsentationsebene geschaffen werden sollte. Andererseits – und vornehmlich – lehnte der König die Übertragung der Idee der Volkssouveränität in den Bereich der Kirche entschieden ab und stellte sich daher gegen jedes gewählte kirchliche Repräsentativorgan.
Ein nächster, dritter Versuch erfolgte 1844. Vertreter verschiedener Diözesansynoden richteten eine Eingabe an den König und baten um Einsetzung einer Kommission zur Beratung über die Lage der Evangelischen Kirche. Der Synodus nahm dieses Anliegen auf und das Innenministerium genehmigte im Dezember 1844 tatsächlich ein solches Gremium. Doch obwohl ein im April 1845 erstattetes Gutachten das Recht der Kirche auf eine Repräsentation zustimmend aufnahm und auch die Ständeversammlung eine Autonomie der Kirche begrüßte, wies König Wilhelm dies zurück, er sah sich als absoluter Bischof seiner Kirche und lehnte jede Synode entschieden ab. Doch in diesem Fall war die Diskussion nicht so leicht abzubrechen wie zu Beginn des Jahrhunderts. Im Umfeld der Märzrevolution von 1848 wurde nach in der Öffentlichkeit lebhaft geführten Auseinandersetzungen erstmals ein 28 Paragraphen umfassender Entwurf einer Kirchenverfassung vorgelegt, die in drei Abschnitte – „Von den Gemeinde-Ältesten“, „Von den Diöcesansynoden“ und „Von der Landessynode“ – gegliedert war. (3) Vorgesehen war eine auf vier Jahre zu wählende Landessynode, der je 17 Geistliche und Laien sowie ein Vertreter der evangelisch-theologischen Fakultät in Tübingen gehören sollten. Der Entwurf wurde auch veröffentlicht und rief eine lebhafte Diskussion hervor. Doch trotz eines die Einrichtung einer Synode befürworteten Berichts, den das Innenministerium bereits 1846 dem König vorgelegt hatte, blieb die Angelegenheit zunächst unbearbeitet. Als jedoch der Geheime Rat der Einführung entsprechender Gremien zumindest auf der Gemeindeebene zustimmte und nach zahlreichen Petitionen von Kirchenbezirken wurde die Erlaubnis erteilt, die Angelegenheit gewissermaßen offiziell zu beraten. Das Konsistorium setzte ein Gremium zur weiteren Vorbereitung einer Verfassung ein, das in insgesamt 17 Sitzungen im November 1848 einen letztlich völlig neuen Verfassungsentwurf hervorbrachte. (4) Einer Synode waren sechs Wirkungskreise zugeordnet: Sie sollte für die Wahrnehmung und Pflege des christlichen Lebens, die gottesdienstlichen Übungen, die Sittenzucht, die religiöse Erziehung und die Armenfürsorge zuständig sein sowie vom Oberkirchenrat Berichte über dessen Tätigkeit empfangen können. Auch die Gesetzgebungen in allen kirchlichen Angelegenheiten war für sie vorgesehen, ebenso die Aufsicht über die Amtsführung des Oberkirchenrats und sämtlicher kirchlicher Beamten und Behörden; zudem hatte sie den Haushaltsplan der Kirche festzustellen, sie sollte eine Entscheidungsbefugnis über Beschwerden und Berufungen erhalten und an der Beschickung einer Deutschen Evangelischen Reichssynode mitwirken. Diese Verfassung, die Prämissen des politischen Liberalismus aufnahm, wurde jedoch nach dem Zusammenbruch der Revolution nicht weiter verfolgt. Jede Änderung rückte, dies zeigte sich in Württemberg insbesondere daran, dass wieder ein sehr konservatives Ministerium eingesetzt wurde, in dem auch der jeder Änderung der Kirchenverfassung abholde Johannes Schleyer vertreten war.
Erst zehn Jahre später, 1858 gab es einen – vierten – Vorstoß des evangelischen Synodus an das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens und auch in der kirchlichen Öffentlichkeit – vornehmlich im „Kirchen- und Schulblatt zunächst für Württemberg“ – wurde ausführlich über die Einrichtung einer Synode diskutiert. Impulsgebend für die erneute Diskussion war ein Konkordat, das der Staat Württemberg 1857 mit dem Vatikan geschlossen hatte und das der Römisch-Katholischen Kirche weitgehende Zugeständnisse machte. Gefordert wurde nun, auch der evangelischen Kirche mehr Freiheiten einzuräumen. Vornehmlich wurde in diesem Zusammenhang neben der Absonderung der Verwaltung des evangelischen Kirchengutes auch die Einführung einer Landessynode geltend gemacht und damit die Scheidung der inneren Angelegenheiten der Kirche von der Staatsverwaltung. Diese vierte Initiative für die Einrichtung einer Vertretung der Kirchenmitglieder führte zu einem Verfassungsentwurf des Synodus, der jedoch jeden Anklang an demokratische Prinzipien konsequent vermied. (5) Ziel war es, die kirchlichen Behörden aus der Staatsverwaltung herauszulösen und für die Kirche eine verwaltungsmäßige Autonomie zu bewerkstelligen. Zwar war eine Landessynode vorgesehen, doch diese war als Organ der verschiedenen, in der Kirche agierenden Stände gedacht, so sollte die Theologische Fakultät, die Seminare, die Dekane, Vertreter der Geistlichen aber auch Laien in diesem Gremium mitwirken. An Kompetenzen waren lediglich zwei Bereiche vorgesehen: Der Zustand der Landeskirche sollte beraten werden und im Blick auf die kirchliche Gesetzgebung – insbesondere in Sachen der Lehre, des Kultus und der Disziplin – sollten die Vertreter mitwirken können. Alle Beschlüsse der Synode sollten noch der landesherrlichen Sanktionierung bedürfen. Doch wieder führten die Diskussionen nicht weiter, da seitens des Konsistoriums Vorbehalte gegen eine Synode geäußert wurden: Die Sache sei noch nicht „in das Stadium der Spruchreife getreten“. (6)
1861 richteten vier Pfarrer eine Eingabe an die Kammer der Abgeordneten, in der sie die Wünsche weiter Kreise der Kirche zum Ausdruck brachte, auch in der Württembergischen Landeskirche eine „Zuziehung des Gemeindeelements“ im Blick auf den Weg der Kirche zu ermöglichen. (7) Doch obwohl die Kammer diesen Vorstoß der Staatsregierung „zur Erwägung“ mitteilte, wurde diese Angelegenheit nicht weiter verfolgt – noch stand König Wilhelm jedem Vorstoß in dieser Sache entgegen. Nachdem er freilich am 25. Juni 1864 verstorben war, kam unter seinem liberaler gesonnenen Nachfolger Karl wieder Bewegung in die Diskussion.
2: Die Synodalordnung von 1867
Eine in Cannstatt am 21. Juni 1865 durch geführte Pfarrerversammlung gab die entscheidenden Impulse, dass die Frage nach einer Landessynode erneut – und diesmal mit großer Dringlichkeit – diskutiert wurde. Schon Anfang dieses Jahres hatte es in einem Artikel des „Evangelischen Kirchen- und Schulblattes zunächst für Württemberg“ geheißen, dass jetzt die Zeit sei, mit der Losung Landessynode „von Seiten aller Pfarrgemeindenräthe, Kirchenconvente und Diöcesansynoden hervorzutreten.“ (8) Der Impuls wurde von der Stuttgarter Diözesansynode am 30. August 1865 aufgenommen, die einen Vortrag von Karl August Leibrand über die Kirchenverfassung zum Anlass nahm, nachdrücklich eine solche zu fordern. Ein eingesetztes Komitee richtete eine Eingabe an König Karl. Bei einem Empfang am 3. Dezember sicherte König Karl zu, dass er „in eine der nächstbevorstehenden Sitzungen des Ministerraths Sich Vorlagen wegen Einführung einer Landessynode werde machen lassen“. (9) Intensiv diskutierten im Folgeneden die verschiedensten Kreise in der Landesskirche über Aufgaben und Zusammensetzung einer Landessynode. Als der König schließlich am 17. Januar 1866 das Ministerium ermächtigte, dem Synodus den Auftrag zu geben, die Sache weiter zu beraten, war eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen.
Der Entwurf einer vom Synodus erarbeiteten Synodalordnung sah vor, dass diese aus 50 durch die Diözesansynoden zu wählende Personen – 25 Geistlichen und 25 Laien –, den sechs Generalsuperintendenten, einem Vertreter der evangelisch-theologischen Fakultät sowie fünf vom König zu ernennenden Mitgliedern zusammengesetzt sein sollte. Vorgesehen war, dass die Initiative bei kirchlichen Gesetzen weiterhin allein dem Kirchenregiment zukommt; die ausgearbeiteten Entwürfe mussten dann jedoch von der Landessynode beraten werden. Erst nach deren Zustimmung konnte der Landesherr die Gesetze sanktionieren und verkündigen. Dieser Entwurf, der im Juli 1866 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, fand eine rege Aufnahme in der kirchlichen Öffentlichkeit und mündete schließlich in einer von König Karl am 20. Dezember 1867 unterzeichneten Verordnung „Betreffend die Einführung einer Landessynode in der Evangelischen Kirche von Württemberg“. (10)Die hier getroffenen Bestimmungen entsprachen weitgehend dem Entwurf, freilich war dem Landesherren das Recht eingeräumt, sechs Personen in die Synode zu entsenden und zudem festgehalten, dass ein aus fünf Personen zusammengesetztes Präsidium der Synode jährlich tagen sollte, um beispielsweise Wünsche und Beschwerden an das Kirchenregiment zu richten, Kenntnis vom Stand der Rechnung zu nehmen oder auch die Einberufung der Synode zu beantragen. Angelegt war diese Landessynode deutlich als ein Beratungsgremium, dem nicht viele Kompetenzen zukamen. Seine Beratungsgegenstände sollten ihm durch das Konsistorium überwiesen werden.
Da der für die Verordnung entscheidende Kultminister der Ansicht war, dass ausschließlich der Landesherr Inhaber der Kirchengewalt sei, konnte die Synode lediglich als Kontrollgremium der landesherrlichen Organe dienen, nicht aber als letztentscheidendes Gremium. Wie wenig Gewicht die Landessynode hatte, zeigt sich auch daran, dass sie lediglich alle vier Jahre einberufen werden sollte.
Nach der Wahl der Abgeordneten im Herbst 1868 wurde die Synode zu ihrer ersten Sitzung auf den 28. Februar 1869 nach Stuttgart einberufen. (11) Allerdings hatte sie keine wirkliche Tagesordnung, da ihr nur Gegenstände untergeordneter Bedeutung von der Kirchenbehörde vorgelegt worden waren. Zudem war bei der ersten Sitzung der Tisch des Konsistoriums wegen einer gleichzeitig stattfindenden Sitzung dieser Behörde überhaupt nicht besetzt.
Aufgrund der geringen Zuständigkeit der Synode kam es nur in sehr großen Zeitabständen zu Sitzungen, so lagen „zwischen dem Zusammentritt der zweiten und der dritten Synode nicht weniger als 12 Jahre!“. (12) Da die Landessynode keine Möglichkeit hatte, direkt in die Leitung der Kirche einzugreifen – und dies zwischen 1889 und 1919 auch nie für sich in Anspruch nahm – und da sie sich auch nicht als Gegengewicht zum Kirchenregiment sehen wollte, entwickelte sie für sich einen ganz eigenen Weg: Sie verstand sich als maßgebliches Forum der Landeskirche, wo die verschiedenen in der Landeskirche präsenten Richtungen gemeinsam interessierende Fragen in offener Form miteinander besprachen.
Angesichts der gegebenen Situation äußerte bereits die 2. Synode 1874 den Wunsch, ihre Position und ihre Aufgaben signifikant zu verändern. Doch erst 1888 wurde der erste Paragraph der Synodalordnung verändert. Er lautete nun: „Die Landessynode bildet die Vertretung der Gesamtheit der Kirchengemeinden.“ (13) Diese Vertretung sollte, so hieß es im Kommissionsbericht, der der Entscheidung zugrunde lag, „zur Gemeinschaft der Arbeit mit dem Kirchenregiment berufen und nicht wie ein politischer Vertretungskörper dem Kirchenregiment gegenüber gestellt“ sein. Die neue Synodalordnung brachte noch eine Reihe weiterer Verbesserungen mit sich, so hatte die Synode nunmehr selbst das Recht, Kirchengesetze einzubringen und sie konnte ihren Präsidenten und Vizepräsidenten aus ihrer Mitte bestimmen und nicht wie bislang lediglich einen Vorschlag unterbreiten, der dann vom König aufgenommen, aber eben auch zurückgewiesen werden konnte. Ihre Legislaturperiode war auf sechs Jahre ausgeweitet.
Doch trotz dieser Veränderungen tagte die Synode weiterhin äußerst selten. So kam es zwischen 1888 und 1918 zu insgesamt lediglich sechs Synodaltagungen – diese freilich dauerten teilweise mehrere Monate. (14)
Obwohl die Synode formal weitgehend bedeutungslos war, wurde sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen: Sie bot das Forum für eine Reihe von Fragen, die Ende des 19. Jahrhunderts die Württembergische Landeskirche bewegten. Beispielhaft sei die Auseinandersetzung um den Pfarrer Christoph Schrempf genannt. Er hatte sich geweigert, bei der Taufe das Apostolikum zu sprechen. Als er daher im Mai 1892 entlassen wurde, bat eine Reihe von Pfarrern das Konsistorium „um Erleichterung des Bekenntniszwanges“. (15) Neben einer inhaltlich vergleichbaren Petition, die von 11.544 Laien unterzeichnet und an den König gerichtet war, erfolgte auch eine Eingabe an die Landessynode: Sie möge die Formel für die Amtsverpflichtung revidieren, die religiösen Lehrbücher für die Jugendunterweisung überarbeiten und auch die bestehenden gottesdienstlichen Agenden einer Prüfung unterziehen. Den vorgegebenen Agenden sollten freiere Parallelformulierungen beigegeben werden. Die beiden in der Synode präsenten Gruppierungen, die konservativ-biblizistisch orientierte sogenannte positive Strömung wie der ihr gegenüberstehende liberale Flügel, nutzten die Aussprachen in der Synode, um ihre jeweiligen Positionen deutlich zu machen. Im Zusammenhang dieser Debatte erwies sich die Synode als wichtiges Forum der Landeskirche, wenngleich sie letztlich auf die konkreten Entscheidungen der Kirchenbehörde wenig Einfluss nehmen konnte.
Hinzuweisen ist noch darauf, dass die Synode auch im Blick auf den zu erwartenden Konfessionswechsel im Haus Württemberg – es war absehbar, dass der Nachfolger des seit 1891 regierenden König Wilhelm II. der aus dem katholischen Zweig des Hauses stammende Albrecht werden würde – maßgeblich daran mitwirkte, gesetzliche Regelungen zu schaffen, dass ein problemloser Übergang würde vonstatten gehen können. Bei den umfangreichen Debatten wurde deutlich, dass die Synode selbst in dieser Situation für sich keinen Anspruch auf kirchenleitende Funktion erhob. Diese sollte auch nach dem Übergang des Kirchenregiments auf einen katholischen Regenten ausschließlich dem königlichen Konsistorium und der dann eingesetzten Kirchenregierung zukommen.
Zwischen den Sitzungen der Synode tagte im Übrigen ein Ausschuss, der mindestens einmal jährlich zusammengerufen wurde und der das Recht hatte, dem Kirchenregiment Wünsche und Beschwerden vorzutragen oder auch den Zusammentritt der Synode zu einer außerordentlichen Sitzung zu beantragen.
3: Die Kirchenverfassung vom 20. Juni 1920 und die neue Rolle der Synode
Die 1912 gewählte 8. Württembergische Landessynode versammelte sich vor und während des 1. Weltkrieges nur einmal. Da die Wahlperiode 1918 ausgelaufen wäre, wurde diese durch ein vorläufiges Kirchengesetz vom November 1918 verlängert, „jedoch nicht über ein Jahr nach dem endgültigen Friedensschluß hinaus“. (16) Konsistorialpräsident Hermann Zeller gelang es, König Wilhelm II. am 9. November, dem Tag seines Rückzuges nach Bebenhausen, zu veranlassen, ein Gesetz zu sanktionieren, das der Landeskirche Rechtssicherheit gab auch für den Fall, dass die Monarchie ein Ende finden sollte. Eine aus dem Präsidenten des Konsistoriums und zwei evangelischen Ministern bestehende Kirchenregierung sollte die Kirchenregimentsrechte übernehmen, falls der Monarch diese nicht mehr ausüben konnte.
Nach dem Rücktritt des Königs am 30. November mussten die Verhältnisse in der Landeskirche neu geregelt werden. Der Landesherr war als Summepiskopus bisher „alleiniger Inhaber und Träger der Kirchengewalt“. (17) Diese Rechte mussten nun anderweitig verankert werden. Beratungen im Konsistorium zielten darauf ab, möglichst wenige Mitspracherechte auf die Landessynode zu übertragen und dieser nur jene Funktionen zukommen zu lassen, die ihr angesichts der veränderten Lage unabdingbar zukommen mussten. So wurde im Entwurf einer neuen Kirchenverfassung festgehalten, dass einem Kirchenpräsidenten eine sehr starke Stellung eingeräumt wurde. Ein Oberkirchenrat wurde als das eigentlich kirchenleitende Organ konzipiert, während einem Landeskirchentag das Gesetzgebungsrecht und die Hoheit über den Haushalt der Landeskirche zukommen sollten.
Einig war man sich, dass die neue Kirchenverfassung nicht mehr von der noch 1912 gewählten Landessynode beraten werden konnte. Bei einer letzten Sitzung beschloss diese am 20. Januar 1919 ein Gesetz zur Wahl einer verfassungsgebenden Landeskirchenversammlung. Diese sollte sich aus 55 weltlichen und 26 geistlichen Abgeordneten zusammensetzen; vorgesehen wurde erstmals auch das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. Folgewirksam wurde zudem, dass die unmittelbare Wahl des Landeskirchentags durch die Kirchenglieder vorgesehen wurde. Die Beteiligung an den am 1. Juni 1919 durchgeführten Wahlen lag bei immerhin 40 bis 45%.
Schnell wurde deutlich, dass in der Versammlung zwei Gruppen mit deutlichen theologischen Unterschieden vorhanden waren: Einerseits die aus pietistischen Gemeinschaften stammenden eher konservativen Mitglieder – sie sammelten sich in der Gruppe 1 unter dem Stuttgarter Prälaten und Stiftsprediger Christian Römer – und die liberal gesonnenen, die die Gruppe 2 bildeten; ihr Sprechen war der Reutlinger Prälat Jakob Schoell. Bewusst verzichtete man darauf, die Gruppen mit Namen zu versehen.
Diese verfassungsgebende Landeskirchenversammlung hatte als wichtigste Aufgabe die Erarbeitung einer neuen Kirchenverfassung. Diese wurde am 24. Juni 1920 verkündet und sah an der Spitze der Kirche einen Kirchenpräsidenten vor, der gemeinsam mit dem Oberkirchenrat die Leitung der Kirche übernahm. Ein Landeskirchentag – der Name war programmatisch gewählt und sollte dem demokratischen Geist der Zeit Ausdruck verleihen – genanntes Gremium sollte sich aus 60 Abgeordneten, 40 weltlichen Abgeordneten und 20 Geistlichen zusammensetzen, die durch allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahlen gewählt werden sollten. Zudem sollte die Evangelisch-Theologische Fakultät in Tübingen ein Mitglied entsenden. Nach der neuen Verfassung sollte der Landeskirchentag „die Gesamtheit der evangelischen Kirchengenossen“ vertreten (18); als wichtigstes Recht kam ihm das Gesetzgebungsrecht zu und er hatte den landeskirchlichen Haushaltsplan festzustellen, die Rechnungen zu prüfen und den Stand des landeskirchlichen Vermögens zu verwalten. Zudem hatte er die Möglichkeit, Anträge, Wünsche und Beschwerden an die Kirchenleitung zu richten sowie Auskunft und Akteneinsicht zu verlangen. Wichtige Entscheidungen, beispielsweise über exponierte Stellen, waren einem nichtöffentlich tagenden dreiköpfigen Ausschuss vorbehalten, der deutlich in Kontinuität zur Kirchenregierung stand. Die Gesetzgebungsinitiative sollte nun sowohl von der Kirchenleitung als auch vom Landeskirchentag ausgehen können. Landeskirchentag und Oberkirchenrat sollten gemeinsam den Kirchenpräsidenten wählen.
Für die Wahl des Landeskirchentages galt – mit Ausnahme des Bezirkes Stuttgart – das Mehrheitsprinzip.
Die Wahl zum 1. Landeskirchentag fand am 25. Februar 1925 statt und die erste Einberufung erfolgte am 12. März 1925. Es bildeten sich wiederum zwei Gruppen, die weiterhin ohne Namen blieben. Die Nachteile des Mehrheitswahlrechtes zeigten sich insbesondere bei der Wahl zum 2. Landeskirchentag: Am 8. März 1931 erreichten die Religiösen Sozialisten zwar landesweit ungefähr 12% der Stimmen, doch bekamen sie keinen Sitz, da ihre Kandidaten in keinem der Wahlkreise die höchste Stimmenzahl erreichten. Dieser 2. Landeskirchentag versammelte sich lediglich zwei Mal, im März 1931 und im April 1932, da die Ereignisse des Jahres 1933 auch gravierende Folgen für den Landeskirchentag hatten.
4: Der Landeskirchentag in der Zeit des Nationalsozialismus
Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 strebten die Nationalsozialisten eine Gleichschaltung aller Gewerkschaften, Verbände, Vereine und eben auch der Kirchen an. Ein entscheidender Schritt hierfür war die Bildung einer dem Nationalsozialismus nahe stehenden Kirchenpartei: Die Glaubensbewegung Deutsche Christen, die sich 1933 auch in Württemberg konstituierte, drängte auf die Zusammenfassung der 28 Landeskirchen in eine Reichskirche. Vertreter der Landeskirchen erarbeiteten daraufhin die Verfassung einer Deutschen Evangelischen Kirche, die durch Reichsgesetz am 14. Juli 1933 bestätigt wurde. Gleichzeitig ordnete die Reichsregierung – ohne dafür berechtigt zu sein – Neuwahlen für alle kirchlichen Organe an, „die nach geltendem Landeskirchenrecht durch unmittelbare Wahlen der kirchlichen Gemeindeglieder gebildet werden.“ (19) Allerdings schien es in Württemberg – wie im Übrigen auch in anderen Landeskirchen – nicht opportun zu sein, Wahlen durchzuführen, galten diese doch als Ausdruck eines überlebten Parlamentarismus. Unter Federführung von Landesbischof Theophil Wurm – er führte diesen Titel seit Anfang Juli – verständigten sich die bislang im Landeskirchentag vertretenen Gruppierungen mit den Deutschen Christen auf eine Verteilung der Mandate. Am 18. Juli kam man überein, dass die Deutschen Christen künftig 32 der 61 Sitze erhalten sollten, Gruppe 1 sollte 21 und Gruppe 2 sieben Abgeordnete stellen. In einer Erklärung, die auch von Wurm unterzeichnet war, wurde zum Ausdruck gebracht, dass man einen „Riss durch unser evangelisches Volk“ vermeiden wolle, daher werde es keinen Wahlkampf geben. (20) Damit kam der 3. Württembergische Landeskirchentag ohne Beteiligung der Kirchenglieder allein durch Absprache der Gruppierungen zustande.
Die Deutschen Christen forderten umgehend, dass ihr Einfluss in der Landeskirche zum Tragen kommen müsse. So verlangten sie, den Oberkirchenrat entsprechend der Zusammensetzung des Landeskirchentags umzubilden, im Blick auf den Landeskirchentag beanspruchten sie den Posten des Präsidenten, des Vertreters der Württembergischen Kirche in der Nationalsynode, den dritten Platz im für sämtliche Personalentscheidungen in der Landeskirche so wichtigen Landeskirchenausschuss und nicht zuletzt die Mehrheit in allen Ausschüssen des Landeskirchentags.
Die erste Sitzung fand am 12. September 1933 statt, nachdem am Abend zuvor Landesbischof Wurm einen feierlichen Eröffnungsgottesdienst durchgeführt hatte. Bereits bei dieser Sitzung kam es zu einer scharfen Konfrontation zwischen den Gruppierungen, als man sich nicht auf die Zuwahl weiterer Abgeordneter einigen konnte. Da die Deutschen Christen nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit hatten, konnten die beiden anderen Gruppierungen die seitens der Deutschen Christen Vorgeschlagenen blockieren. Am 2. Sitzungstag wurde ein Ermächtigungsgesetz für den Kirchenpräsidenten verabschiedet, er sollte die Möglichkeit haben, Gesetze letztlich ohne Zustimmung des Landeskirchentags zu erlassen und auch weitere Entscheidungen eigenmächtig zu vollziehen. Nicht überraschend war, dass die Deutschen Christen darum baten, dass dem Landeskirchentag ein Gesetz vorgelegt werden möge, das eine „sinnvolle Verwendung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auf die kirchliche Verwaltung“ beinhalten sollte. (21) Damit war nichts weniger intendiert, als der Ausschluss sämtlicher Kirchenbeamter und Pfarrer, die aus dem Judentum stammten. Allerdings wurde diese Initiative später nicht weiter verfolgt. Hinzuweisen ist noch darauf, dass sich auch die beiden anderen Gruppierungen nun Namen gaben. So formierte die Gruppe 2 im Folgenden als „Volkskirchliche Vereinigung“ und die Gruppe 1 als „Evangelisch-kirchliche Arbeitsgemeinschaft“. Letztere hatte sich im Übrigen in einem Antrag dafür eingesetzt, „Maßnahmen zur ‚Schaffung lebendiger Gemeinden‘“ zu treffen, während die Deutschen Christen forderten, dass sich die Kirche den Hunderttausenden gegenüber öffnen müsse, die in der nationalsozialistischen Bewegung sich danach sehnten, in der Kirche Heimat zu finden. (22)
Dem Triumph der Deutschen Christen folgte freilich bald Ernüchterung: In Berlin hatte in einer großen Kundgebung der Deutschen Christen der dortige Gau-Obmann Reinhold Krause gefordert, im Rahmen einer Fortführung der Reformation das Alte Testament aus der Kirche zu beseitigen und grundsätzlich „auf die ganze Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus“ zu verzichten. (23) Dies führte zu entschiedenen Protesten seitens zahlloser Personen, die sich den Deutschen Christen mit der Hoffnung angeschlossen hatten, dass durch diese Gruppe ein Aufschwung der Kirche, ein Hineinwirken in das Volk möglich würde. Im Übrigen setzte ab Herbst 1933 auch eine zunehmende Distanzierung des nationalsozialistischen Staates von der Kirche ein.
Für den Württembergischen Landeskirchentag war dies insoweit folgewirksam, als dass nicht wenige Mitglieder der deutschchristlichen Gruppe des Landeskirchentags, die primär wegen ihrer nationalsozialistischen Gesinnung nominiert worden waren, zurücktraten. Zudem spalteten sich die württembergischen Deutschen Christen und es bildete sich eine Gruppe um Wilhelm Pressel und Gotthilf Weber, die loyal zum Landesbischof stand.
Im Zusammenhang der Beratungen des Haushaltsplanes ergaben sich im Ständigen Ausschuss des Landeskirchentages im März 1934 massive Differenzen zwischen Wurm und der in diesem Gremium noch vorhandenen deutschchristlichen Mehrheit. Als Wurm versuchte, die Blockadepolitik des Ausschusses durch eine Einberufung des Landeskirchentages aufzulösen, eskalierten die Auseinandersetzungen. Der Präsident des Landeskirchentags, der Deutsche Christ Karl Steger, suchte Verbindung mit Reichsbischof Ludwig Müller, der daraufhin am 13. April an Wurm telegrafierte, dass am Sonntag, den 15. April, der Ständige Ausschuss unter seiner Anwesenheit zusammentreten solle. Gleichzeitig wurde jedoch bereits über den Rundfunk verbreitet, der Landessynodalausschuss habe „dem Landesbischof Wurm das Vertrauen versagt“. (24) Die Sitzung am 15. brachte eine unerwartete Eskalation: Der Reichsbischof ordnete an, dass eine Einberufung des Landeskirchentags nur mit seiner Zustimmung möglich sei. Zwar protestierten Vertreter der Gruppen 1 und 2 gegen diese Verfügung, doch vermochten sie keine Veränderung zu erreichen.
Gleichzeitig ging der Reichsbischof entschlossen daran, die Landeskirchen in die Reichskirche einzugliedern. Laut einer Verordnung sollte die Württembergische Landeskirche am 3. September 1934 eingegliedert werden. Um die Widerstände im Land zu brechen, wurde Wurm wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten am 14. September beurlaubt und der Ebinger Pfarrer Eberhard Krauß zum Geistlichen Kommissar der Landeskirche eingesetzt. Bereits am 28. September erließ der Reichsbischof ein Gesetz, das die Zusammensetzung des Landeskirchentags völlig veränderte. Eine neu einzurichtende Landessynode sollte nur noch aus 18 Mitgliedern, dem Landesbischof und einem Vertreter der Tübinger Fakultät bestehen. Zwölf der 18 Mitglieder sollte der Landesbischof aufgrund des Verhältnisses der Wahlen vom Juli 1933 berufen; sechs Personen konnte er nach freiem Ermessen benennen. Da sich die Gruppe 1 weigerte, eine Person aus ihren Reihen zu benennen und für die Gruppe 1 lediglich ein Abgeordneter zur Mitarbeit in der neuen Synode bereit war, waren die restlichen 17 Personen Mitglieder der Deutschen Christen. Diese oktroyierte Synode – von Klaus Scholder als „Räubersynode“ bezeichnet (25) – tagte lediglich ein Mal, am 9. Oktober 1934, und sollte vor allem die Abberufung und Zurruhesetzung von Landesbischof Wurm beschließen. Ein entsprechender Antrag wurde bei einer Nein-Stimme angenommen.
Allerdings wurde dieser Beschluss hinfällig, als Wurm – ebenso wie der zwangsweise zur Ruhe gesetzte bayerische Landesbischof Hans Meiser – durch einen Empfang bei Reichskanzler Hitler staatliche Anerkennung fand und damit wieder sein Amt übernehmen konnte.
Als sich abzeichnete, dass der 1933 gebildete Landeskirchentag nicht mehr würde arbeiten können und die von Müller angeordnete Landessynode ihre Legitimation verloren hatte, entschloss sich Wurm, anstelle des Landeskirchentags einen Beirat der Kirchenleitung einzurichten. Dem Beirat sollten 20 weltliche und 20 geistliche Mitglieder angehören, die über die Dekanatämter entsandt werden sollten. Im einschlägigen Erlass war ausgeführt, dass es sich bei diesem Beirat „lediglich um einen freien Zusammentritt zu Beratungen“ handeln solle. (26)
Der Beirat versammelte sich vom 4. Oktober 1936 bis 19. Oktober 1934 viermal; ein aus diesem Gremium heraus gebildeter Ausschuss, der insgesamt 14 Personen umfasste, diente der kontinuierlichen Begleitung der Kirchenleitung und traf sich bis zum 26. Januar 1940 insgesamt 18mal. Durch Beirat wie Ausschuss gelang es Wurm, Austausch mit Vertretern der Kirchenglieder zu pflegen. Er schuf damit für Württemberg eine – freilich von oben her installierte – Bekenntnissynode.
Die Wahlperiode des 1933 gewählten 3. Landeskirchentages endete nach einer sechsjährigen Amtsperiode 1939. Eine Neuwahl war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr möglich. Wurm berief daher den Rumpf-Landeskirchentag auf den 13. Juli 1939 – er zählte zu diesem Zeitpunkt nur noch 41 Mitglieder – zu einer Sitzung ein. Bei dieser verlängerte der Landeskirchentag die Wahlperiode bis auf weiteres und sanktionierte zudem alle Gesetze, die bis dahin vom Ständigen Ausschuss beschlossen worden waren. Geplant war, durch die Zuwahl neuer Mitglieder den Landeskirchentag wieder arbeitsfähig zu machen. Allerdings war hierüber zunächst mit dem Kultministerium Einvernehmen herzustellen. Bei einer weiteren Sitzung des Landeskirchentages am 13. Dezember 1939 wurden schließlich Zuwahlen vorgenommen und auch der Landeskirchenausschuss ergänzt. Die rechtliche Sicherung war damit zwar gewährleistet, doch das in Württemberg übliche Prinzip der Urwahl war zugunsten von Zuwahlen aufgegeben.
Weitere Sitzungen fanden am 27. Februar 1940, am 2. September 1941 sowie am 13. Juli 1943 statt. Auf diesen Sitzungen informierte der Landesbischof jeweils über die Lage der Landeskirche, weitere Abgeordnete wurden zugewählt und auch Resolutionen wie beispielsweise gegen die Beschlagnahmung der Seminare Maulbronn, Blaubeuren, Schöntal und Urach sowie die Kürzung der Staatsleistungen verabschiedet. Auf der letzten Sitzung legte der Landeskirchentag Protest gegen eine Entscheidung des Reichsfinanzhofes ein, das die Besteuerung der Württembergischen Bibelanstalt wegen des Drucks des Alten Testamentes verändert hatte.
Angesichts der Lage der Dinge war der Landeskirchentag ab 1939 weniger ein Organ zur Kontrolle der Kirchenleitung unter Landesbischof Wurm, sondern ein Organ, das mit dazu diente, die zunehmend schwierige Position der Landeskirche zu stabilisieren und durch entsprechende Verlautbarungen Protest gegen Maßnahmen des NS-Staates laut werden zu lassen. Auch in dieser Phase blieb der deutschchristliche Präsident des Landeskirchentages im Amt und auch einige Sitze im Landeskirchenausschuss sowie im ständigen Ausschuss blieben von Deutschen Christen besetzt. Deren Position war freilich zwischenzeitlich so schwach, dass sie ihre divergierenden Ansichten im Blick auf den Weg der Kirche nicht mehr geltend machen konnten.
5: Vom Landeskirchentag zur Landessynode
Nach Kriegsende versammelte sich der 3. Landeskirchentag letztmalig am 27. Juni 1946, um baldige Neuwahlen vorzubereiten. Erlassen wurde eine Wahlordnung, die im Wesentlichen die Bestimmungen der 1929 erlassenen Ordnung wieder aufnahm. Neben der Möglichkeit, mittels einer Wählerliste Personen auch von der Wahl auszuschließen, wurde festgelegt, dass für jeden Abgeordneten zwei Ersatzmitglieder zu wählen seien. Die erste Wahl nach dem Krieg fand am 16. November 1947 statt; zu seiner ersten Sitzung kam der 4. Landeskirchentag am 19. Januar 1948 zusammen.
Programmatisch verzichteten die Mitglieder der 4. Landessynode auf die Bildung von Gruppierungen. Man wollte gemeinsam die Aufgaben angehen. Thematisch bestimmt wurden die ersten Landeskirchentage nach Kriegsende zum einen durch den Streit um die Theologinnenordnung und zum anderen durch Frage nach der Relevanz der Theologie Bultmanns und der von ihr ausgehenden Impulse für eine zeitgemäße Interpretation des Neuen Testamentes. Im Blick auf die Frauenordination kam es zu einer engagierten Debatte, in der pietistisch-konservative Abgeordnete ihre Vorbehalte deutlich machten, während Kirchenleitung und liberalere Abgeordnete deutlich herausstellten, dass der Dienst der Theologin innerhalb klar zu benennender Grenzen möglich gemacht werden müsse. Die Kritik an der Entmythologisierung wurde seitens der konservativen Kreise – unterstützt durch den seit 1948 amtierenden Landesbischof Martin Haug – in der Synode wiederholt zum Thema gemacht, doch vermochte man sich in dieser Frage nicht auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen.
Im Zusammenhang dieser kontroversen Debatten entstand eine „Evangelisch-Kirchliche Arbeitsgemeinschaft für Biblisches Christentum“, die ab 1956 in jährlichen – später Ludwig-Hofacker-Konferenz genannten – Versammlungen ihre Position deutlich machte und die Sammlung von Personen vorantrieb, die dem Weg der „modernen Theologie“ mit Skepsis begegneten.
Eher beiläufig beschloss der 6. Landeskirchentag am 15. April 1964 wieder die Bezeichnung Landessynode anzunehmen – vor allem sollte dadurch eine Verwechslung mit den Deutschen Evangelischen Kirchentagen vermieden werden.
Eine tief greifende Veränderung brachte die Rüstzeit für die 7. Landessynode: Schon seit längerem hatte sich die Arbeit in der Landessynode als wenig effektiv erwiesen und man erhoffte durch die Bildung von Gruppen, die Arbeit besser strukturieren und auch im Blick auf den Oberkirchenrat die eigene Position deutlicher herausstellen zu können. Die größte Gruppierung nannte sich „Bibel und Bekenntnis“, dann folgte „Evangelium und Kirche“, die sich in der Tradition der während des Kirchenkampfes entstandenen „Bekenntnisgemeinschaft“ sah, sowie zwei kleinere Gruppen, die „Evangelische Erneuerung“ sowie der „Offene Gesprächskreis“. Noch waren die Gruppen freilich nicht fest abgeschlossene Kreise, vielmehr war daran gedacht, dass sich die Mitglieder der Synode je nach Thema unterschiedlichen Gesprächskreisen anschließen sollten. Allerdings verfestigte sich die Situation im Umfeld der unruhigen Jahre 1968/69, so dass sich in der 8. Landessynode drei relative feste Gesprächskreise herausbildeten: „Lebendige Gemeinde“ – ein Zusammenschluss von Abgeordneten der Gruppe „Bibel und Bekenntnis“, der 1968 entstandenen „Evangelischen Sammlung“ und weiterer konservativer Personen – „Evangelium und Kirche“ sowie die Gruppe „Offene Kirche“, in der sich Personen des eher „linken“ Spektrums zusammenfanden, die zuvor in der Gruppe „Evangelische Erneuerung“ oder im „Offenen Gesprächskreis“ aktiv waren. Anzufügen ist noch, dass bei der Wahl zur 13. Landessynode im November 2001 erstmals Kandidaten antraten, die eine neue Gruppierung bildeten: „Kirche für morgen“. Sie konnten jedoch nur wenige Mandate erringen und bilden bis in die Gegenwart den kleinsten Synodalgesprächskreis.
Mehrfach verändert wurde der Zuschnitt der Wahlkreise. So gab es ab 1966 relativ große Wahlkreise, in denen mehrere weltliche und geistliche Abgeordnete gewählt wurden. Dies erwies sich jedoch als wenig praktikabel, so dass die Wahlordnung von 1970 wieder eine größere Anzahl von Wahlkreisen vorsah, in denen zumeist ein geistlicher und zwei weltliche Abgeordnete gewählt werden. Um den Umwälzungen der 1968er Jahre gerecht zu werden, suchte man durch die Zuwahl von sechs Jugenddelegierten die junge Generation in die Synodalarbeit einzubinden. Freilich bewährte sich dieses Experiment nicht. Als Ausgleich wurde 1970 das aktive Wahlalter auf 18 Jahre herabgesetzt und auch die Möglichkeit gewählt zu werden, war nun nicht länger erst ab dem 25., sondern bereits ab dem 21. Lebensjahr gegeben. Seit 1995 dürfen 16-jährige wählen; ab dem Alter von 21 Jahren ist eine Wahl in die Synode möglich.
Entscheidend für das Württembergische Wahlrecht ist – und dies ist einzigartig in Deutschland –, dass die Gemeindeglieder direkt ihre Vertreter in der Landessynode bestimmen. Per Mehrheitswahlrecht wird in den verschiedenen Wahlbezirken eine festgesetzte Zahl von geistlichen und weltlichen Abgeordneten gewählt. Stimmen für Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die nicht zum Zuge kommen, fallen unter den Tisch. Da die Wahl als Personenwahl intendiert ist, rückt beim Ausscheiden eines Synodalmitgliedes – unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit – jeweils die Person nach, die in einem Wahlkreisen die nächsthöhere Stimmenzahl erhalten hatte.
Die Württembergische Landeskirche gab sich nach 1945 keine neue Verfassung, sondern knüpfte nahtlos an die 1920 entstandene an. So sah sich der Landeskirchentag weiterhin primär als Gegenüber der eigentlichen Kirchenleitung, die durch Oberkirchenrat und Landesbischof wahrgenommen wird. Dieses anachronistische Selbstverständnis prägt die Landessynode bis heute (27): Aufgrund der ihr in der Kirchenverfassung vorgegebenen Stellung ist sie weniger Kirchenleitungs- als Kontrollorgan. In Parallelität zur politischen Ordnung versteht sie sich als Parlament und die Gesprächskreise entwickeln demgemäß Züge von Fraktionen. Auch dass bis heute wesentliche Personalentscheidungen in dem nichtöffentlich tagenden Landeskirchenausschuss gefällt werden, passt in dieses Bild und es ist bezeichnend, dass die Synode keine Möglichkeit hat, Entscheidungen dieses Gremiums zu revidieren oder zumindest Rechenschaft über Beschlüsse zu fordern.
Die Synode könnte im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums der Kirchenverfassung 2020 überlegen, ob nicht die Erarbeitung einer neuen Verfassung angezeigt erscheint. Eine solche müsste dann auch zum Ausdruck bringen, dass die Kirchenleitung in der Hand der Synode liegt.
Aktualisiert am: 19.03.2018
Bildnachweise
-

-
Verordnung zur Einführung einer Landessynode durch König Karl 1868 im Amtsblatt des württembergischen Konsistoriums
Landeskirchliche Zentralbibliothek
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/landessynode (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.