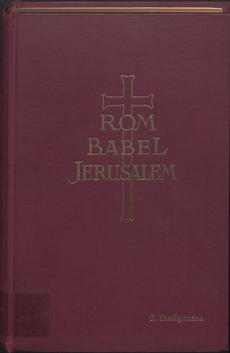-
Inhaltsverzeichnis
- 1: Pfarrbericht Unterjettingen 1920
- 2: Aus dem Dekansbericht zum Kirchenbezirkstag 1926 (Abschnitt II., Allgemeines)
- 3: Aus dem Bericht des Dekans zum Kirchenbezirkstag 1930 (Abschnitt C, Allgemeines)
- 4: Zum protestantischen Geschichtsbild im 20. Jahrhundert: Georg Thaidigsmann, Pfarrer in Entringen
- Anhang
1: Pfarrbericht Unterjettingen 1920
Quelle: LKA A 29, 4805 Pfarrbericht Unterjettingen 1920
Pfarrbericht für die auf den 8.April u. 13. Juni ausgeschriebene Visitation der Pfarrei Unterjettingen
I. Schilderung der Gemeinde
1. Die Pfarrei umfaßt die geschlossene Gemeinde Unterjettingen und das selbständige Predigtfilial, die frühere Hof-, jetzt Staatsdomäne Sindlingen
2. Charakter der Gemeinde
a) Frömmigkeit
Unterjettingen ist ein Dorf von altwürtt[embergischen] Charakter. Die Frömmigkeit ist typisch bäuerlich. Das starke Abhängigkeitsgefühl von der Witterung ist religiös gefärbt. Gott ist zunächst der, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn. Bei nahendem nächtlichen Gewitter steht man auf und betet. Einer der ärgsten Trinker sucht dann Schutz beim Sprecher der Gemeinschaft. Nach einem lauten Fest mit viel Lärm und Betrunkenheit kam (vor Jahren) im Sommer ein Hagelschlag – eine göttliche Strafe. Von einem früheren Pfarrer wird gerühmt, daß er ins Feld „geknuibet“ (gekniet) sei und um Bewahrung gefleht habe. Um seinetwillen kam lange Jahre kein Hagel. Gegen die göttliche Hand im Wetter soll man sich nicht durch Hagel-Versicherung schützen. Die ältesten Bauern sind nicht versichert. Andere Versicherungen sind erlaubt. Daß die Witterung ihre natürlichen Gründe habe, wird zugegeben, aber wunderbare Eingriffe werden darin doch angenommen. Daß die Meteorologie im Krieg nicht viel entdeckt hat, ist selbstverständlich. Gott läßt sich doch nicht in die Karten gucken. Überhaupt ist vieles in der Natur, z.B. das Wachsen des Keims, etwas Unerklärliches. Die Wissenschaft weiß überhaupt nicht viel. Studierte Bauern machen höchstens mehr Torheiten als andere. Daß Schwindsucht von Bazillen herrühre, wird nicht geglaubt.
Die Allmacht ist die hervorragendste göttliche Eigenschaft. Auf sie wird alles zurückgeführt. Demgemäß ist die Furcht der Grundcharakter der Frömmigkeit. „Gottesfurcht“ ist der Ausdruck für Frömmigkeit. Auch von der weltlichen Obrigkeit erwartet man Strenge. „Das gibt Furcht“. Die gegenwärtige Regierung wird darum gering geschätzt, weil sie auf das Erregen von Furcht verzichtet.
Jedoch ist der Gedanke an die göttliche Allmacht mitunter auch tröstlich. Man weiß sich in ihr geborgen. Sie wird alles recht machen ohne menschliche Nachhilfe. Daher wehren sich die Alten, z.B. der Stundenhalter, der an Blinddarmanfällen leidet, gegen eine Operation. Nach schmerzlichen Todesfällen sagt man: „Es ist nur gut, daß man weiß, wers getan hab.“
Die rel[igiöse] Haupttugend ist dementsprechend der Gehorsam. Der göttliche Wille ist in der Bibel, 10 Geboten, Gewissen klar gegeben. Probleme gibt es da keine. Pflichtenkollisionen sind unbekannt. Der gehorchende zwölfjährige Jesus ist eine beliebtere Figur als der Bergprediger mit seinem: „Ich aber sage euch.“ Der Gehorsam gegen ältere Brüder wird in Gemeinschaftskreisen bes. hoch geschätzt. Von der Jugend wird nicht bloß Ehrerbietung, sondern auch Unterordnung verlangt. Den Gehorsam segnet Gott. „Denen, die mich lieben und meine Gebote halten, bin ich wohl bis ins 1000. Glied“ – ist ein Spruch, über den die Gemeinde nicht müde würde, Christenlehre anzuhören. Der göttliche Segen wird sehr massiv als Gedeihen in Feld, Stall und Familie gedacht. Umgekehrt ist aber auch Unglück die Folge des Ungehorsams. Besonders bei Sünden gegen das 6. Gebot wird festgestellt, daß die aber nicht vorwärts kommen. Ein Sprüchlein wird gern zitiert: Junges Blut! Spar dein Blut! Armut weh im Alter tut!
Dieser alttestamentlichen, zur Gesetzlichkeit neigenden Frömmigkeit entspricht ein Zug zur Werkgerechtigkeit. Die Justitia civilis wird als hinreichend empfunden, um vor Gott zu bestehen. Auf „ein gutes Ort“ hofft man für Sterbende fast stets; eine Mutter einmal mit der Begründung: ihre 18jährige Tochter habe ja noch nicht einmal ein Verhältnis gehabt. Einem Trinker, der sich erhängen wollte, brach der Strick. Er erzählte nachher einem Freund, ihm sei es schon grün und blau vor den Augen gewesen. Der Freund trug das weiter mit der Bemerkung, das seien die grünen Auen von Ps. 23.
Hier setzt nun das Gemeinschaftschristentum mit starker Gewissensschärfung ein (1). Es trägt gegenüber der bisher geschilderten, am A.T. orientierten Frömmigkeit entschieden christl[ichen] Charakter. Zwar schätzt es das A.T. gleich hoch ein wie das N.T. – nur vom Zeremonialgesetz sind wir frei – als Rechtfertigung für das Erschießen feindseliger Belgier 1914 wird das Bannen kananäischer Völker angeführt – , aber doch hängt diese pietistische Frömmigkeit durchaus an der Passion Christi. Das Wort „Heiland“ wird öfter gebraucht als das Wort „Gott“. Hierin hat der Pietismus die ganze Gemeinde beeinflußt. Der Heiland regiert die Welt, die Völker, die einzelnen. Er „kommt“, um Sterbende abzuholen, er schenkt neue Herzen, führt Liebende zusammen, segnet die Natur. Ein regnum naturae und ein regnum gratiae wird nicht unterschieden. Vor allem wird Christus als Versöhner gefeiert. Das Sündenbewußtsein bei den Gem[einschafts]leuten und den ernsteren Kirchenchristen ist ernst und tief, wenn sie auch nur selten davon reden. Eine sterbende Bäurin sagte: „Ich hab nicht gelebt, wies der Brauch ist.“ Sterbende verlangen d[ie] Versicherung, daß ihre Sünden tatsächlich getilgt seien und verlassen sich rein auf die Gnade. Dabei haben natürlich die paulinischen Gedanken über die metaphysische Bedeutung des Todes Christi ihre Geltung. Doch gibt es keine Fanatiker der Orthodoxie; vielmehr ist es die Eigentümlichkeit der hahnischen auch hier, daß sie weniger auf Rechtgläubigkeit als auf Bewährung im praktischen Leben sehen. Und so dringen die Gem[einschafts]leute bei sich und anderen neben der Annahme Christi als Versöhner – das gilt als Frucht des Konfirm[anten]unterrichts und des Predigthörens – auf die Nachfolge Christi. Darin sich zu stärken ist der Zweck der Stund. „Jagen nach der Heiligung“, Ringen um den Eingang durch die enge Pforte“ sind spezifische hahnische Werte. Wie notwendig diese Vertiefung der Frömmigkeit bei der bäuerlichen Neigung zur Selbstgerechtigkeit ist, ist oben berührt worden, und darum ist auch die Kehrseite des hahnischen Typus der ständige schwere Bußernst, das unfrohe Schaffen, das menschliche Werk mit Furcht und Zittern, die strenge Verurteilung harmlosen fröhlichen Lebensgenusses mit in Kauf zu nehmen.
Das Gebetsleben blüht zweifellos beim ernsten Teil der Gemeinde, nicht bloß bei den Vorbetern in der Stund. Manche Häuser werden gezeigt, in denen früher besonders viel gebetet worden sei. Mancher Keller könne viel erzählen.
Die Hausandachten lassen nach. Schwerlich wird sie noch in der Hälfte der Häuser gepflegt. Doch trifft man Gebetbücher in jedem Haus, freilich kein einziges Neueres, Wurster z.B. ist unbekannt. Bei den älteren Familien findet morgens und abends Andacht statt. Tischgebet ist allg[emeine] Sitte. Wer am Sonntag nicht zur Kirche gehen kann, liest – so war es bisher – zu Hause eine Predigt. Sonntag Nachm[ittags] liest man ein Kapitel. Beim Betglockenläuten spricht Vater oder Mutter einen Vers. Doch ist das nur noch bei wenigen Familien Sitte. Im Wirtshaus die Kappe ab- und die Pfeife aus dem Mund nehmen ist ganz abgekommen. Kranken lesen die Angehörigen täglich ein Lied vor (vom Pfarrer wird das als Selbstverständlichkeit erwartet) hoffend, daß es eine Wirkung im Sinn der Gesundung tue. Selten kommts vor, daß ein Besucher frei betet. Vom Gesundbeten ist noch nichts bekannt.
Die Bibel gilt als unantastbares Gottes Wort. Zwar fehlt es nicht an Zweiflern. Das größte Lügenbuch schalt sie einmal ein Wirtshausbesucher und von einem Bürger erzählt man sich, daß er gar nichts glaube. Der ist – nebenbei bemerkt – der Meinung, er fühle Erdbeben voraus. Einmal controllierte ich ihn; dabei versagte er. Moderne, liberale Pfarrer gelten als Schädlinge. Mein Bekenntnis, daß ich auch durch die moderne Schule gegangen, hat Kopfschütteln, doch wie mir scheint, keine ernstliche Entfremdung hervorgerufen. Kunz Pfarrer – Hildrizhausen machte einmal den praktischen Versuch, ein tief rel[igiöses] Weib in kritische Gedankengänge einzuführen. Nach 8 Tagen kam die Frau mit der Bitte, davon abzustehen, ihr falle sonst gar alles hin. Ähnlich würde es auch hier gehen. Ich begnüge nach zugeben, was ich vertreten kann. Ein ganz vereinzelter Versuch, in meinem Männerverein einen textkritischen Gedankengang verständlich zu machen, wurde übrigens freundlich aufgenommen. Die Vorstellungen der Bibel von Himmel und Hölle, Engeln und Dämonen sind in die Köpfe übergegangen. Wenn mein Kirchenpfleger vom Leibhaftigen spricht, schaut er sich ängstlich um.
Der Krieg brachte der Frömmigkeit zwar keine eigentliche Krise, aber eine spürbare Erschütterung. In der Heimat wurde zwar der Widerpart von Krieg und ev. Liebesgebot nicht hart empfunden; der Bauer ist zu a[l]testamentlich] orientiert; auch die Stundenleute beteten um Sieg. Der unglückliche Kriegsausgang wurde sofort als Gericht gedeutet und gab keinen Anlass zu Zweifel. Aber der moralische Niedergang rief die Frage wach, warum Gott ihn dulde. Eine gewisse Auskunft wird in eschatologischen Ideen gesucht. Es gehe eben dem Ende zu, da muß es so kommen. Nicht bloß Gem[einschafts]leute, die ganze ältere Generation lebt in ihnen. Als ein paar Urlauber eine Leuchtrakete steigen ließen, liefen die Weiber zusammen und deuteten den Kometen als Vorboten des Endes. Die Sterne werden von dem Himmel fallen, zitierte ein unkirchliches Weib. Den Hauptanstoß bildet die durch den Krieg verursachte Verschiebung der Vermögensverhältnisse. Ein mittlerer Bauer mag im Krieg 10.000 M verdient haben. Schulden hat niemand mehr. Ist schon vorher die „Mißgunst“ eine Hauptsünde des Bauern, so hat sie sich nun durch das Vorankommen der Gewissenlosen, Stehenbleiben der Gewissenhaften mit dem Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit verbündet. Die Mißgunst nahm teilweise groteske Formen an. Von einem Bauern, dessen Einziger auffallend lang nicht an die Front kam, sagte man: „Er kann nicht mehr in die Kirche kommen, so sieht man auf ihn.“ Fast sagt man es ihm ins Gesicht. Anonyme Briefe gingen ab, um einen beneideten Reklamisten an die Front zu bringen. Die Lebensmittelschmierage tat ihr Möglichstes. Der Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit äußerte sich wenigen Leuten, saß aber tief. Ps 73 half ihn überwinden.
Die Kriegsteilnehmer lassen durchblicken – außer einigen Stundenleuten –, daß eine Zeitlang für sie unter das Wort „Schwindel“ auch das Christentum gehört habe. Die Feldprediger galten als Aufklärungsoffiziere und wurden sehr kritisch betrachtet. Ich versuchte sofort 1916 mit Ihnen Fühlung zu gewinnen, sandte wöchentlich das Stuttg. Ev. Sonntagsblatt hinaus, das unter 10 zwei gelesen zu haben scheinen, Flugblätter des Ev. Presseverbands, monatlich die Heimatklänge von Unterjettingen. Besonders dies Blatt wurde gern gelesen. Die Heimgekehrten bat ich M(är)z 1919 zu einem Vortrag zusammen über „Christentum und Krieg“. Stimmen aus Stundenkreisen warnten mich einmal des Wirtshaussaales wegen, und dann aus Besorgnis, ich würde nimmer lebend heimkommen. Sämtliche Soldaten waren erschienen und hörten mit Aufmerksamkeit den Vortrag an. Die Ältesten bedankten sich und erklärten, sie hätten wohl gemerkt, auf was ich hinaus wolle: Kirchengehen und beten. Sie wollten das auch üben. Die Ausführung dieses Vorsatzes läßt allerdings zu wünschen übrig. Ein zweiter Vortrag März 1920 fand wenig Zuhörer äußerer Umstände halber. Augenblicklich ist die Stimmung geteilt. Die größere Zahl Kriegsteilnehmer – auch ledige – haben sich ins kirchliche Leben völlig hereingefunden, ein kleinerer Teil schwankt. Einige Unkirchliche sagen, sie hätten nun lang genug auf ein Wunder gewartet. Bei den Heimgekehrten aber, bei den Leuten hier überhaupt, ist es schwer, durch die kirchl[iche] Sitte und die Reden hindurch auf den Grund zu sehen. Sie haben eine Virtuosität darin, dem Pfarrer nach dem Mund zu reden und geben nicht ihre letzten Gedanken preis.
Ein dunkler Schatten auf die hiesige Frömmigkeit ist der Aberglaube. Es will wenig besagen, dass man Hochzeiten Dienstags oder Donnerstags feiert, Montags nicht reist und keine Stellen antritt. Auch des Nachts Kinder und die Mehrzahl der Alten sich nicht durch den Wald nach Nagold an einem Grenzstein vorbei nach Oberjettingen sich getrauen, ist nichts Außergewöhnliches. Der „Arm“ zwischen Sulz und Oberjettingen ist eine gefürchtete Stelle. Am Kirchhof vorbei gehen manche schwitzend. Ein Schneider, der nach Feierabend ans Grab seines Sohnes in der Dunkelheit zu gehen pflegte, wurde bewundert. Bedenklicher ist der blühende Geisterglaube. Verstorbene werden in ihren Wohnungen gesehen; im Wald stehen an bestimmten Stellen Geister in mittelalterlichen Trachten; will man eine Familie kränken, so behauptet man, ein verstorbener Angehörige „laufe“. Bei mir beklagte sich einmal eine Frau darüber. Der Ausdruck „Geist“, „Goistle“ ist sogar den Nagolder Schulkindern wohl bekannt. Sympathie treiben kommt vor. Ein Schuhmacher z.B., der homöopathische Mittel verkauft und überhaupt als Medizinmann vor dem Arzt zugezogen wird, soll den Leuten Zettel mitgeben. Sie verlieren dann den Appetit. Angehörige finden den Zettel und verbrennen ihn, womit geholfen ist. Wieweit bei Viehkrankheiten Zauberkünste vorgenommen werden, weiß ich nicht. Anstreichen von Melkkübeln aus Angst vor Verhexung kommt vor und sonst sicher manches, was dem Ohr des Pfarrers ängstlich verheimlicht wird. Dem Anwünschen von bösen Folgen wird eine gewisse Kraft zugesprochen. Das übelste ist die Neigung, Kartenschlägerinnen nach zu laufen. Als im Apr. 1920 auf dem Rathaus 8.000 M[ark] gestohlen wurden, reisten einige Leute (Gemeinderäte?) zu einem Weib nach Niedernau, die die Kunst des Kartenschlagens verstehe. Das erklärte als schuldig 3 ortsansässige Männer und 1 Mädchen, das bald mit einem Komplizen Hochzeit haben werde. Adlerwirt B., der wegen Schwarzschlachtung gestraft worden war, befrug sich bei einer Stuttgarter Künstlerin nach dem Verräter. Diese strich beim Kartenschlagen auf einen König und spitztragenden Buben; die Karten wurden als Schultheiß und Fleischbeschauer gedeutet; seither hat der Wirt einen Groll auf die beiden. In religiöser Hinsicht macht sich der Aberglaube als Däumeln bemerkbar. Vor jeder Unternehmung wird in der Bibel gedäumelt. Eine Frau schlug ihrem ins Feld gehenden Sohn das Gesangbuch auf und traf ein Sterblied. An einem Sonntag 1917 tat sie es wieder und fand wieder eins. Sie sei „wütig“ geworden, erzählte sie mir, aber an dem Tag sei der Sohn gefallen. Eine andere Mutter, die sich auf einen glückhaften Spruch beim Ausmarsch des Sohnes verlassen hatte (sehr kirchliche fleißige Stundenbesucherin), wurde durch die Todesnachricht schwer enttäuscht.
Der konservative Grundzug der Bevölkerung macht sich überall bemerkbar. Politisch ist Unterjettingen eine Hochburg des Bauernbunds. Keine pol[itische] Größe ist so verehrt wie Th[eodor] Körner. Die von ihm herausgegebene Schwäbische Tageszeitung hat 13 Abonnenten und ihre Sonntagsbeilage beeinflußt das kirchl[iche] Empfinden. In die mitunter starke Kritik an Konsistorium und Pfarrer Welt, die hier aus Gemeinschaftskreisen laut wird, stimmen meine Leute, auch nicht Stundenbrüder lebhaft ein. Die politischen Wahlen im Januar 1919 fielen folgendermaßen aus. Es wählten von
12. Januar
Stimmberechtigte: 639, Abstimmende 583 =91 %, Bauernbund: 342, Weingärtner: 16, Bürgerpartei: 54, Sozialdemokratie: 95, Unabhängige Sozialdemokraten: 6, Demokraten (DDP): 67, Zentrum: 3, Freibund: 0
19. Dezember
Stimmberechtigte: 639, Abstimmende: 574, Bauernbund, Weingärtner und Bürgerpartei: 367, Sozialdemokratie: 103, Unabhängige Sozialdemokraten: 6; Demokraten (DDP): 70, Zentrum: 28, Freibund: 0
Das merkwürdige Anschwellen des Zentrums kam von dem Wahn, Herr Erzberger werde einen guten Frieden machen.
Auch in Schul- und Kirchenfragen ist die Grundrichtung der Gemeinde eine konservative. Daß in den neuen Lesebüchern Märchen enthalten sind, ist den Alten, bes. den Stundenleuten ein Anstoß. „Die Lügenbücher sollte man den Kindern nehmen und sie verbrennen.“ Mit der Einführung des Zeichenunterrichts, der Kosten verursacht, sind die wenigsten einverstanden. Der frühere Kirchengemeinderat war geneigt gewesen, die Stiftung der Einrichtung für elektr[isches] Licht in der Kirche nicht anzunehmen. (Noch nicht eingerichtet). Einen Kirchenchor lehnte er ab, da hier Mädchen und verheiratete Männer zusammensingen würden, daß die Mädchen des Jungfrauenvereins sangen, duldete er. Zu Lichtbilder Vorträgen, auch über Mission, erscheint nur die Jugend, neugieriges Volk und einige geweckte Männer, der Kern der Gemeinde nicht. Die von mir eingeführten Weihnachtsspiele in der Kirche (nach Art des Mittelalters Hirtenspiele), die beim überwiegenden Teil der Gemeinde großen Anklang fanden, werden von Stundenleuten und dem ältern Geschlecht nicht gern gesehen. Doch dauerte es 3 ½ Jahre bis ich das erfuhr. Zahlenmäßig ist die Gruppe der Alten gering. Aber in kirchl[ichen] Dingen überragt ihr Einfluß. Besonders infolge des Kriegs hat sich ein Gegensatz zwischen Alter und Jugend herausgebildet. Die vom Feld heimgekehrte Jugend will – mindestens 70 Mann von den 200 – sonntags tanzen und unbeaugt durch die Polizeistunde bechern. Sie hat sich im Gemeinderat 1919 4 von 14 Sitzen erobert und macht sich überall geltend. Anlässlich der Friedensfeier 5. Apr. 1920 lehnte der Gemeinderat, Festausschuß und Pfarrer die Zuziehung teurer Blechmusik ab. Die Jugend aber forderte sie und setzte ihren Willen durch. Hielt dann aber auch ihr Versprechen tadelloser Führung. Fast kam es über dieser Sache zu einer doppelten Feier. Die Gemüter waren sehr erhitzt. Mir fiel die undankbare Aufgabe der Vermittlung zu. Auch äußerlich zeigt sich der Unterschied der Zeiten. Neben dem Ähne in weißen Lederhosen kann man den Enkel mit gelben Schuhen sehen. Der alte Hirschwirt sagte mir einmal im Blick auf einen verstorbenen Trinker, seinem guten Kunden: „Ein ausgezeichneter Mann! Freilich, was sein Seelenheil betrifft, s‘ ist Schade um ihn.“ Der Sohn läßt jeden Sonntag in seinem Saal tanzen, besorgt auch die Musik dazu und kommt selten zur Kirche.
b) Die Kirchlichkeit
Ist immer noch sehr gut zu nennen. „Wer nicht in die Kirche geht, der gilt hier nichts“, sagte mir am 3. Tag ein alter K[irchen]G[emeinde]R[at] und es ist richtig. Unter den allerhand Gründen, die der Gemeinderat M[är]z 1920 gegen die Person des Hauptlehrers Haarers vorbrachte (I. XVII), war auch der: er gehe nie in die Kirche, ein Vorwurf, der sichtlichen Eindruck auf den anwesenden Bez[irks] Schulinsp[ektor] (Schäfer Böblingen) machte. „Wir fragen bei jedem neuen Lehrer zuerst, ob er in die Kirche geht“, sagen mir die älteren Leute. Doch auch in diese überkommene strenge Auffassung hat der Krieg ein Loch geschlagen. Die Heimgekehrten gehen zum größten Teil sehr unregelmäßig zur Kirche. Manche kommen gar nie. Einer erklärte, ob seine Kinder mit oder ohne Rel[igions]unt[erricht] aufwüchsen, sei ihm einerlei. Doch haben, wie ich höre, alle Familienväter eine Eingabe um Erhaltung der Konfessionsschule, die von Gem[einschafts]kreisen ausging, unterschrieben. Eine gewisse Probe der Kirchlichkeit war die Gründung einer Ortsgruppe des Ev. Volksbundes Mz. 1919. Meine Vertrauensleute gingen umher und sammelten Unterschriften, mit dem Bedeuten, wer noch etwas von der Kirche wissen wolle, solle unterschreiben. Das ganze Dorf unterschrieb. Nur das Stundenhaus zögerte auf Wink von Stuttgart hin.
Es ist das übrigens nicht als Ausdruck persönlicher Überzeugtheit vom Wert der Kirche, sondern als Wirkung des Hordengeistes aufzufassen. Der Dorfbewohner ist – außer in rel[igiöser] Hinsicht – nicht selbständig. Unterschreiben irgendwo ¾, so will keiner mehr zurückbleiben. In den Collegien werden die allermeisten Beschlüsse einstimmig gefaßt. Jeder fragt, was der Nachbar tut. Hat in der Ernte eines mit Schneiden begonnen, so ist kein Aufhalten mehr, mögen die Halme noch so grün sein. Als ich für den Reformationsdank 1917 sammelte, stellte ich den Leuten eine Opferbüchse hin, damit sie unbeeinflußt nach eigener Entscheidung opfern könnten. Die erste Frage war nach der Gabe des Nachbarn. Sie vermißten geradezu eine Geberliste. Ergebnis 300 M[ark]. Bei einer Sammlung zur Anschaffung neuer Glocken stellte ich eine Liste auf und ließ die Wohlhabenden zuerst eintragen. Ergebnis 9467 M[ark].
Daß die kirchl[lichen] Wahlen in konserv[ative] Stimmen fielen, ist nicht verwunderlich. Am 1. Juli 1919 (Landeskirchentagswahl) wählten rund 60%. Es fielen Stimmen auf: Lukas Theurer 321, Prälat Römer 348, Prof. Scheel 38, Stadtpf. Völter 16.
Bei der K[irchen]G[emeinde]R[ats] Wahl am 7. D[e]z. 1919 konkurrierten zwei Wahlzettel, einer, der von Ausschußmitgliedern des Ev. Volksbunds inoffiziell ausging, und einer der Stund. Der letztere siegte etwa im Verhältnis 2:1. Wahlbeteiligung 52 %. Bei der Ersatzwahl für † verstorbenen Prälat Römer am 25. Apr. 1920 stimmten 35 % ab, alle für Groß-Holl. In Sindlingen wählten 1. Juli 1919 sämtliche 20 Berechtigten Römer-Theurer, 25. Juli 20 wenigstens 18 Groß, 2 waren krank. Ökonomierat Adlung hat gute Disziplin.
2. sic Die Teilnahme am öffentlichen Gottesdienst
ist gut. Die übergroße Kirche – 680 Sitzplätze auf 1197 Einw[ohner] – ist meist gut besucht. Besonders die männliche Jugend erscheint fleißig. An gewöhnlichen Sonntagen sind die Plätze der Jugend von 14-20 Jahren dicht besetzt. Nach der diesjährigen Konfirmation wissen wir sogar nicht, wohin mit den Neukonfirmanten. Aber auch von den Kriegsteilnehmern kommt ein Teil (1/3)(2) ziemlich regelmäßig. Dagegen zeigen die Bänke der älteren Männer Lücken. Die Feiertagsgottesdienste sind gut besucht. Am 1. Mai 1918, einem allerdings regnerischen Tag, wurden 22 M[änner] 128 Fr[auen] = 150 Pers[onen] gezählt. In der Christenlehre steht immer noch ein Kranz von c[ir]ca 30 Männern, bes. jüngere, auf der Empora, während von den Frauen halb so viel da sind wie am Vorm[ittag]. Die Bußtagsgottesdienste werden als Bibelstunden gehalten. Die gehen das ganze Jahr über fort und sind ordentlich besucht (c[ir]ca 100 Pers.)(3), so gut freilich nicht mehr wie die Kriegsbetstunden. Nachdem der Mann oder Sohn heimgekehrt ist, hat der Kriegsbetstundenbesuch seine Zweck erfüllt. Völliges Meiden der Kirche ist sehr selten. Bei Kriegsteilnehmern scheint dafür Gleichgültigkeit, anderen eher ein böses Gewissen der Grund zu sein. Eine schlimme Sache ist der Kirchenschlaf. Eine ziemliche Anzahl älterer Männer, aber auch Mädchen und Schulkinder „nicken“ regelmäßig, mag predigen wer will. Doch ist die Aufmerksamkeit bei der großen Mehrzahl sehr groß. Vor dem Gottesdienst ist die Ruhe nicht tadellos. Dagegen geht man nach der Kirche schweigend heim. Bei den Schulkindern stellte ich ab und zu fest, daß die wenigsten das Thema der Predigt behalten, dagegen haften Illustrationsgeschichten bei allen. Wie weit die Kirche bei den Bauern das Theater ist und daher besucht wird, kann ich nicht beurteilen.
3. Sonntagsfeier
Die Heiligung des Sonntags wird durchaus als Gesetz empfunden, dessen Übertretung mit Strafen: Hagel, Unglück im Stall usw. bedroht ist. Gearbeitet wird nicht, abgesehen von einer unkirchl[ichen] und einer Methodistenfamilie. Man „wandelt“ nachm[ittags] aufs Feld, macht Besuche usw. Die Wirtschaften sind schwach besucht; erst gegen Abend füllen sie sich - seit 1917 wieder - mit jungem Volk, das bei Musikantenuntermal[ung] u[nd] Ziehharmonika tanzt. Auch geht die tanzwütige Jugend nachm[ittags] nach Nagold, wo im Löwen und Pflug bis Mitternacht Gesellschaft anzutreffen ist. Eine gewisse Unruhe bringen auch die Hamster herein, von denen es Sonntags wimmelt. Die Wirtshausbrüder, die auch carfreitags ihr Bier haben müssen, sind nahezu verachtet.
4. Verhältnis zum Pfarrer
Als ich meinem Kirchenpfleger einmal meine Verwunderung aussprach, daß die Gemeinschaften im Gäu so genau nach den Winken von Stuttgart exerzierten, erwiderte er: „So weit können Sie es auch noch bringen, Herr Pfarrer! Wir folgen unserem Hirten“. In der Tat ist die Achtung1 vor dem Pfarrer noch groß. Die alten Bauern stehen am Feierabend von der Bank auf, nehmen die Kappe ab, schieben die Pfeife ein, wenn der Pfarrer sie anredet, mag er selbst noch so jung sein. Die Jugend von heute wird freilich in der Schule nicht mehr zu solcher Reverenz gedrillt und grüßt mich darum auf der Straße kaum, obwohl sie nichts gegen meine Person hat. Es ist reine Lümmelei. Man sieht den Pfarrer in allen Häusern gern und wird eifersüchtig auf ein Haus, das er zu bevorzugen scheint. Ein guter Teil der Familien wünscht, ein Vertrauensverhältnis zum Pfarrer zu haben, und erbittet auch seelsorgerlichen Rat. Doch besteht andererseits eine Scheu ins Pfarrhaus zu kommen; man tut es in der Dämmerung und möchte nicht in den Verdacht kommen als wolle man sich beim Pfarrer wohl dran machen oder andere verschwätzen. Doch gestehe ich zu meiner Beschämung, daß Privatbeichte noch von niemand begehrt wurde. Kranke erwarten unbedingt Besuche des Pfarrers mit seelsorgerl[icher] Besprechung und Gebet.
Die Sitte, ins Pfarrhaus eine kleine Verehrung zu bringen, besteht noch. Einmal brachte mir ein frommes Weiblein die ersten Eier des Jahres mit der Bemerkung, sie denke, wenn sie die ersten ins Pfarrhaus bringe, dann legen die Hühner brav weiter. Leider kam dann kalte Witterung. Andererseits nimmt die Achtung vor dem Amt sichtlich ab. Die Jugend reflektiert auf seine wirtschaftlichen Bedingungen. Ich stieß bei sozialistisch angehauchten Kriegsteilnehmern auf die Meinung, daß ich als Pfarrer abhängig sei von den Kirchenkreisen und darum nicht nach freier Überzeugung handeln dürfte. Meine Teilnahme an der Aufklärungsarbeit gegen Schluß des Kriegs hat die Kriegsteilnehmer stutzig gemacht. „Das glaubten Sie selbst nicht, was Sie uns Sommer 1918 sagten, daß der Krieg noch ordentlich enden könnte“, sagte mir ein kirchentreuer Stundenmann und Kriegsteilnehmer. Bei dem starken Gegensatz von konserv[ativem] Alter und freier sich regender Jugend, die aber auch kirchlich ist, fällt dem Pfarrer die Rolle der Vermittlung zu. Die Gemeinschaft, von früher her geneigt, im Pfarrer ohne Weiteres ihren Mann zu sehen, ist mit meiner Amtsführung, insbes. Führung der Jugend-Vereine nicht ganz zufrieden. Der Jugend bin ich schwerlich liberal genug. Jedenfalls die Sammlung der Mädchen von der Gasse weg, ist den ledigen Burschen recht ärgerlich. Daß mein Privatleben, zumal ich ledig bin, aufs genaueste überwacht und besprochen wird, mitunter in bösartiger, aber nie faßbarer Weise, ist keine Frage.
2: Aus dem Dekansbericht zum Kirchenbezirkstag 1926 (Abschnitt II., Allgemeines)
Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanatsarchiv (DA) Herrenberg, D 401c
II) Allgemeines.
Wenn Gottesdienst & Christenlehre ein wichtiges Stück der Tätigkeit des Pfarrers ist, auf die es immer wieder gilt, alles Fleisch zu verwenden, so hat es sich auch in unserem Bezirk eingebürgert, dass dann & wann in den Gemeinden ein kirchlicher Vortrag gehalten wird. Wenn wir auch keine Gemeindehäuser haben, die neben der Kirche ein zweiter Ort der Wirksamkeit der Pfarrer sind, so sind doch je & je kirchliche Vorträge willkommen. Auch im letzten Winter wurde in einer Anzahl von Gemeinden ein Cyklus von Vorträgen gehalten, diesmal geschichtliche Vorträge über württembergische Väter, während voriges Jahr Vorträge über Glaubensfragen an der Reihe waren. Es ist dies eine erfreuliche Bereicherung des Gemeindelebens, von der ich wünschen möchte, dass sie Jahr für Jahr stattfinde; allerdings für die Herrn, welche die Vorträge halten, bedeutet es ein Opfer. Wenn ich noch einen Wunsch anfügen darf, so ist es der, dass überall mindestens eine Gustav-Adolf-Stunde im Jahr gehalten werden sollte; allerdings sollte der Gustav-Adolf-Verein mehr für Darbietung geeigneten Stoffs sorgen. Zu Missionsgottesdiensten bieten sich meist die Missionare selbst an. Zu begrüssen wäre es auch, wenn von Zeit zu Zeit ein liturgischer Gottesdienst stattfände.
Die Kirchensteuer ist eine äußerliche Sache, aber sie hängt mit dem Innerlichsten zusammen, mit der Verkündigung des Evangeliums als der Botschaft, die uns zum Frieden in der Zeit & zur Seligkeit in der Ewigkeit hilft. Gott sei Dank, dass wir die Verkündigung des Evangeliums haben & dass sie nicht ohne Frucht in unsern Gemeinden bleibt. Möge Gott uns eine Gnade dazu verleihen, dass wir im Dienst des Evangeliums immer treuer werden, dass wir selbst im Evangelium Leben & volles Genüge finden & darum auch dazu mithelfen können, dass es seine Lebenskraft in unsern Gemeinden zu entfalten vermag.
3: Aus dem Bericht des Dekans zum Kirchenbezirkstag 1930 (Abschnitt C, Allgemeines)
Quelle: DA Herrenberg, 401c
[Religionsverfolgung in Rußland] Unsere Aufmerksamkeit ist im vergangenen Jahr mehr als einmal auf Russland gelenkt worden. Insbesondere die massenhafte Flucht deutscher Bauern aus Russland, die um den gesamten Ertrag der jahrzehntelangen Arbeit ihrer Familie gebracht worden waren, richtete unsere Blicke dorthin. Wenn es sich in Russland nur um die wirtschaftliche Neuordnung, um die Ersetzung der kapitalistischen Wirtschaftsweise durch die kommunistische handeln würde, würden wir die Vorgänge dort mit dem größten Interesse verfolgen. Aber es steht dort noch etwas anderes in Frage; es handelt sich um den offensichtlichen Kampf gegen den Glauben, auch wenn dabei zeitweilig mit Rücksicht auf die erregte Weltmeinung ein wenig gebremst wird. Es ist nicht zufällig, dass das Ringen um die wirtschaftliche Gestaltung Russlands zu einem Kampf gegen die Religion geworden ist. Die wirtschaftliche Neuordnung geht von dem Grundgedanken aus: wir wollen mit eigener Kraft das Glück der Menschen herbeiführen; der Mensch muss mit eigener Hand sein Glück schaffen durch die Art, wie er das Leben gestaltet; es ist verkehrt, das Menschenglück von übernatürlichen, göttlichen Kräften zu erwarten; die haben bisher das Glück in der Menschheit nicht zu Stand gebracht & werden es nie zu Stand bringen. Religion ist nichts als Opium, für das Volk, ein Betäubungsmittel. Ein solches war früher nötig, als die Menschen von den Fürsten, von den Kapitalisten ausgebeutet wurde. Aber seine Zeit ist jetzt vorbei, wo das Volk durch die Gestaltung der irdischen Verhältnisse zum Glück geführt wird, dadurch dass jedem der im gebührende Anteil an den Gütern des Lebens verschafft wird.
Besondere Beweise dafür, dass in Russland eine Religionsverfolgung im größten Stil mit dem Zweck der Ausrottung der Religion im Gang ist, wird es wohl nicht bedürfen. Es ist verboten, jemand vor dem 18. Lebensjahr Religionsunterricht zu erteilen, dagegen werden nicht nur Hochschulen für den Unglauben errichtet, sondern es wird schon in den Volksschulen den Kindern der Unglaube beigebracht. Die Pfarrer sind rechtlos, sie bekommen keine Lebensmittelkarten, ihre Kinder dürfen keine höheren Schulen besuchen. Der Sonntag ist abgeschafft, das Familienleben wird aufzulösen gesucht. Wenn in einem Dorf die Kollektivwirtschaft eingeführt ist & diese soll mehr & mehr in allen Dörfern eingeführt werden, so ist es nicht mehr möglich, auch nur das Geringste zur Erhaltung der Kirche beizutragen.
[Konsequenzen für die Kirche Die Lage ist besonders auch darum für uns eine ernste, weil die Feinde des Glaubens in unserer eigenen Mitte einen Bundesgenossen haben in der Gleichgültigkeit, die nicht wenig erfüllt. Freilich unsere Lage ist keineswegs hoffnungslos, im Gegenteil. Sind auch Lücken in den Gottesdiensten, die Zahl der Besucher der Gottesdienste ist meist eine erhebliche. Wir wollen alles tun, um ihnen Sonntag für Sonntag das Wort Gottes recht darzubieten, damit sie Lust bekommen, immer wieder zu kommen. Wir haben Recht & Pflicht, die Kinder in der Schule in das Wort Gottes einzuführen. Wir wollen diese Gelegenheit treulich benützen & die Kinder mit einem gottesfürchtigen Sinn zu erfüllen suchen. Wir haben in Vereinen, in den Jungfrauen- & Jünglingsvereinen, die ja in unserem Bezirk einen erfreulichen Stand aufweisen, auch in den vereinzelten Männervereinen haben wir Gelegenheit, die Herzen im Sinn des Evangeliums zu beeinflussen. Wir wollen uns bemühen, dabei die Herzen für die christliche Lebensauffassung zu gewinnen. Wir haben in unseren Kirchengemeinderäten, in vielen treuen Gliedern unserer Gemeinden wertvolle Kräfte, die für die christliche Sitte, für den christlichen Glauben tatkräftig eintreten können. Wir wollen sie immer wieder bitten, uns als treue Mitarbeiter zur Seite zu stehen. Wir dürfen auch dafür dankbar sein, dass durch die Erinnerungstage an große Ereignisse in der Vergangenheit unserer evangelischen Kirche uns immer wieder die Kraft des evangelischen Glaubens in den alten Zeiten vor Augen geführt wird, & wollen das uns & unseren Gemeinden zur Ermunterung & zur Anspornung in der Gegenwart dienen lassen. Wir wollen auch nicht versäumen, von den großen Tagungen Kenntnis zu nehmen & unseren Gemeinden Kenntnis zu geben, von den großen Tagungen, auf denen die Sache Jesu Christi vertreten wird, von den Tagungen des deutschen Kirchenbunds, des Gustav-Adolf-Vereins. Nichts verkehrter, als wenn wir meinen würden, wir stehen mit unserem Glauben auf verlorenem Posten. Nein, es bleibt für alle Zeiten dabei: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat & immer neu überwindet. Im Kampf gibt es manchmal ein Zurückweichen, ein vorübergehendes Obsiegen des Feindes. Aber der letzte Sieg wird auf Seiten Christi sein. Darum arbeiten, dass auch in der Gegenwart seine Sache das Feld behält! Arbeiten, nicht verzweifeln!
4: Zum protestantischen Geschichtsbild im 20. Jahrhundert: Georg Thaidigsmann, Pfarrer in Entringen
-
Georg Thaidgsmann, Rom - Babel - Jerusalem
Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, Nr. 4069
Aus: Georg Thaidigsmann, Rom – Babel – Jerusalem. Der Menschheitsgang im Licht der Schrift bis zur Vollendung des Gottesreichs, Karlsruhe 1928 S.247-261.
Die deutsche Geschichte in göttlichem Licht
Ob es nicht mit der geographischen Lage zusammenhängt, daß der Neuaufgang des Evangeliums gerade dem deutschen Volk beschert wurde? Also nicht etwa um des deutschen Gemütes willen, als ob dieses für das Evangelium empfänglicher 248 wäre als die seelische Verfassung anderer europäischer Völker. Soviel ist ja an dem letzteren Gedanken richtig, daß das deutsche Volk durch vieles Leiden äußerer und innerer Art zu einem vertieften Erfassen des Evangeliums erzogen worden ist. Der Grund für die Betrauung mit dem Evangelium lag vielmehr in dem ihm anvertrauten Beruf, es an die europäische Völkerwelt weiterzugeben. Denn als Volk der Mitte war es dazu leichter imstand als ein Volk an der Außenseite. Nur von hier aus wird die Geschichte Deutschlands und damit auch der europäischen Neuzeit göttlich verstanden werden können. Ferne sei es, das deutsche Volk hinsichtlich der ihm zuteil gewordenen Gabe und Aufgabe neben das Volk der göttlichen Wahl, neben Israel zu stellen. Nur eine Nation, eben Israel, hat Gott zum Heilsträger für die Welt bestimmt. Aber in gewissem Sinn laufen die beiden Völker doch nebeneinander her. Beide sind in die Mitte gestellt: Israel in die des großen Kontinentalblocks, d.h. in die Mitte zwischen den drei großen zusammenhängenden Erdteilen; Deutschland in die Mitte Europas. Beide haben eine große Diaspora, d.h. ein großes Auslandsvolkstum innerhalb der Völkerwelt. Beide sind Völker des Leidens. Beide haben eine große, gottgewollte Aufgabe. Beide wurden schwer gezüchtigt, wenn sie ihrem Beruf untreu wurden. Darf auch gesagt werden: beide sind nicht endgültig verstoßen? Von Israel gilt’s; aber dessen Wiederannahme kommt erst nach furchtbarer Demütigung. Demütigungen unerhörter Art nach glänzendem äußeren Aufschwung sind in der Gegenwart auch über Deutschland verhängt worden. Wird auf die Demütigung eine Wiederannahme durch Gott folgen? Und wenn eine solche kommt, welcher Art wird sie sein? Was Christen für Deutschland begehren, ist eine neue Aufnahme in Gottes Gnade und neue Berufung zum Dienst. Die Bedingung hiefür ist die gleiche wie für Israel: eindringende Buße. Eine Rückgabe seines früheren äußeren Glanzes ohne gleichzeitige inwendige Erneuerung wäre für das deutsche Volk gar nicht günstig. Eine solche wäre möglich von ganz anderer als von Gottes Seite her, nämlich von der des Feindes, der dem Judentum, gerade weil es sich gegen seinen Beruf verhärtet hat, Weltstellung zu geben beginnt nach dessen tiefer Demütigung durch Gottes Gericht. Weltstellung ohne Buße, 249 ohne Gott, ist kein Segen, sondern Fluch. An solchem Fluch kranken die Weltvölker, obwohl sie, äußerlich betrachtet, obenan sind.
Ist diese Auffassung richtig, daß nämlich dem deutschen Volk ein göttlicher Beruf innerhalb Europas anvertraut worden ist, dann ist der Höhepunkt der deutschen Geschichte die Reformationszeit. Auf sie läuft die frühere deutsche Geschichte zu und von ihr, genauer von der Stellung des deutschen Volkes zum Evangelium, ist der Verlauf der ihr folgenden deutschen Geschichte bestimmt. Und die eigentlich Großen Deutschlands, also nicht die Großen im Sinn der Welt, sondern nach göttlichem Maßstab, sind die Männer gewesen, in denen das Evangelium eine Macht wurde und durch die Glaube und christliche Sitte in Deutschland geweckt und gepflegt worden sind. Vornean steht Luther, in dem deutsches Wesen sich aufs innigste dem Evangelium aufgeschlossen hat. Mehr als die andern Völker Europas hat das deutsche Volk die Jahrhunderte vor der Reformation als eine Schule unter dem Zuchtmeister des Gesetzes durchgemacht und innerlich durchgekämpft. Als das Evangelium neu aufkam, hat es mit und unter dem Evangelium gelitten, bis es durch den 30jährigen Krieg, der um des Evangeliums willen entstand und geführt wurde, an den Rand des Zusammenbruchs kam. Ringsum festigten sich die Nationen und brachten es zu kräftigen staatlichen Bildungen; Deutschland stand zurück. Es hat auch das Evangelium weitergegeben – Calvin stand in gewissem Sinn auf Luthers Schultern –, namentlich nach Osten und Norden und später auch über das Meer hinüber nach Amerika. Es hat auch in einzelnen christlichen Lebenskreisen die Verpflichtung zur Weltmission, d.h. zur Weitergabe des Evangeliums an die nichtchtistliche Welt bälder begriffen als andere Völker. Aber: hat Deutschland als Ganzes seinen göttlichen Beruf erfaßt, hat es als Ganzes sich in Gottes Dienst gestellt? Ging es nicht auch in diesem Stück ähnlich wie bei Israel, das, als Ganzes genommen, versagte? Zwar hat Gottes Güte nach dem furchtbaren Elend des 30jährigen Kriegs dem deutschen Volk auch äußerlich dreimal einen neuen Aufstieg beschert. Zuerst arbeitete sich Preußen herauf – nicht zum wenigsten unter der segnenden Kraft des Evangeliums – und erreichte unter Friedrich dem Großen 250 eine achtenswerte Höhe im Äußern und Innern. Aber bereits wurde das alte Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes angekränkelt durch das neue Evangelium von der Herrlichkeit des Menschen und seiner Vernunft und Güte, das doch kein Evangelium ist, sondern eine Verkehrung desselben. Da brach der napoleonische Wettersturm los, und Preußen und mit ihm Deutschland schien dem fremden Weltherrscher verfallen. Großenteils in Kraft des neu erwachenden Glaubensleben wurde der Kampf mit Napoleon gewagt nach dem in Rußland über dessen Selbstherrlichkeit ergangenen Gottesgericht. Und er gelang wunderbar. Deutschland hat einen neuen Glaubensfrühling erlebt. Aber zum allgemeinen Durchbruch kam das neue Glaubensleben nicht. Da pochten neue Stürme an Deutschlands Tore. Revolutionsgeist regte sich. Die sozialen Fragen tauchten auf. Die Zerklüftung des Volkslebens begann. Noch einmal wurde dem deutschen Volk eine wunderbare Güte Gottes zuteil. Das war im Jahr 1870. Aus dem von Frankreich aufgezwungenen Krieg erwuchs das Deutsche Reich. Eine kraftvolle staatliche Zusammenfassung, allerdings ohne das südöstliche Deutschtum, wurde dem deutschen Volk beschert, mit dem evangelischen Kaisertum an der Spitze! Es hatte nicht die Art der Reiche dieser Welt, die mit Gewalt und Druck herrschen wollen, und deren Staatskunst innerlich unwahre Wege geht, während die Staatslenker, die Diplomaten, von Recht, ja sogar von göttlichem Recht reden. Die schon länger selbständig gewordenen Völker übten solche unwahren Künste schon längst. Die deutsche Staatskunst suchte sie zu vermeiden. Sie kann das Licht ertragen. Vor den Augen der Welt liegen nun die Aktenstücke aus der ganzen Zeit des neuen Reichs offen da. Freilich wurde der Weg des neuen Reichs zwischen den Mächten dieser Welt zusehends schwerer, und die Versuchung, nach Art der Weltpolitik zu handeln, wurde größer. Und seinen eigentlichen Beruf, Träger des Evangeliums zu sein, hat auch der evangelische Teil des Volkes als Ganzes nicht erkannt, und ihn auch nicht als Ganzes geübt. Trotzdem sei nicht vergessen, was in Kirchen und Vereinen und in der Inneren Mission im Dienst des Evangeliums an unserem Volk getan worden ist und ebensowenig der rege Anteil an der Heidenmission, wiewohl er zahlenmäßig hinter den Leistungen der 251 englischen und amerikanischen Kirchen zurückblieb. Aber es kam die Richtung auf, die nach den Gütern dieser Welt griff. Und während irdische Blüte und Ehre sich mehrte, erhielt Gott die Ehre nicht, die ihm gebührte, und besonders die Buße die aus dem Dank für seine Güte und Segnungen entstehen soll. An Deutschlands Mark fraß der Wurm der Gottentfremdung und der Weltseligkeit, und bereits begann aus Deutschland neben dem Evangelium auch das Gift der Gottlosigkeit in die Welt hinauszudringen. Da brach der große Krieg aus. Auf einmal sah sich Deutschland inmitten einer Welt von Feinden. Der Krieg war eine Kette von wunderbaren göttlichen Durchhilfen; aber am Schluß kam doch das Erliegen. Wir konnten es während des furchtbaren Krieges kaum fassen, daß er in dieser Weise endigen könnte. Nun beim Rückblick sehen wir in diesem Ausgang nicht nur einen Sieg der Übermacht und der Lüge, die in der Welt und im Innern verheerend gewirkt hat, sondern eine zusammenfassende Antwort Gottes auf die deutsche Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Mit dieser Erkenntnis ist der Sinn des Krieges noch nicht nach allen Richtungen verstanden; aber für die deutsche Christenheit ist solche Erkenntnis ein wichtiges Stück. Sie bewahrt vor der Gefahr, die Schuld am Fall am falschen Ort zu suchen und falsche Wege zum Wiederaufbau einzuschlagen. Mit Deutschland geht es wie mit Israel: nur der kann es heilen, der es zerschlagen hat; und er heilt nur die, die sich zu ihm wenden.
Weiter oben wurde der Wiederaufgang des Evangelium innerhalb der römisch gewordenen Kirche als ein Eingreifen Gottes verstanden, mit dem er die verkehrte Entwicklung anhielt und in die von der rechten Richtung abgekommene Kirche ein Samenkorn neuen Lebens senkte, das, wenn’s zur Reife gekommen wäre, zur Überwindung des alten Wesens hätte dienen können. Wenn nun der vorhin aufgestellte und geschichtlich geprüfte Satz richtig ist, daß Gott die deutsche Geschichte auf den Empfang und die Weitergabe des Evangeliums anlegte, und daß Deutschlands geschichtlicher Gang seit der Reformation in Gnade und Gericht bestimmt worden ist durch die Treue und Untreue seiner göttlichen Berufung gegenüber, denn liegt der weitere Satz nahe, daß die bis-[252]herige deutsche Geschichte aus dem Rahmen des römischen Reichs herausfällt, obwohl es äußerlich enge Beziehungen zu demselben hatte. Wir haben die französische und russische Geschichte als Fortsetzung und Erweiterung der ursprünglichen römischen Geschichte betrachtet, nicht bloß in dem Sinn, daß sich die Geschichte dieser Völker an die des alten Rom anschließt, sondern auch in dem , daß innere z.T. sogar vom Volksbewußtsein gefühlte Beziehungen zu den treibenden Kräften der alten römischen Geschichte da sind, politisch und religiös. Die deutsche Geschichte gehört nicht in diesen Rahmen. Daß es in der Hauptsache außerhalb des römischen Grenzwalls lag, während Frankreich schon vor unserer Zeitrechnung dem römischen Reich einverleibt wurde, ist für diesen Gedanken nicht maßgebend. Denn auch Rußland gehörte politisch nicht zum alten römischen Reich und sieht doch im oströmischen Konstantinopel Rußlands Tor. Man könnte gegen den Satz von der Nichtzugehörigkeit Deutschlands zum römischen Wesen einwenden, daß im Mittelalter fast lauter deutsche Herrscher die römische Kaiserwürde innehatten und ihre Gedanken immer wieder an Italien ketteten, als an das Hauptland des alten Reiches, auch viel deutsches Blut für diesen Traum opferten; ebenso, daß die Idee des Reichs und des Kaisertums am tiefsten im Herzen des deutschen Volks verankert war. Aber gerade die Treue, mit der Deutschland und seine Herrscher am Reich hingen, ist ein Zeichen, daß sie sich wohl im Gemüt für diese Idee begeisterten und einsetzten, daß aber eigentlich römisches Wesen mit seinen Hintergründen dem deutschen Wesen innerlich fremd war. Diese Beobachtung, daß nämlich das Eingehen auf einen Gedanken, auf eine Idee, noch nicht das Verflochtensein mit dem ihm zugrundliegenden Wesen bedeuten muß, kann man auch an der vorreformatorischen Kirchengeschichte Deutschlands machen. Treuere Ergenbenheit als in Deutschland hat die Kirche des Mittelalters wohl in keinem Volk gefunden; aber die mehr und mehr vom Evangelium sich kehrende Art der Kirche ist trotzdem auf deutschem Boden schon vor der Reformation geahnt und empfunden worden. Eigentlich römisches Wesen galt als welsch.
Freilich hat in Deutschland auch eine andere Art Boden gewonnen, die sich an der Weltförmigkeit der Kirche nicht 253 stieß. Es war ein Verhängnis für Deutschland, daß diese Art festen Fuß faßte im habsburgischen Kaiserhaus, bei der Mehrzahl der geistlichen Würdenträger und bei einer Anzahl deutscher Fürsten. Dadurch wurde die deutsche Reformation im Keim bedroht und ihre völlige Durchführung verhindert, unser Volk in Glaubenssachen in zwei Teile gespalten, unsere Reformatoren unter dem harten Druck der Verhältnisse gezwungen, die neue Kirche nicht nach ihren eigenen Lebensnotwendigkeiten, sondern in Anlehnung an die staatlichen Gebilde und die Staatshoheit aufzubauen, und Deutschland in das Elend des 30jährigen Krieges gestürzt.
Wie soll dieses Nebeneinander beurteilt werden? Sieht man nur auf die Vorgänge selber, dann wird der tiefere Grund des Unterschieds, des Zwiespaltes und Kampfes nicht erfaßt. Er kann nur verstanden werden aus dem unsichtbaren Hintergrund alles Geschehens, dem Ringen zwischen der oberen und der unteren Welt. Luther hat das treffend im bekannten Reformationslied ausgesprochen. Der alte, böse Feind wollte sein Werk nicht stören lassen. Darum bestellte er auf deutschem Boden die Mächte, die das begonnene Gotteswerk beargwöhnen, stören, hindern, unterdrücken und beseitigen sollten: die dabei verwendeten Waffen waren, je nachdem, List und Gewalt. Das Evangelium im Herzen Europas sollte nicht siegen. Darum bekam das gottgewirkte Neue sofort neben sich einen Widerpart.
Die habsburgische Monarchie hat später auch solche Vertreter bekommen, die dem Evangelium nichts zuleide taten. Aber die Monarchie war belastet mit der ganzen Last der Vergangenheit. War es göttliche Politik, als Deutschland, das eigentlich für das Evangelium verpflichtete Volk und Land, sich mit dem fast ganz auf den alten Bahnen gebliebenen bzw. zu ihm zurückgekehrten Östreich auf Gedeih und Verderb zusammenband? Damit ist kein Stein geworfen auf den letzten ehrwürdigen Vertreter Östreichs, der den Zusammenbruch seines Hauses und den Zerfall der Monarchie nicht mehr erleben mußte, sondern zwei Jahre vorher die Augen schließen durfte. Aber Tatsache ist es, daß die Verbundenheit mit Österreich Deutschland mit hineingerissen hat in den Krieg und mit die Ursache geworden ist zu seinem Sturz.
Der tiefere Sinn des Weltkriegs
Von verschiedenen Seiten her kam bereits die Rede auf den Weltkrieg: von der Geschichte Rußlands als der Fortsetzung Ostroms (S. 189), von der Geschichte Frankreichs als der Wiedererstehung Westroms (S. 192), von der deutschen Geschichte (S. 251), wie von der Erwähnung Österreichs (S. 253). Auf dieses einschneidende Ereignis läuft die europäische Geschichte zu und von diesem Ereignis aus wird sie zu ihrem Abschluß gelangen. Der Weltkrieg, der nun bald 10 Jahre hinter uns liegt, ist ein geschichtlicher Knotenpunkt ersten Ranges. Nicht bloß für die Geschichte Europas, sondern auch für die Weltgeschichte. Das Gefühl, daß 1914 ein Abschluß stattgefunden habe, und daß die Weltgeschichte seitdem in einen neuen Abschnitt eingetreten sei, ist allgemein. 255 Ebenso ist der Eindruck weitverbreitet, daß seitdem das Geschehen ein rascheres Tempo angenommen habe. Aber wenn sich nun die Erwähnungen der Zukunft zuwenden, dann gehen die Gedanken auseinander. Den einen, zumal den Siegervölkern, scheint trotz mancher Gewitterzeichen ein neuer Tag der Menschheit angeborchen zu sein. Andere, zumal solche, welche das Geschehen im Licht der Bibel sehen und sehen wollen, sind erschüttert und kommen von dem Eindruck nicht mehr los, daß der gegenwärtige Zeitlauf seinem Ausgang entgegeneile. Die letztere Auffassung wird auch in diesem Buch vertreten, und sie wird an der Hand des ganzen Geschichtslaufs im Licht der Bibel geprüft. In welchem Sinn der Weltkrieg im vorliegenden Buch verstanden wird, das möge an einem Gleichnis dargelegt werden. Der Ausbruch dieses Krieges gleicht dem Einwurf eines Steins in einen geschlosenen See. Beim Einwurf gibt’s an der Einwurfstelle eine kräftige Wallung des Wassers; es spritzt empor. Das waren die Kriegswogen. Mit dem Aufspritzen und Aufwallen an der Einwurfstelle ist aber die Wirkung des Einwurfs noch nicht beendigt: um die Stelle herum legen sich die Wellenkreise, die sich immer mehr erweitern, bis das Ufer des Sees erreicht ist. Da erst kommen sie zur Ruhe. Der See ist die Völkerwelt. Die Einschlagstelle war verhältnismäßig klein; der Kriegsschauplatz an sich würde trotz seiner weiten Ausdehnung die Bezeichnung des Krieges als Weltkrieg nicht rechtfertigen. Aber vom Kriegsschauplatz gehen auch nach Kriegsende die Wirkungen aus nach allen Richtungen der Welt und auf alle Verhältnisse der Welt und bis an das Ende der Zeit, die bis zum Ablauf der gegenwärtigen Geschichte noch übrig ist.
Der Mittelpunkt des gewaltigen Geschehens war Deutschland. Der Herd des Kriegs lag zwar nicht auf deutschem Boden, und Deutschland war nur eines der bedrohten Gebiete. Trotzdem stand Deutschland im Brennpunkt des Hasses. Auf die Niederringung Deutschlands waren alle Anstrengungen der Gegner gerichtet. Was war der Grund für den einmütigen Sturm auf Deutschland? Wir schalten alles politische aus und lassen die Kriegsgründe, die tatsächlich oder insgeheim vorlagen, und die Kriegsziele, ob sie nun ausgesprochen wurden oder nicht, auf der Seite. Unsere Frage geht nach 256 dem tieferen Kriegsgrund und Kriegsziel. Für die Antwort ist es nicht wesentlich,
ob eine am Krieg beteiligte Seite wissentlich und willentlich auf dieses Kriegsziel hingearbeitet hat. Denn letztlich handelt es sich um die Frage nach den unsichtbaren Hintergründen jenes eingreifenden Geschehens. Daß Gottes Hand über allem stand, daß er Deutschland hätte durchhelfen und es retten können, daß er durch den Gang der Ereignisse dem ganzen deutschen Volk und jedem einzelnen Glied desselben tiefernste Dinge sagen wollte, das steht außer Zweifel. Aber wer mit wachen Augen die Ereignisse verfolgt hat, und wer zur Einsicht gekommen ist, daß das menschliche Geschehen nicht nur lichte Hintergründe hat, der wird in den Ereignisse der letzten 15 Jahre auch genug Unheimliches wahrgenommen haben, das auf einen satanischen Zweck dieses Krieges hinweist. Diesen Zweck klarzulegen, dazu ist ein weiteres Ausgreifen nötig.
Es war schon früher davon die Rede, daß das satanische Wirken nicht nur auf die Förderung des eigenes Zieles ausgeht, sondern sich auch mit der Ausschaltung der Widerstände befaßt. Denn kampflos gelingt dem alten, bösen Feind sein Anschlag nicht. Es gibt Aufhaltendes (2. Thess. 2, 6). Paulus spricht an jener Stelle vom Aufhaltenden zuerst im sächlichen und dann (Vers 7) im männlichen Geschlecht. Es läßt sich schwer mit Bestimmtheit sagen, wem Paulus an jener wichtigen Stelle die Aufgabe, Fähigkeit und Kraft zuschreibt, den Anbruch der antichristlichen Zeit aufzuhalten, bis die für sie bestimmte Stunde gekommen ist. Bei einer solchen Gelegenheit kann die heutige Christenheit sehen, wie eingehend die Apostel die alte Christenheit unterrichtet haben, und wieviel sie ihr zu sagen für nötig hielten bereits im Anfang ihres Christenstands. Wieviel muß Paulus z. B. den Christen in Troas zu sagen gehabt haben, wenn er bei der Durchreise vom Abend bis zum Anbruch des Tages mit ihnen sprach, wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, daß es das letzte Wort war, das er ihnen sagen konnte (Apostelgesch. 20, 7-12). Was im Hebräerbrief als ABC des Christenstands bezeichnet ist (Hebr. 6, 1. 2), das kommt uns Heutigen als sehr viel vor, und die große Menge der Christenheit bleibt hinter diesen Anfangsgründen zurück. So gehört es auch mit zum Jammer der heutigen Christenheit, daß sie nicht mehr 257 bestimmt weiß, was Paulus den Thessalonichern bereits in den ersten Wochen ihres Christenstandes gesagt hat über die letzten Dinge, so besonders über das, was aufhält (2. Thess. 2, 6) und den, der aufhält (2. Thess. 2, 7). Vielleicht ist beim letzteren an einen der guten himmlischen Geister zu denken, von denen bei Daniel die Rede ist. Der steht noch in der Mitte zwischen der vorwärtsbringenden Macht der Finsternis und den menschlichen Verhältnissen, daß sie nicht vor der Zeit zum antichristlichen Zustand ausreifen. Wenn er nach Gottes Befehl aus der Mitte wegtreten muß – diese Übersetzung ist richtiger als die Luthers und Menges, die eine Beseitigung dieses aufhaltenden Wesens durch die satanische Macht nahelegt –, dann steht der raschen Vollendung des satanischen Plans nichts mehr im Weg. Ob nicht vielleicht an den guten Geist Israels zu denken ist? (Der gute Geist nicht im Sinn unserer abgeblaßten Redeweise, sondern ganz buchstäblich, im Sinne Daniels). Unter dem, was aufhält, ist vielleicht an irgendwelche irdischen Verhältnisse zu denken, wahrscheinlich aber an das Evangelium. Solange das Evangelium noch Wirkungsmöglichkeiten hat, wirkt es aufhaltend. Das Evangelium ist im Griechischen wie im Deutschen sächlichen Geschlechts. Worauf nun aber ebensosehr der Nachdruck zu legen ist, wie auf die Bestimmung, wer und was mit dem Aufhaltenden gemeint sei, das ist die Aussage des Apostels, daß Gott gegen das Vorwärtseilen der satanischen Macht Widerstände eingeschaltet hat. Wie großen Dankes ist das wert! Wo stünde die Welt, wenn die Macht der Finsternis schalten und walten dürfte? Und wer ahnt oder weiß, an welchen Abgründen er selbst schon vorbeigekommen ist, der soll dankbar sein, daß dem Zugriff des Satans eine haltende Hand entgegenwirkt. Er möge dieser haltenden Hand nicht zuviel Arbeit zumuten durch mutwilliges und leichtsinniges Eingehen auf die Lockungen der Finsternis. Aber neben dem Trost steht der furchtbare Ernst: das Zurückhalten hört einmal auf! Dann eilt die Macht der Finsternis, ihr Werk zu vollenden.
Auch wenn unter dem, was aufhält, das Evangelium zu verstehen ist, kann das Aufhalten doch durch allerlei menschliche Zustände und Ordnungen vermittelt sein, nämlich durch solche, die die Ausbreitung und die Aufnahme des Evange-[258]liums begünstigen. Die Gemeinde Jesu als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist etwas Aufhaltendes; das Vorhandensein von Gerechten wirkt aufhaltend (s. das Gericht über Sodom); die Aufgeschlossenheit einer Kirche für das Evangelium hält das Verderben zurück, selbst wenn es in der Kirche viel Menschliches und Menschelndes gibt; eine gute Sitte, die sich Respekt zu verschaffen weiß, hat bewahrende Macht, selbst wenn sie nicht unmittelbarer Ausfluß des Glaubens ist; feste staatliche und gesellschaftliche Ordnungen sind Dämme gegen das Einbrechen der Verderbensfluten. Ist nicht viel Grund zum Danken da, daß noch ein derartiges Aufhaltendes vorhanden ist, und daß mitten im Zusammenbrechen von Dämmen andere Dämme aufgeworfen werden! Auch das Dammaufwerfen ist eine wichtige christliche Aufgabe. Aber neben dem Dank für das Aufhaltende, das noch vorhanden ist und neu entsteht, ist ein heilsames Erschrecken am Platz über das Verschwinden von so vielem, das seither aufgehalten hat und über das Schwachwerden von so vielem, das sich seither dem einbrechenden Verderben entgegengestellt hat.
Nach diesem Blick in die Schrift folge ein Blick in die Geschichte im Licht der Schrift. Wie gern hätte der Drache das Tier rasch ausgestaltet! Ohne Bild: wie gern hätte er dem römischen Wesen rasch zur Herrschaft über die Welt verholfen! Es ist auch tatsächlich trotz der Länge der Zeiten rasch gegangen; aber Aufhaltendes gab es ebenfalls; wir sehen das Aufhaltende im Evangelium. Wie gerne hätte der alte böse Feind durch die Macht des alten römischen Kaisertums dieses aufhaltende Evangelium beseitigt! Er hat fast alle Qualen zu diesem Zweck aufgeboten, die nur denkbar sind, und er fand bereitwillige Helfer. Aber das Evangelium wich nicht; denn seine Bekenner waren mit Gewalt und Pein nicht zum Schweigen zu bringen. Da sollte das Evangelium geschwächt werden, indem er die Kirche zu weltlicher Ehre brachte, ihr die erste Stelle im Reich zuwies. Nur um den Thron sollte das Kaisertum höher sein. Eine herrschende Kirche tut ja schwerer, Bewahrerin des Evangeliums zu bleiben; aber die Ausscheidung des Evangeliums aus der Kirche gelang nicht. Als die germanischen Völker gegen Reich und Kirche vorgeschickt wurden, rettete die Kirche das Reich und 259 bot den neuen Völkern das Evangelium an, wenn auch nicht mit seinem vollen Gehalt. Da schickte der Feind die arabischen Scharen und mit ihnen eine dem Evangelium nachgebildete Botschaft, die doch kein Evangelium war. Aber die Vernichtung des christlich gewordenen Reichs gelang nicht, und das Evangelium wurde trotz vieler Verdunkelungen nicht ausgelöscht. Da kam der Papst und Menschensatzungen wurden herrschend. Wo würde das Evangelium bleiben? Es litt große Not; aber aus dem wenigen, was blieb, erwuchs der Schrei der christlichen Völker noch mehr, nach dem vollen Evangelium. Da tat Gott ein Besonderes und erhörte das Schreien und stellte das Evangelium wieder auf den Leuchter, und besonders dem deutschen Volk vertraute er das Licht an, damit es sich selbst davon erleuchten ließe und dann es leuchten ließe in der arm gewordenen Christenheit. Da setzte die Finsternis zum Gegenstoß ein und wehrte dem Leuchten und im 30jährigen Krieg blies sie das Licht aus. Aber es brannte weiter und wurde wieder zur Flamme. Und Deutschland hätte inmitten der Christenheit leuchten sollen. Dem wurde gewehrt durch den Weltkrieg.
Das deutsche Volk ist freilich ein sündiges Volk wie andere Völker auch. Und es ist gut, wenn der Vergleich mit andern Völkern, wer tiefer gefallen sei vor Gottes Augen, nicht zur Hoffahrt wird. Mögen andere Völker noch tiefer gesunken sein, so gilt doch von ihm der Spruch Lukas 12, 48: „Jeder, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden; und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man um so mehr verlangen“; und: „der Knecht, der seines Herrn Willen weiß, und hat nicht nach seinem Willen getan, der wird viele Streiche leiden müssen“ (Vers 47). Nicht Deutschland und das deutsche Volk soll gerühmt werden. Es soll nicht das Wort gelten: „am deutschen Wesen soll noch die Welt genesen!“ Sondern das Evangelium soll gepriesen sein. Das Evangelium war das Gute in Deutschland und ist noch sein Gutes. Um des Evangeliums willen hat Gott unserem Volk während der Zeit des neuen Reiches so freundliche, friedliche Verhältnisse geschaffen und es zu Ehren gebracht.
Der Ausschaltung des Evangeliums galt der Kampf, den die Macht der Finsternis gegen Deutschland entfesselte. Ihr 260 war noch zu viel Evangelium vorhanden innerhalb der Christenheit. Nun sollte das Volk, dem Gott das Evangelium inmitten der Christenheit anvertraut hatte, bis in die Grundfesten erschüttert und vom Evangelium losgelöst werden. Diejenige Macht, die auch äußerlich als Stütze des Evangeliums gelten konnte, das evangelische Kaisertum, sollte beseitigt werden. Deutschland, das bisher ein Fremdkörper im römischen Gefüge Europas war, sollte seiner Kraft und seines Einflusses entkleidet, als dienendes Glied in dieses Neurom eingefügt werden. Die Helfer der Finsternis waren in einträchtigem Zusammenwirken das neuerstandene West- und Ostrom (Frankreich und Rußland), sowie eine späte Nachbildung des alten Roms, nämlich Italien. Von England wird später die Rede sein. Ein tiefernstes Wort, das nach dem Weltkrieg auf römischer Seite gefallen ist, daß der eigentliche Besiegte im Weltkrieg Luther gewesen sei, läßt auch in die Gedanken des geistlichen Roms Blicke tun.
Die Ausschaltung der Selbständigkeit Deutschlands ist gelungen. Es wurde der Politik der Großmächte unterstellt. Die politische Führung des festländischen Europas ist nun in Roms Hände gekommen (Rom hier im politischen Sinn verstanden). Die führende Stellung hat Frankreich inne. Vollendet ist dessen Eintritt in die Stellung des alten Westroms. Zum Ziel gelangt ist seine Herrscherstellung, die in den Jahren 451 und 732 sich anbahnte, die in der Kaiserkrönung Karls des Großen ihre Fortsetzung fand (der als König des Frankenreichs, nicht als rein deutscher Herrscher zu werten ist), die 1303 am Ausgang des Mittelalters wieder in die Erscheinung trat, die von Napoleon I. und III. zu stolzer Höhe erhoben wurde. Keine Macht des festländischen Europa kann sich gegenwärtig an Machtentfaltung neben Frankreich stellen. Es ist der Erbe des alten Rom, auch im stolzen Gefühl seines Ruhms. Aber Ostrom hat sich ebenfalls gemeldet. Zwar brach das alte russische Kaiserreich im Weltkrieg zusammen. Aber im Bolschewismus hat sich ein gelehriger Schüler der französischen Revolution zum Herrscher Rußlands gemacht, dessen geistige Wirkung weit über die Grenzen Rußlands hinausragt, nicht bloß nach Europa hinein, sondern in die Welt hinaus. Und das durch fast 1 1/2 Jahrtausende hindurch politisch zerklüftete und ohnmächtige Mutterland Roms, Italien, seit 1870 ge-[261]einigt, regt sich ebenfalls wieder und hat seine Herrschaftsansprüche geltend gemacht. So steht das alte, totgeglaubte Rom von neuem da; zwar in verschiedenartiger Gestalt und nicht zu einem Ganzen zusammengeschlossen, und doch einig in der Art.
Der Krieg hat auch einen Zusammenschluß der Völker gezeitigt: den Völkerbund. Nach den ihm zugrundliegenden Gedanken sollte er ein womöglich alle Völker umfassender Bund sein, also über Europa weit hinausgreifen. Aber die Union ist ihm von vornherein fern geblieben, und es wäre kein Wunder, wenn die außereuropäischen Völker mit der Zeit absplittern würden. Dieser Bund bedeutet noch nicht die Erfüllung von Offb. 17, 13, wo von den Mächten die Rede ist, die sich einst dem antichristlichen Weltherrscher zur Verfügung stellen werden. Eher könnte er ebenfalls als eine Art Wiederaufleben des alten Rom in neuzeitlicher Form verstanden werden. Rußland steht auf der Seite. Aber Deutschland ist eingetreten. Schon durch den Ausgang des Krieges ist es politisch ganz ins Getriebe der Weltmacht hineingestellt worden. Nun hat es sich auch mit eigenem Willen in das Ganze eines Bundes gestellt, dessen Kennzeichen man nicht die gegenseitige Treue der Bundesglieder zueinander nennen kann, sondern eher deren Ringen miteinander unter dem Schein der Freundschaft.
Aktualisiert am: 14.05.2018
Bildnachweise
Zitierweise
https://www.wkgo.de/cms/article/index/weimarer-republik-im-kirchenbezirk-herrenberg (Permalink)
Nutzungsbedingungen
Alle Rechte vorbehalten.